#Machtstrukturen
Explore tagged Tumblr posts
Text
"Ich habe keine politische Meinung" – Wieso das nicht stimmt!
Genau den oder ein anderen Spruch hört man andauernd, ich kann es nicht mehr hören. Du glaubst nicht an das System und willst nicht wie ‘die’ sein – das ist eine politische Haltung. Kritik am System ist auch Teil des politischen Spektrums. Es gibt keine Position außerhalb der Politik, solange man über Gesellschaft und Macht spricht.Sich für unpolitisch zu halten, während man das System…
#2025#Demokratie#gesellschaft#Gesellschaftskritik#Machtstrukturen#Meinungsfreiheit#politik#politische Haltung#politische Meinung#politische Partizipation#politisches Spektrum#Protest#Systemablehnung#Systemkritik#Systemveränderung#Unpolitisch#Wahlen
0 notes
Text
Blaues Blut und Blutsauger: Vom Adel zu modernen Vampiren der Gesellschaft

Von den düsteren Schlössern Transsylvaniens bis zu den glitzernden Wolkenkratzern der Finanzmetropolen - der Vampirmythos hat eine erstaunliche Wandlung durchgemacht. Doch ist er wirklich verschwunden, oder hat er nur sein Gewand gewechselt? In einer Welt, in der das "blaue Blut" des Adels durch das "grüne Blut" des Geldes ersetzt wurde, fragen wir uns: Wer sind die modernen Vampire unserer Gesellschaft? Eine Reise durch die Schattenwelt der Macht, des Privilegs und der subtilen Ausbeutung - mit einem Augenzwinkern und einem Knoblauchzeh in der Tasche. Read the full article
#Adel#Ausbeutung#demokratie#GesellschaftlicherWandel#Gesellschaftskritik#Kapitalismuskritik#Machtstrukturen#madunlimited#ModerneElite#PolitischeVampire#Privilegien#Satire#Selbstreflexion#SozialeUngleichheit#Transparenz#Vampirmythos
0 notes
Text
Ich bin mit Sicherheit nicht die erste, der das auffällt, aber ich musste heute nochmal über das Klingelschild der Schürks am Bunker nachdenken und darüber wie das - vielleicht mehr zufällig als beabsichtigt? - in dfl und hds irgendwie weirdly gut als foreshadowing funktioniert.
Mich hat's beim Gucken von dfl immer total beeindruckt, wie da auch 15 Jahre nachdem Roland ins Koma gespatet wurde gefallen ist, noch immer sein Name (R. Schürk) an der Tür steht. (Und zwar alleinig - dass Heides Vorname nicht dran steht, obwohl seit 15 Jahren niemand anderes als sie im Bunker lebt, spricht im Gegensatz dazu natürlich auch Bände in Hinblick auf die Familiendynamik der Schürks und Machtstrukturen, die Roland selbst aus dem Koma heraus noch irgendwie schafft aufrecht zu erhalten.)

Anyway - was passiert dann am Ende von dfl? Roland wacht auf. Und das fucking Klingelschild passt plötzlich wieder.
In HdS sieht man in der Szene, in der Adam am Bunker klingelt, dann dass das Klingelschild ein Neues ist - plötzlich steht da nur noch Schürk. Kein R. mehr.

Und was passiert im Laufe des Films - noch in derselben Nacht? Roland stirbt. Und das Klingelschild passt WIEDER. (Oder anders: Das "R. Schürk"-Schild hätte dann zumindest nicht mehr gepasst.)
Ob das so beabsichtigt war oder einfach ein Filmfehler ist, sei mal dahingestellt (ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung). Aber irgendwie ist das ein kleines fun Detail, das überraschend gut als foreshadowing funktioniert.
#nicht dass das den durchschnitts-tatort-guckenden auffallen würde#(sag mal jürgen#das klingelschild der schürks sah in der folge vor zwei jahren aber noch anders aus oder?)#but you know#frag mich auch welche erklärung man in canon für den wechsel des klingelschilds finden könnte#vllt hat roland das in seiner fake nice “i've changed” era in hdw ausgewechselt#spatort#tatort saarbrücken#dfl#hds
62 notes
·
View notes
Text

Männliche Unterwerfung, weil es manchmal gut ist, die Regeln zu befolgen
In einer Welt, in der Machtstrukturen und traditionelle Rollen ständig hinterfragt werden, ist der Begriff der männlichen Unterwerfung relevanter denn je. In einer Zeit, in der Autonomie und Dominanz oft mit Stärke gleichgesetzt werden, warum finden einige Kraft und Erfüllung in der Unterwerfung, insbesondere bei Männern?
Der historische Kontext von Macht
Seit Jahrtausenden hat die patriarchalische Kultur Männer als Führer, Entscheidungsträger und oft als Dominatoren positioniert. Doch mit dem Aufstieg feministischer Bewegungen und der Evolution moderner Gesellschaften begannen diese Rollen sich zu verändern. Heute verstehen wir, dass Stärke nicht nur im Befehlen liegt, sondern auch in der Fähigkeit zu zuhören, zu verstehen und zu folgen.
Unterwerfung als Wahl
Sich für die Unterwerfung zu entscheiden bedeutet nicht, seine eigene Kraft oder innere Stärke aufzugeben. Im Gegenteil, es kann ein tiefer Ausdruck von Selbstvertrauen, Akzeptanz und Verständnis für die eigenen Grenzen sein. Es ist eine Anerkennung, dass das Befolgen von Regeln, sei es in einer Beziehung, bei der Arbeit oder in persönlicher Disziplin, den Weg zu größerer Erfüllung ebnen kann.
Die Vorteile von Regeln befolgen
Lernen und Wachstum: Indem man sich freiwillig der Anleitung eines anderen hingibt, öffnet man sich für neue Perspektiven und Lehren.
Beziehungen stärken: Unterwerfung kann das gegenseitige Vertrauen und den Respekt verstärken und stärkere Bindungen zwischen Individuen schaffen.
Stressreduktion: Das Loslassen des Kontrollbedürfnisses kann dem Geist eine Pause gönnen und es einem ermöglichen, im Moment zu leben.
Persönliche Entwicklung: Das Akzeptieren und Befolgen von Regeln oder Richtlinien kann an sich schon eine Herausforderung sein und zur Reflexion und zum Wachstum anregen.
Hin zu einem neuen Paradigma
Es ist an der Zeit zu erkennen, dass Männlichkeit ein Spektrum ist und Unterwerfung ein integraler und geschätzter Teil dieses Spektrums sein kann. Indem Männer diese Facette annehmen, können sie neue Dimensionen ihrer selbst erkunden und nicht nur im Befehlen, sondern auch in der Fähigkeit zu folgen, zu hören und sich zu fügen, Stärke finden.
Zum Abschluss, männliche Unterwerfung ist eine Feier der Vielfalt menschlicher Erfahrungen. In einer Welt, in der Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Empathie immer mehr geschätzt werden, ist es vielleicht an der Zeit zu erkennen, dass das Befolgen von Regeln nicht ein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke ist.
102 notes
·
View notes
Text
Gesellschaftskritik hat viele Gesichter – nicht jede Kritik an gesellschaftlichen Strukturen, mag sie noch so intellektuell und hochtrabend formuliert und auf provokante Rhetorik aufgebaut sein, entspringt echter Reflexion. Manchmal ist sie nur eine leere Hülse, eine gut getarnte Illusion.
Gerade bei Themen wie Objektifizierung, Machtstrukturen oder gesellschaftlicher Moral fällt es besonders auf:
Manche inszenieren sich provokativ und scharf als Wahrheitsverkünder – doch bleiben sie selbst Teil des Problems, das sie kritisieren. Sie prangern lautstark Missstände oder gesellschaftliche Probleme an, während sie selbst genau diese Strukturen unterstützen oder sich sogar ihrer bedienen.
Ein klassisches Beispiel sind Männer, die lautstark über Feminismus oder die Sexualisierung von Frauen sprechen – und gleichzeitig hinter vorgehaltener Hand Frauen als Lustobjekte betrachten und behandeln. Besonders fragwürdig wird es, wenn jemand die Objektifizierung von Frauen kritisiert, sich aber gleichzeitig an pornografischen Darstellungen erfreut oder Frauen auf ihre weiblich-intimen Körperteile reduziert.
Es gibt einen klaren Unterschied zwischen echter, reflektierter Gesellschaftskritik und einem „pseudokritischen Zynismus“, der eigentlich nur der eigenen Selbstdarstellung oder Legitimation des eigenen Verhaltens dient. Echte Reflexion bedeutet, sich selbst nicht aus der Kritik herauszunehmen. Wer Missstände anprangert, sollte sich fragen, ob er nicht selbst dazu beiträgt – sonst bleibt es bloßer Zynismus und eine bequeme Pose.
6 notes
·
View notes
Text
Gladiator II (O-Ton)...

...ist ein Paradebeispiel für einen Film, dem man getrost das Prädikat "mixed bag" verleihen darf. Wir haben auf der einen Seite einen handwerklich immer noch brillanten Ridley Scott, der die absurdesten, aufwendigsten Setpieces auch mit fast 90 noch so wegdrehen kann, dass sie wie eine filigrane Fingerübung wirken, auf der anderen Seite immer wieder allzu wackeliges CGI. Wir haben einen formidablen Cast, allen voran Denzel Washington, der sich mit überschäumender Energie in seinen schillernden Schurken reinwirft, dass er selbst noch die Szenen zu stehlen scheint, in denen er gar nicht beteiligt ist, und dann immer wieder das Gefühl, dass ebendieser Edelcast sich mit einem Drehbuch abmühen muss, welches mal Feinschliff, mal Komplettrenovierung gut vertragen hätte.
Mein Hauptproblem mit "Gladiator II" ist freilich, dass sich der Film nie ganz entscheiden kann, ob er er nostalgisch den einfach gestrickten Gut-Böse-Regeln des gemeinen Sandalenfilmes folgen oder doch lieber eine mit der Zeit gehende Dekonstruierung von Machtstrukturen sein will. Scott versucht beides und so kommt beides nie so ganz zum Fruchten: seine Fortsetzung ist insgesamt zu grobschlächtig, damit die fein differenzierteren Momente irgendeinen Nachhall haben können, diese vergiften aber wiederum ein Ende, in welchem uns verkauft werden soll, dass hier einmal mehr das Rechtschaffende gegen die Tyrannei gewann. In Zeiten, in denen beispielsweise ein Robert Eggers vormacht, wie eben nicht alle historischen Figuren in Filmen moderne, aufgeklärte Menschen sein müssen, um spannende, sinnstiftende Charaktere zu sein, wirkt der herkömmliche Ansatz "alle Helden sind moderne US-Amerikaner" ohnehin schon obsolet. Wenn man dann noch merkt, dass der Regisseur eigentlich selbst viel zu schlau für das Ganze ist, wird es schwierig. Der Gedanke "bei Michael Bay hätte ich zumindest die Intention der patriotischen Schlachtplatte geglaubt" sollte nie in einem Kino gedacht werden, leider dachte ich ihn nicht nur einmal während "Gladiator II".
Doch wie bei Ridley Scott üblich gibt es auch hier genügend Nachhall, Widerhaken, die in Herz und Hirn feststecken und zu denen ich immer wieder zurückkehre. Ja, der Film ist ein chaotisches Dingsbums, aber so etwas von Scott serviert zu bekommen ist eben immer noch besser als vieles andere.
D.C.L.
#filmkritik#d.c.l.#kritik#spielfilm#chronicles of d.c.l.#drama#action#gladiator 2#gladiator ii#ridley scott#denzel washington#paul mescal#pedro pascal
2 notes
·
View notes
Text
Holà! Ich bin gestern mitten in der Nacht aufgewacht, weil mein Bett gewackelt hat. Ich dachte, das Haus wankt vielleicht im Wind. Es war aber windstill. Also Leute, das bedeutet: ich habe mein erstes Erdbeben erlebt! Gruselig. Ist aber nichts passiert und alles gut, unser Haus ist erdbebensicher gebaut und die Erdbeben hier wohl immer nur so mittelstark.
Nun wie versprochen zum Kaffee-Anbau. Ich hole da ein bisschen aus. Kaffee wird in Europa so viel getrunken, vom Anbau hat aber wohl kaum jemand Ahnung. Deswegen:
Kaffee ist ein aus Äthiopien stammender immergrüner Strauch. Sein Anbau ist langwierig und zeitaufwendig. Erst nach drei bis vier Jahren blüht die Pflanze zum ersten Mal, vorher gibts keinen Ertrag. Weltweit im großem Stil angebaut werden nur Arabica- und Robusta-Pflanzen, wobei in Costa Rica ausschließlich Arabica angepflanzt werden darf.
Geerntet wird der Kaffee hier von Ende Oktober bis Februar. Per Hand. Reif ist eine Kaffeefrucht, wenn sie rot ist. Eine Kaffeefrucht bzw. -Kirsche enthält zwei Kaffeebohnen. Da die Früchte nicht gleichzeitig reif sind, muss jeder Kaffeebusch bis zu drei, vier Mal “bepflückt” werden.
Die Ernte hat jetzt also begonnen. Geerntet werden die Früchte überwiegend von Gastarbeiter:innen aus Nicaragua - für sie eine dringende Einnahmequelle. Auf unserer Finca sind momentan sieben Pflücker:innen zu Gast. Untergebracht sind sie in “Behausungen” auf engstem Raum, tlw. Ohne Fenster.
Bezahlt wird nach Kilo. Wenn man wirklich viel und schnell pflückt, kann man am Tag wohl (immer abhängig vom aktuellen Kaffeepreis) um die 25€ verdienen, ca. 160 Kilo Kaffee hat man dann geerntet. Also gilt: je mehr man pflückt, desto besser. Das hat Auswirkungen. Zum Beispiel, dass die Menschen die ganze Woche durchpflücken, auch am eigentlich freien Sonntag. Da die Pflücker:innen über mehrere Monate hier leben, müssen sie ihre Kinder mitbringen. Heißt dass Kinder, sobald sie alt genug sind, oft mitpflücken. Kinderarbeit ist also ein Thema. Und die Kinder, die zu klein sind, können auch nicht den ganzen Tag allein bleiben - stehen also bei jedem Wetter bzw. Jeder Hitze mit im oft sehr steilen Kaffeeberg. Viel Aufwand für eine Tasse Kaffee, den sie sich wahrscheinlich nie werden leisten können.
Auch über “Vorfälle” und von ansteigender Kriminalität in den Erntemonaten wird uns berichtet. Armut, Machtstrukturen, Rassismus, Vorurteile. Krass, das hier mitzuerleben.
Die Bohnen unserer Finca werden (noch), wie die meistern anderen auch, auf dem einfachsten aber leider auch unwirtschaftlichsten Wege verkauft: sie gehen als ganze Frucht an einen Zwischenhändler (sog. “Cooperativas”), wo die Bohnen mit anderen gemischt, geschält, geröstet und dann in die USA exportiert werden. Die Kaffeebauer:innen und Pflücker:innen werden bei dem Vorgehen natürlich nicht angemessen für ihren Einsatz entlohnt.
Solche Probleme gibt es wohl fast überall, wo Kaffee angebaut wird. Es gibt weltweit Projekte, die dem entgegenwirkten wollen, indem sie die Kleinbauer:innen z.B. dabei unterstützen, die Kaffeeverarbeitungsschritte (schälen, trocknen, rösten) selbst durchzuführen und dann unabhängig von Zwischenhändler:innen den Kaffee selbst zu verkaufen.
Das hat auch unsere Non-Profit-Organisation “Visioneers” vor, für die wir im Einsatz sind. Visioneers ist spendenfinanziert, hat 2021 die Kaffeeplantage hier gekauft und darauf die Finca gebaut. Die Vision: mit den hoffentlich bald aus dem Kaffee-Verkauf generierten Einnahmen unabhängiger von Spendengeldern sein und in soziale Projekte vor Ort fließen lassen. Dann soll z.B. ein Kindergarten für die Kinder der Kaffeepflücker:innen entstehen. Wir unterstützen Visioneers, indem wir Verpackungen und Etiketten für den Kaffee besorgen, die Kaffeemarke + Logo designen, die Finca via Instagram und YouTube bekannter machen, Kaffee-Zertifizierungen recherchieren, Benchmarking betreiben etc.
Wichtig zu sagen ist mir noch: Das Dorf San Andrés wirkt malerisch - auf den ersten und privilegierten Blick. Aber die Abgeschiedenheit kann auch zur Hölle werden, wenn du kein oder wenig Geld, kein Auto oder Führerschein hast. Dann bist du gefangen, hast keine Perspektive. Es gibt nicht genügend Arbeit für alle. Schwache Bildungsstrukturen tun ihr übriges. Und ein soziales Leben gibt es hier auch nicht, keine Vereine, keine Restaurants, Sportangebote o.ä. Das sollte man immer mitdenken.






3 notes
·
View notes
Text

Florentina Holzinger: A Divine Comedy
A Divine Comedy (2021) von Florentina Holzinger spielt, wie schon vorherige Stücke, mit Darstellungen von Geschlechtlichkeit, Körperlichkeit, Sexualität und Tabus. Auffallend bei dem Stück ist die Verwendung verschiedener technischer Geräte: ein Motorrad fährt regelmäßig über die Bühne, Autos hängen von der Decke, Dixi-Klos bewegen sich scheinbar eigenmächtig. Dieses Zusammenspiel von Mensch und Maschine erinnert an das Cyborg Manifest von Donna Haraway aus dem Jahr 1995.
Im Text „Ein Manifest für Cyborgs“ spricht Donna Haraway von einer utopischen und abstrakten Vorstellung von Geschlechtlichkeit. Ihre These: die Geschlechter können nur gleich werden, wenn sie auch wirklich gleich sind. Wenn nicht mehr Frauen Kinder gebären, sondern Maschinen. Sie spricht von der Figur des Cyborgs als geschlechtslose Identität, die die Grenzen zwischen Tier und Mensch, wie auch zwischen Mensch und Maschine überschreitet. Unsere Welt besteht aus Binären Dualismen: Frau/Mann, Mensch/Tier, Arm/Reich, POC/ weiß, Gut/ Schlecht. Der Cyborg, der eine Gleichzeitigkeit dieser Dualismen darstellt, verkörpert das Überschreiten dieser sozialen Normen und Grenzen. Haraway präsentiert die Figur des Cyborgs als eine feministische – eine Utopie, die die Grenzen einer patriarchalen und kapitalistischen Gesellschaft überschreiten kann und technokratische Machtstrukturen unterwandert.
Florentina Holzinger scheint in ihrem Stück A Divine Comedy ähnliches zu inszenieren. Holzinger arbeitet zunächst auch mit Dualismen: angezogen/nackt, Hypnotiseurin/ Hypnotisierte, Gut/Schlecht. Das Stück hinterfragt jedoch wiederholt starre Kategorien, wie die von sittenhaft/ unsittenhaft, weiblich/ nicht weiblich, Mensch/ Maschine, Mensch/ Tier, Himmel/ Hölle, und spiegelt somit auf eine Art Haraways Ansatz wider, gesellschaftliche Normen zu hinterfragen.
Auch das Abwenden von patriarchalen Vorstellungen von Schönheit, Weiblichkeit und geschlechtsspezifischen Dualismen spiegelt Haraways Vorstellung einer Figur, losgelöst von einem sozialen Geschlecht, wider. Die nackten weiblich gelesenen Personen in Holzingers Stück, brechen mit Vorstellungen von Weiblichkeit. Sie existieren nicht für einen männlichen Blick, sind sie doch autonom, unberechenbar, wild.
Es verschwimmen die Grenzen zwischen Mensch und Tier, durch die animalischen Darstellungen von Lust, Sex, Dreck, Defäkation, Blut, Kunst und Angst.
Zudem verschwinden die Grenzen zwischen Mensch und Maschine, aufgrund des wiederholten Auftauchens von Maschinerie. Es wirkt, als würde das Motorrad zwischen den Tänzer*innen tanzen, die Autos mit den Menschen von der Decke baumeln und das Dixie-Klo eine ebenfalls komödiantische Schauspielrolle haben. Die Axt ist eine maschinelle Verlängerung des menschlichen Arms. Der maschinelle Rollstuhl eine Ergänzung des Körpers, eine technologische Prothese. Auch der verwendete Dildo in der finalen Sexszene ist das Zusammenspiel von Mensch und Machine: es entsteht ein Hybrid, ein Cyborg, ein Zusammenspiel von Mann/Frau, Mensch/Tier und Mensch/Maschine.
Beide Arbeiten, „Ein Manifest für Cyborgs“, wie auch A Divine Comedy, arbeiten somit mit der Dekonstruktion von Geschlechtlichkeit und binären Dualismen, hin zu einer Befreiung von gesellschaftlichen Normen und Einschränkungen. Hin zu einer utopischen Vorstellung von Menschlichkeit, die diese Grenzen überschreitet und zu etwas neuem wird. Zu einem Hybrid, der aufgrund seiner Gleichzeitigkeit an Macht erlangt, der durch technische Prothesen Grenzen überwindet, der durch animalische Verhaltensweisen an Freiheit und Autonomie erlangt und als Cyborg patriarchale und kapitalistische Machtstrukturen hinterfragt und überwindet.
Quellen:
Holzinger, Florentina. A Divine Comedy. 2021.
Haraway, Donna. 1995. „Ein Manifest für Cyborgs“ in Die Neuerfindung der Natur: Primaten, Cyborgs und Frauen. Campus Verlag. Frankfurt/ New York. 1-18
0 notes
Text
Die physische und psychische Gewalt gegen Drogenkonsumenten und sozial benachteiligte Menschen (sogenannte „Sozialfälle“) ist in vielen Gesellschaften leider weit verbreitet – oft nicht direkt sichtbar, aber strukturell tief verankert. Hier sind die häufigsten Formen dieser Gewalt:
1. Physische Gewalt:
Polizeigewalt: Übergriffe bei Kontrollen, besonders bei wohnungslosen oder suchtkranken Personen. Racial Profiling und übermäßige Härte kommen oft dazu.
Gewalt im Drogenmilieu: Abhängige Menschen sind im illegalen Markt häufig Gewalt, Bedrohung oder Ausbeutung durch Dealer, andere Konsumenten oder Zuhälter ausgesetzt.
Gewalt in Heimen/Einrichtungen: In einigen Einrichtungen (z. B. Notunterkünften, „Therapiedörfern“) werden Bewohner durch Machtstrukturen, körperliche Übergriffe oder Zwangsmaßnahmen misshandelt.
2. Psychische Gewalt:
Stigmatisierung und Ausgrenzung: Betroffene werden gesellschaftlich oft als „Versager“, „asozial“ oder „selbst schuld“ abgestempelt. Das zerstört Selbstwert und Vertrauen.
Behördlicher Druck: Drohungen mit Leistungsentzug (z. B. ALG II), Zwang zur Therapie, Sanktionen bei „Fehlverhalten“ – oft ohne Verständnis für Lebensrealität oder psychische Lage.
Medizinische Vernachlässigung: Viele werden von der Regelversorgung ausgeschlossen oder nur oberflächlich behandelt, besonders wenn sie als „schwierig“ gelten.
Familienzerstörung: Entzug von Kindern durch Jugendämter unter oft zweifelhaften Vorwänden kann massives seelisches Leid verursachen.
Internalisierte Gewalt: Die gesellschaftliche Abwertung führt oft zu Selbsthass, Depressionen, Suizidgedanken oder -versuchen.
Diese Gewaltformen verstärken die Spirale aus Isolation, psychischer Belastung und Drogenkonsum oft noch – anstatt Lösungen zu ermöglichen.
Möchtest du Beispiele aus einem bestimmten Land, oder eher Lösungsideen für diesen Zustand?
0 notes
Video
youtube
Verrat auf höchster Ebene: Machtstrukturen und ihre verheerenden Auswirk...
In diesem fesselnden Teil der Serie „Verrat auf höchster Ebene“ beleuchten wir die verheerenden Auswirkungen von Machtstrukturen durch die Geschichte hindurch.
Von Holocaust und Stalinismus bis hin zu modernen Umerziehungslagern – wir zeigen, wie Machtmissbrauch zu unvorstellbarem Leid führt. Durch eindringliche historische Aufnahmen und berührende Erzählungen wird sichtbar, wie Korruption und Unterdrückung unser aller Menschlichkeit bedrohen.
Doch selbst in der Dunkelheit keimt Hoffnung auf, wenn wir gemeinsam für Wahrheit und Gerechtigkeit eintreten. Dieses Video fordert auf, Verantwortung zu übernehmen und eine bessere Zukunft zu gestalten. Bitte liked und teilt dieses Video, um das Bewusstsein für diese wichtigen Themen zu stärken.
#Verrat #Machtstrukturen #Gerechtigkeit
0 notes
Text
Aus tiefen Wunden
Manova: »Vieles lastet auf uns. Das Leben ist vielen Menschen schwer geworden, manchen zu schwer. Schicht um Schicht haben sich vergangene Geschichten — unsere eigenen und die unserer Vorfahren — in uns eingebrannt. Manche machen uns krank. Wie kommen wir durch das Gestrüpp, ohne uns immer wieder neu zu verletzen? Ist es möglich, das Schmerzgewand abzulegen? Die temporik-art Begleiterin Marina Stachowiak spricht mit Kerstin Chavent über sexuellen Kindesmissbrauch, patriarchale Machtstrukturen, ganzheitliches Bewusstsein und ihre eigens entwickelte Methode, die dabei helfen soll, einen Heilungsprozess anzustoßen und Selbstvertrauen und Lebenskraft zu stärken. http://dlvr.it/TKdc3m «
0 notes
Text

Eine Artikelserie zur Problematik des epistemologischen Relativismus in Wissenschaft und Gesellschaft, zuerst erschienen auf Science and Sense – Endruscheit bloggt Einleitung In den letzten Jahrzehnten haben sich Diskurse über Wahrheit, Wissen und Erkenntnis zunehmend polarisiert. Während klassische wissenschaftliche Methoden auf objektive Überprüfbarkeit setzen, haben Strömungen aus der postmodernen Philosophie und den Cultural Studies Konzepte entwickelt, die objektive Wahrheit als Konstrukt hinterfragen. Dieser erkenntnistheoretische Relativismus hat nicht nur den akademischen Diskurs beeinflusst, sondern auch politische Debatten, Medien und den gesellschaftlichen Umgang mit Wissenschaft geprägt. Was zunächst als berechtigter Reflex auf wissenschaftlichen Dogmatismus und Machtstrukturen begann, hat sich in manchen Bereichen zu einer Herausforderung für den wissenschaftlichen Diskurs selbst entwickelt: Wenn alle Wahrheiten als gleichwertige Narrative gelten, verliert Wissenschaft ihre normative Kraft. Doch ist dieser Vorwurf gerechtfertigt? Haben Philosophen wie Kuhn, Foucault oder Derrida tatsächlich eine radikal relativistische Position vertreten – oder wurden sie vereinnahmt? Diesen Fragen soll eine kleine Artikelserie nachgehen, deren erster Teil dieser Beitrag ist. Kritischer Rationalismus vs. Relativismus: Zwei gegensätzliche Erkenntnishaltungen Die Frage, wie wir zu Wissen gelangen, ist eine der grundlegendsten philosophischen Debatten. Zwei einflussreiche Positionen, die sich hierbei gegenüberstehen, sind der kritische Rationalismus und relativistische Erkenntnistheorien. Der kritische Rationalismus, geprägt durch Karl Popper, geht davon aus, dass Wissen immer vorläufig ist und sich nur durch kritische Prüfung und Falsifikation weiterentwickeln kann. Anstatt nach absoluter Gewissheit zu streben, setzt er auf einen offenen Diskurs, in dem Theorien so lange als brauchbar gelten, bis sie widerlegt werden. Wahrheit bleibt ein regulatives Ideal, das wir bestenfalls annähern, aber nie endgültig erreichen können (jedenfalls nicht erkennen können, sollten wir sie zufällig einmal wirklich getroffen haben). Zentraler Grundgedanke ist der Fallibilismus, also der Grundsatz, dass wir uns jederzeit und immer irren können. Demgegenüber stehen relativistische Ansätze, die den Wahrheitsbegriff entweder aufweichen oder gar ablehnen. In ihrer radikalsten Form argumentieren sie, dass Wissen nicht objektiv, sondern immer nur innerhalb eines bestimmten sozialen, kulturellen oder sprachlichen Kontextes gültig sei. Wissenschaftliche Theorien hätten demnach keinen höheren Anspruch auf Wahrheit als andere Weltbilder – sie seien lediglich Produkte ihrer Zeit, geprägt von Machtstrukturen und gesellschaftlichen Konventionen. Diese Gegenüberstellung ist keineswegs nur ein akademischer Disput, sondern hat weitreichende Folgen. Der kritische Rationalismus ermöglicht eine robuste wissenschaftliche Methodik, die sich durch Selbstkorrektur und Fortschritt auszeichnet. Der Relativismus hingegen läuft Gefahr, wissenschaftliche Erkenntnisse zu entwerten, indem er sie als bloße Narrative behandelt, die neben Mythen oder Ideologien stehen. In einer Zeit, in der Verschwörungstheorien und Wissenschaftsleugnung florieren, ist diese Debatte aktueller denn je. Relativismus – ein verkappter Anthropozentrismus? Ist die epistemologische Leugnung der Existenz objektiven Wissens nicht eine Art Anthropozentrismus? Will sagen, der Relativismus reduziert doch den Wahrheitsbegriff auf Ausflüsse menschlichen Handelns. Objektive Kritierien scheinen also nicht einmal lohnend, ihnen nachzuspüren. Im Grunde machen die Relativisten es sich doch einfach … Das ist ein zentraler Kritikpunkt am epistemischen Relativismus: Er setzt Wahrheit mit menschlichen Perspektiven gleich und verneint, dass es sinnvolle Maßstäbe gibt, die außerhalb unserer sozialen und kulturellen Konstruktionen existieren. Das ist im Kern eine Art Anthropozentrismus – denn es läuft darauf hinaus, dass Wissen und Wahrheit letztlich nur das sind, was Menschen in ihren jeweiligen Kontexten dafür halten. Der kritische Rationalismus geht dagegen davon aus, dass es eine von unseren Meinungen unabhängige Realität gibt, die wir zwar nie vollständig erkennen, aber immer besser verstehen können. Relativisten argumentieren oft, dass jede Erkenntnis immer in Sprache und Kultur eingebettet ist und daher keine übergreifende Objektivität beanspruchen kann. Doch gerade hier machen sie es sich zu einfach: Sie übersehen, dass die bloße Tatsache, dass wir über die Welt nur in menschlichen Begriffen sprechen können, nicht bedeutet, dass es nichts außerhalb dieser Begriffe gibt. In gewisser Weise könnte man den Relativismus als bequem bezeichnen, weil er den anstrengenden Prozess wissenschaftlicher Falsifikation und methodischer Prüfung unterläuft. Wenn jede Perspektive „ihre eigene Wahrheit“ hat, dann entfällt die Notwendigkeit, sich mit widersprechenden Fakten oder mit methodischer Strenge auseinanderzusetzen. Stattdessen kann jede Behauptung als „kulturell valide“ verteidigt werden – egal, wie gut oder schlecht sie sich mit der Realität verträgt. Ein schönes Paradoxon ist übrigens, dass der radikale Relativismus sich oft selbst widerlegt: Wenn es keine objektive Wahrheit gibt, dann gilt das auch für die Behauptung, dass es keine objektive Wahrheit gibt. In diesem Sinne ist der Relativismus nicht nur bequem, sondern auch inkonsistent. Die psychologische Komponente Es scheint tatsächlich eine psychologische Komponente zu geben, ob jemand eher zum kritischen Rationalismus oder zum Relativismus neigt. Der Relativismus kann für viele Menschen attraktiv sein, weil er vermeintlich „menschlicher“ wirkt – er erlaubt subjektive Erfahrungen, kulturelle Kontexte und emotionale Perspektiven als gleichwertig anzuerkennen, ohne sie an einem übergeordneten Maßstab messen zu müssen. Das kann entlastend sein, weil es den Druck nimmt, sich mit unbequemen Wahrheiten oder methodischer Strenge auseinanderzusetzen. Viele, die sich vom kritischen Rationalismus abwenden, dürften weniger an dessen methodischen oder logischen Prinzipien scheitern, sondern eher an der psychologischen Belastung, die mit ihm einhergeht. Denn es ist ja durchaus anstrengend, sich auf den schmalen Grat des methodischen Skeptizismus zu begeben, wo man einerseits nichts unkritisch akzeptieren darf, andererseits aber auch nicht in ein völliges Agnostizismus-Chaos abdriften kann. Kritischer Rationalismus verlangt eine Art „intellektuelle Disziplin“, die sich nicht auf Bequemlichkeiten stützt – keine absoluten Wahrheiten, aber auch kein hemmungsloses „anything goes“. Doch genau da sehe ich eine Parallele zum alten Anthropozentrismus: Früher sah sich der Mensch als Mittelpunkt des Kosmos, heute setzt der Relativismus ihn zum Mittelpunkt der Erkenntnis. Alles, was wir wissen können, wird auf menschliche Perspektiven, Narrative oder Machtstrukturen reduziert. Der kritische Rationalismus geht hingegen davon aus, dass es eine Realität gibt, die unabhängig von unseren Wünschen, Gefühlen oder kulturellen Kontexten existiert. Und das wirkt auf viele abschreckend – eben weil es „kalt und leer“ erscheinen kann, insbesondere im Vergleich zu einer Sichtweise, die Wissen als soziale Konstruktion begreift und damit „wärmer“ und flexibler erscheint. Aber genau hier liegt die Gefahr: Der Relativismus mag tröstlich wirken, doch er untergräbt die Möglichkeit, überhaupt noch zwischen besseren und schlechteren Erkenntnissen zu unterscheiden. Wenn Wissenschaft nur eine „Erzählung“ unter vielen ist, dann gibt es keinen methodischen Grund mehr, ihr gegenüber Verschwörungstheorien oder Pseudowissenschaften den Vorrang zu geben. Insofern könnte man sagen, dass Relativismus eine bequeme, aber letztlich intellektuell träge Position ist – eine moderne Variante der alten menschlichen Neigung, sich selbst ins Zentrum zu stellen, statt sich der unbequemen Möglichkeit zu stellen, dass Wahrheit eben nicht von uns abhängt. Kritischer Rationalismus und Skeptizismus Gleich hier werde ich keinen Hehl daraus machen, dass ich den kritischen Rationalismus als unabdingbare Grundlage eines sinnvollen, realitätsbezogenen und kritischen Skeptizismus ansehe. Ernsthaft betriebene skeptische Aufklärung setzt voraus, sich seiner epistemologischen Grundlagen sicher zu sein. Wie sonst könnte man einer pseudowissenschaftlichen Szene standhalten, die zunehmend selbst epistemologisch argumentiert? Gerade weil Pseudowissenschaftler immer geschickter epistemologisch argumentieren, kann man sich als Skeptiker nicht einfach darauf zurückziehen, dass „wir es doch besser wissen“. Wenn man den Relativisten und Pseudowissenschaftlern das epistemologische Feld überlässt, dann läuft man Gefahr, nur noch auf Symptome zu reagieren, anstatt die eigentlichen Denkfehler zu entlarven. Das ist, als würde man in einer Debatte über Klimawandel die physikalischen Grundlagen ausblenden und sich nur auf Einzelstudien und Messdaten stützen – ohne eine solide methodologische Basis ist man angreifbar. Oder wie bei den Homöopathen, die immer wieder versuchen, Belege für ihre Scheinmethode anzuführen, ohne deren methodologische Grundlagen kritisch zu betrachten und dabei stets versuchen, den Blick auf eine gesamtwissenschaftliche Betrachtung zu verschleiern. Ganz abgesehen von gelegentlichen Ausflügen in das Reich des epistemologischen Relativismus. Der Erfolg des Postmodernismus zeigt doch genau das Problem: Viele Relativisten sind keine Dummköpfe, sondern sehr versiert in philosophischen Argumentationen. Wer sich dem nicht stellt, wird irgendwann rhetorisch an die Wand gespielt – und genau das passiert ja leider in der öffentlichen Debatte immer wieder. Deshalb diese kleine Artikelserie in loser Folge, die sich mit dem Antagonismus zwischen Rationalismus und Relativismus auseinandersetzen will. https://humanismus.at/erkenntnisrelativismus-0/ Read the full article
0 notes
Text

Klappentext: »Sex and the City« meets »The Great Gatsby« - das vergessene Meisterwerk aus den 1920ern von Ursula Parrott Patricia ist 24 Jahre alt, als ihr Mann sie verlässt. Vor den Kopf gestoßen versucht sie zunächst, um ihn zu kämpfen. Aber sie merkt schnell: Sie will - und vor allem kann - auch ohne Peter leben. Das New York der 1920er ist eine flirrende Metropole und Patricia stürzt sich in die Party-Szene: Zwischen Freundschaften, Affären, aber auch schmerzhaften Schicksalsschlägen, erlebt sie, welche Konsequenzen es hat, mit dem typischen Frauenbild zu brechen. »Wilde Skandale, misogyne Machtstrukturen und eine vergessene Starautorin: Dieses Buch hat ein fulminantes Comeback verdient.« Mareike Fallwickl »Umwerfend aktuell!« The Guardian »Ein bewegendes, witziges und manchmal beunruhigendes Porträt einer Frau, die schockiert ist über das Ende einer Beziehung, von der sie dachte, sie würde ewig dauern. Beim Lesen war ich erstaunt über die Ähnlichkeit unserer Erfahrungen, trotz der fast 100 Jahre, die zwischen Patricias und meiner Scheidung liegen.« Monica Heisey, The Guardian Rezension: Das mit den vergessenen Klassikern ist immer so eine Sache. Zum einen reizen sie mich, zum anderen habe ich auch Angst vor der Sprache in den Büchern. Als ich dann das Buch began, fing mich die Sprache von Ursula Parrott sehr schnell ein. Man lernt Patricia kennen, eine 24 Jahre alte Frau, die mit ihrer großen Liebe Peter verheiratet ist. Peter arbeitet als Journalist bei einer Zeitung und sie führen eine mehr oder weniger offene Ehe. Beide sind sehr attraktiv, trinken sehr gerne Alkohol und treiben sich gerne in den Flüsterkneipen in New York herum. Er geht dann auch fremd und kurze Zeit später geht auch Patricia mit dem besten Freund von Peter ins Bett. Anstatt aber seiner Frau auch zu vergeben, verstrickt sie sich auch in Lügen und sagt sie hat mit mehreren Männern Sex gehabt, nur um ihm nicht zu sagen, dass sie mit seinem besten Freund, Sex hatte. Eine sehr verklemmte Freundin von Patricia zieht bei ihnen ein und Peter verliebt sich immer mehr in diese Freundin, da sie in seinen Augen treu ist. So trennen sich die beiden relativ schnell. Aber Scheidung kommt für beide so nicht infrage. Sie wohnen in getrennten Wohnungen. Patricia zieht zu einer Freundin und macht Kariere als Werbetexterin. Ich erlebte ab da eine ganz andere Patricia, die sich noch mehr auf ihr äußeres Konzentrierte und von einem Mann zum nächsten ging. Sie war ständig am feiern und ich habe so ein Verhalten auch an mir früher sehr oft bemerkt. Wenn eine Beziehung in die Brüche ging, bin auch ich gerne von einer Frau zur nächsten gewandert. Es ist nicht erfüllend. Genau so wie bei Patricia war es auch bei mir. Wobei sie sich auf One-Night-Stands konzentrierte, die ich nie gut fand und noch immer nicht finde. Aber ansonsten waren da einige Parallelen, welche ich auch in der heutigen Zeit sehr oft sehe und erlebe. Es war das nach außen hin schön sein, dieses auf Hochglanz poliert sein. Bloß keine schwäche zeigen und immer sauber und elegant und am besten in Designerkleidung erscheinen. Man erlebt dieses mehr Schein als Sein. Es wird geflirtet auf Teufel komm raus. Auf der anderen Seite, hat aber Patricia sehr viele Schicksalsschläge zu verarbeiten. Da ist der Verlust eines Kindes von ihr und Peter und die Abtreibung eines weiteren Kindes, da Peter sich kein Kind mehr mit Patricia wünscht, und er sich aufgrund ihrer Lügen nicht sicher ist, dass er auch wirklich der Vater des Kindes ist. Ich erlebte, wie die Liebe zwischen den beiden abkühlte und Peter doch nur eine Wunschvorstellung ist. Lucia, bei der Patricia unterkommt, wird immer mehr zur wichtigen Freundin, die auch eine Ex-Frau ist und genau weiß, wie sich Patricia fühlt und was sie braucht. Dass sich Patricia auch wieder verliebt, ist einfach schön zu lesen. Wobei mir persönlich die Liebesbriefe zwischen ihr und ihrem neuen Freund Noel, der auch noch verheiratet ist, teilweise doch etwas zu schwulstig waren. Es war teilweise zu viel, zu dick aufgetragen. Eines fragte ich mich bei dem Buch immer wieder: Warum ist dieses Buch denn vergessen worden? Wie kann man ein solches Buch nicht mehr verlegen? Ja, es war mir teilweise zu viel, wie beschrieben wurde, was sie an dem Tag anhatte und was es mit ihr gemacht hat und warum sie gerade dies angezogen hatte. Dies sind vielleicht Erklärungen, die man nicht immer so lesen möchte. Ansonsten ist es aber ein Roman, der alles hat: Gesellschaftskritik, Liebe, Tragödie und einen ungeschönten Blick auf ein Land, in dem Frauen nach Gleichberechtigung streben, aber gleichzeitig nach der Ehe und dem perfekten Mann suchen, da sie nicht mit dem gesellschaftlichen Stigma einer Ex-Frau leben möchten. Was mir Angst macht ist, dass man vieles heute noch genauso macht wie vor hundert Jahren. Ich befürchte, dass manche Menschen das Rad wieder zurückdrehen möchten auf das, was in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts war – oder noch weiter zurück. Lasst uns Autorinnen wie Ursula Parrott nicht vergessen, denn sie haben viel zu erzählen und dies auf eine ganz besondere und warmherzige Art und Weise. Titel: Ex-WifeAutor/In: Parrott, UrsulaÜbersetzer/In: Engel, TildaISBN: 978-3-949465-28-4Verlag: S. Fischer VerlagPreis: 24,00€Erscheinungsdatum: 24. Juli 2024 Bei unseren Partnern bestellen: Bei Yourbook.shop bestellen. Bei Genialokal.de bestellen. Bei Buch24.de bestellen. Bei Thalia.de bestellen. Die Buchhandlung Freiheitsplatz.de unterstützen! Die Büchergilde FFM unterstützen! Read the full article
0 notes
Text
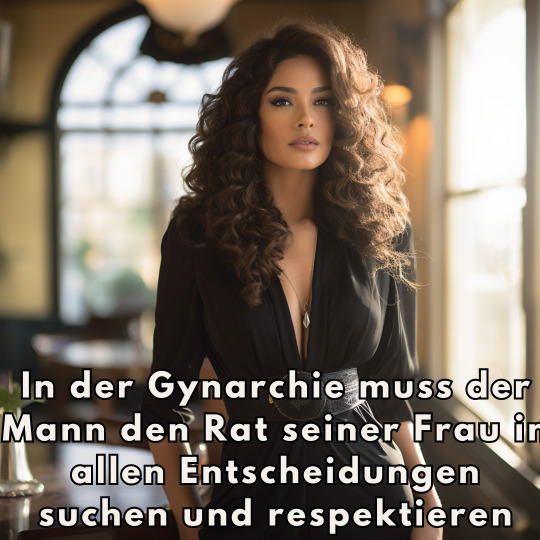
Im Herzen der Gynarchie: Die Heiligkeit des Rats einer Ehefrau
In der Welt der Gynarchie, in der Frauen als Führungspersonen und Entscheidungsträgerinnen verehrt werden, verwandeln sich Beziehungen in mächtige Partnerschaften, die die Werte und Normen der Gesellschaft widerspiegeln. Im Zentrum dieses Systems steht die Anerkennung der entscheidenden Rolle, die Frauen bei der Lenkung, Pflege und Ausrichtung von familiären, gesellschaftlichen und persönlichen Angelegenheiten spielen. In der Heiligkeit der Ehe wird es von größter Bedeutung, dass der Mann, in diesem System erzogen, den Rat seiner Frau in allen Entscheidungen sucht und respektiert.
Die Philosophie der Gynarchie zielt nicht nur darauf ab, traditionelle Machtstrukturen umzukehren, sondern eine Umgebung zu schaffen, die die weibliche Weisheit, Intuition und Einsicht wirklich würdigt. Männer, die in einer solchen Umgebung aufwachsen, lernen von klein auf den Wert weiblicher Einsicht zu schätzen. Sie werden nicht als minderwertig angesehen, sondern sind vielmehr dazu angehalten zu erkennen, dass die Integration der Perspektive ihrer Frau ihre Entscheidungen nur bereichern kann.
In den privaten Räumen der Häuser ist es üblich, dass Männer sich an ihre Frauen wenden, nicht aus Verpflichtung, sondern aus echter Ehrfurcht vor ihrer Weisheit. Sei es bei finanziellen Entscheidungen, moralischen Dilemmata oder alltäglichen Entscheidungen, die Stimme der Frau wird zu einem wertvollen Kompass. Dieser gegenseitige Respekt stellt sicher, dass Entscheidungen gut durchdacht und umfassend sind und trägt zu einem harmonischeren und effektiveren Haushalt bei.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Mann passiv wird oder seine eigene Stimme verliert. Vielmehr erkennt er in einem gynarchischen Kontext die Stärken, die beide Partner einbringen. Er versteht, dass er, indem er den Rat seiner Frau sucht, kollektive Weisheit zusammenbringt und sicherstellt, dass die getroffenen Entscheidungen im besten Interesse aller Beteiligten sind.
Darüber hinaus verändert ein solcher Ansatz das eigentliche Gefüge der Beziehung. Sie wird zu einer Partnerschaft, die auf gegenseitigem Respekt, Verständnis und dem Wunsch basiert, ein harmonisches Leben zu gestalten. Machtspiele werden überflüssig, ersetzt durch das tiefe Verständnis, dass die weibliche Perspektive von unschätzbarem Wert ist.
Zusammenfassend kann man sagen, dass eine gynarchische Gesellschaft nicht nur eine Umkehrung der Geschlechterrollen ist, sondern eine Feier der weiblichen Weisheit. Sie nährt die Überzeugung, dass in der Vereinigung der Geister die Entscheidungen, die nach dem Rat einer Ehefrau getroffen werden, am ausgewogensten und fruchtbarsten sind. Es ist ein Zeugnis für die Kraft der Zusammenarbeit, des Verständnisses und des gegenseitigen Respekts.
20 notes
·
View notes
Text
1. Neudefinition der Leere
Anstatt „leere“ als Vakuum zu verstehen, kannst du sie als Feld ungenutzter Möglichkeiten deuten:
• Metapher: Ein unendlicher Ozean, in dem jede Welle eine ungeschriebene Möglichkeit trägt.
• Erzählansatz: Ferdinand sitzt am Rand eines kammergroßen Wasserbeckens (denn Wasser spielt ja eine zentrale Rolle) und starrt in die stille Oberfläche. Er spürt, dass das Universum „leer“ erscheint, doch je länger er hinabsieht, desto mehr glitzern winzige Lichtpunkte an der Wasseroberfläche – Erinnerungen, Träume, ungelebte Leben.
⸻
2. Kämpfen versus Träumen
Statt äußeren Widerstand zu leisten („Kämpfen“), könnte dein Held lernen, dass träumen selbst eine aktive Kraft ist:
• Innerer Wandel: Nicht der Fausthandschuh, sondern die Vision eines neuen Himmelszelts über der Wohnung entzündet den Neubeginn.
• Szene: Anja flüstert Ferdinand zu: „Nicht jede Schlacht gewinnt man mit dem Schwert. Manchmal genügt eine einzige Idee, um Berge zu versetzen.“ In diesem Moment bricht ein Schimmergrün („Schimmer“) durchs Fenster – ein Omen neuer Muster (Tglexion).
⸻
3. Dramaturgischer Einsatz
1. Konflikt: Ferdinand hadert damit, dass all sein Kämpfen gegen die steinernen Fassaden der Stadt nichts ändert.
2. Schlüsselerlebnis: Er träumt von einem Himmelszelt, das die Hauswände durchdringt und alles in eine andere Farbe taucht.
3. Wendepunkt: Er erkennt: Wer kämpft, bindet Energie an das Problem; wer träumt, lenkt Energie in die Lösung.
⸻
4. Philosophische Tiefe
• Leere als kreative Leere: Ein unbeschriebenes Blatt.
• Kampf als Illusion: Wer gegen Sturmböen anrennt, ignoriert, dass er den Wind auch für sich nutzen könnte.
• Träumen als Widerstand: Im Traum erschafft man Welten, in denen alte Machtstrukturen keine Rolle spielen.
⸻
5. Konkrete Szene für dein Manuskript
Ferdinand sitzt im Fünambulus-Haus (dem Feldsteingebäude mit seinem Himmelszelt).
Der Mond spiegelt sich in den sanft schwingenden Stoffbahnen.
Er flüstert: „Das Universum ist leer, weil Kämpfen wenig bringt.“
Die Frau mit dem orangefarbenen Schal tritt neben ihn: „Vielleicht ist es leer, weil wir vergessen haben, es mit unseren Träumen zu füllen.“
Ein Windstoß zieht durch das Zelt – und plötzlich spricht das Tuch zu ihm: „Erträume mich.“
0 notes