#[es sollte mich gewesen].wilhelm
Explore tagged Tumblr posts
Text
since district partner discussions are going around. OH BOY LET ME INTRODUCE YOU TO WILHELM.
wilhelm was a few months older than katrina, and the second child of 4 siblings - his sisters' names are irena, lucja, & sabina. his family was tight-knit, and he and his sisters were very close. their home was warm, full of laughter. he and his eldest sister, lucja, were always very protective of the younger two, and would regularly put their names in for more tesserae instead of irena & sabina's. any of the siblings would have volunteered for each other in a second if they were able - but he couldn't have volunteered for any of them, and when it came down to it, they had to stand and watch as his name was called. he was full of hope, of light. he was gentle. it confused katrina, at first - why is he being so nice? what's his angle? how is he benefitting from this strategy? it took her almost the full week to realize it wasn't a strategy. at the beginning of the games, she was torn. finding him in the arena would give her an ally, but if he was going to die, she didn't want to see it. if it came down to it, she didn't know if she could be the one to do it. they ran into each other on the third day, and stuck together after that. when she injured her hands, he sat with her and tried to clean them up, wrapping them in strips of fabric they ripped from what supplies they had managed to gather. he died on day 6. she saw it all. when she returned to 7, she almost broke down seeing his family at the station. seeing the looks on his sisters' faces. knowing he could have been coming back instead.
in every verse that katrina and wilhelm meet, he is always one of the kindest people she's ever met, and gives her an example of truly good people existing even in the darkest period of her life. and he always dies in front of her.
#i think about wilhelm so much he is baby. baby boy. baby.#and he makes me SO SAD. in EVERY VERSE#‘ was sind die chancen ‘ - hunger games verse.#‘ es sollte mich gewesen ‘ - wilhelm.#death tw
4 notes
·
View notes
Text

An- und Ungehörigkeiten
1.
Kunst und Wissenschaft sind frei. Tschühüss, wir sind dann mal hin und weg.
Autoren sagen, die Autoren dieses Satzes aus Art. 5 III GG seien erschrocken gewesen. Da wären sie nicht alleine gewesen, Leser erschrecken auch an der Lektüre dieses Satzes. Hilft nichts: man braucht von jedem Recht mindestens zwei Versionen, auch von einem Grundrecht mindestens zwei Versionen, von mir aus eine, die man als subjektives Recht zu fassen versucht und eine, die man, wie einmal Helmut Ridder das mit einer Kombination aus öst-westlichen Besessenheiten vorschlug, als kollektiv-institutionelle Dimension zu fassen versucht. Bekommt man sein Recht nicht hier, dann da. Ist man hier nicht frei, dann da; ist man jetzt nicht frei, dann dann. Mit dieser doppelten und geteilten Sicht kann man noch im Gefängnis seine Freiheit wahren, sonst platzt der Wahn. Sich in rechtlichen Fragen auf das Recht zu verlassen, das ist ungefähr so, als würde man sich verlassen, also ausziehen, nur: wohin?
Sich in rechtlichen Fragen auf das Recht zu verlassen, sich zu verlassen und auszuziehen: dazu kann es Sinn machen, das Ziel des Auszugs (Exit? Exil?) festzustellen. Man kommt aber nicht drum herum, von hier nach da gehen. Sich in rechtlichen Fragen auf das Recht zu verlassen, sich zu trauen, sich zu verlassen und damit auszuziehen: das ist auch möglich, ohne das Ziel des Auszugs festzustellen. Was nicht hier stattfindet, findet da statt. Man sollte sich in rechtlichen Fragen auf das Recht verlassen, sich also verlassen und ausziehen - dabei von Anfang an mit melancholischem Kurs rechnen und stoisch seine Widerständigkeit und Insistenz trainieren. Man soll sich trauen und wagen. Ein Leben ohne Trauschein, das kann doch gar nicht wahr sein (Peter Toms). Keine einfache Angelegenheit. Alt werden sei nichts für Feiglinge, so hat Mae West die literarisch-juridische Gattung De senectute auf den Punkt gepracht. Derweil alterte die Alterität weiter.
2.
Ghassan Hages Schriften verfolge ich seit kurzem. Wer wenn nicht ich, ist Max-Planck-Gesellschaft? Im Schaufenster der Max-Planck-Gesellschaft hat jemand das so beschrieben:
Die Max-Planck-Gesellschaft ist Deutschlands erfolgreichste Forschungsorganisation – mit 31 Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträgern steht sie auf Augenhöhe mit den weltweit besten und angesehensten Forschungsinstitutionen. Die mehr als 15.000 Publikationen jedes Jahr in international renommierten Fachzeitschriften sind Beleg für die hervorragende Forschungsarbeit an Max-Planck-Instituten (...) Worauf gründen sich diese Erfolge? Die wissenschaftliche Attraktivität der Max-Planck-Gesellschaft basiert auf ihrem Forschungsverständnis: Max-Planck-Institute entstehen nur um weltweit führende Spitzenforscherinnen und -forscher herum. Diese bestimmen ihre Themen selbst, sie erhalten beste Arbeitsbedingungen und haben freie Hand bei der Auswahl ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dies ist der Kern des seit mehr als 100 Jahren erfolgreichen Harnack-Prinzips, das auf den ersten Präsidenten der 1911 gegründeten Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, Adolf von Harnack, zurückgeht. Mit diesem Strukturprinzip der persönlichkeitszentrierten Forschungsorganisation setzt die Max-Planck-Gesellschaft bis heute die Tradition ihrer Vorgängerinstitution fort.1948 wurde sie aus den Trümmern der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in Göttingen mit dem Auftrag der Grundlagenforschung gegründet.
Stolz kann ich da nur sein, wenn ich mir einflüstere: Wer, wenn nicht ich, ist Max-Planck-Gesellschaft? Das ist persönlichkeitszentriert: man nimmt in einer privaten Praxis öffentlicher Dinge das Republizieren persönlich. Das ist eine individuelle Lesart. Mit demjenigen, von dem ich da spreche und über den ich da lüge meine ich mich, ich soll ich sein, kein anderer! Wer, wenn nicht ich, ist Max-Planck? Ich spreche, ich lüge: auch der Einwand wäre nicht so ohne weiteres von der Hand zu weisen, dass Steinhauer wahnsinnig geworden sei, sich mal wieder (wie schon in Derrida, Luhmann, Steinhauer) auf falscher Augenhöhe mit sich selbst verorten würde, mal wieder die Wissenschaft zu persönlich nehmen würde und die kollektiv-institutionelle Dimension nicht mit beiden Händen mit präzisem Händeerschütteln im Griff hätte. Die kollektiv-institutionelle Dimension eines Grundrechtes und seine individuelle Dimension liefern viel, unter anderem auch Stoff für viel Schwank.
3.
Ghassan Hage arbeitet in einem Bereich, in dem ich auch arbeite. Er arbeitet im Bereich des Verschlingens und Verschlungenen. Dass er sich auf twitter anthroprofhage nennt und ich am MPI für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie zur Theophagie, Anthropophagie, zu Sarkophagen, vaguen Assoziationen und demjenigen forsche, was Bing einmal das Verzehren des Gottes genannt hat, mag unterschiedliche Gründe und Kontexte haben. Hage und mein Interesse treffen sich aber an Grenzobjekten. Hages Fall, er selbst - ist jetzt auch so ein Grenzobjekt; mich selbst kann ich als ein solche Grenzobjekt betrachten.
Hages und mein Interesse treffen sich an Fragen nach der Norm - als einer symbolischen und imaginären Stelle, durch die Differenzen operationalisierbar werden und damit bar jeder Operation und Bar jeder Operation erscheinen können, dank eines und durch einen Trakt(es) oder Zug(es), dank eines Limits und durch ein Limit, dank eines Kanals und durch einen Kanal. Durch Normen können Konflikte ausgetragen werden (so, wie man auch Zeitungen austrägt). Mit Normen lässt sich die Welt händeln oder bestreiten, wie man Aufgaben und Aussagen bestreitet. Es gibt Wissenschaftler, die kennen die Forschung von Hage oder mir nicht, müssen sie auch nicht. Es gibt Laien, die kennen sie nicht, müssen sie auch nicht. Anders herum gibt es Wissenschaftler, die die Forschung kennen und Laien, die die Forschung nicht kennen müssen, weil ihnen auch ohne wissenschaftliche Fassung die damit verbundenen Konflikte, Widerständigkeiten und Insistenzen vertraut sind. In Nachtlokalen trifft man Leute, die mehr über den Gegenstand meiner Forschung kennen als ich, obwohl ich doch zu Bars und Polarität forsche. Auf witzige Weise freuen sich meine Objekte manchmal darüber, dass andere damit Geld verdienen können, zu wissen was sie wissen. Manchmal sind sie neidisch und machen den Ärger. Der Kontext bei Hage hat mit der Anthropologie und seinem Interesse an Imagination und Radikalität zu tun, einer Radikalität, die ich frei so übersetze: Gründlichkeit oder Verwurzelung. Bei mir hat das Interesse mit den Forschung zu einer Bild- und Rechtswissenschaft zu tun, die am Recht nicht dasjenige sucht, was dort ausdifferenziert, systematisch, stabil oder stabilisierend sein soll, sondern dasjenige, was unbeständig (durch wechselnden und austauschbaren Bestand), meteorologisch und polar sein soll.
4.
Hage war von einem Augenblick zum anderen nicht mehr Gast und die Max-Planck-Gesellschaft nicht mehr Gastgeber (für solche Augenblicke sorgen Juristen, die bereiten dann das Ende juristisch vor, sogar noch die Pressemeldungen dazu entstehen mit juristischer Unterstützung, weil die Gesellschaft, jede Gesellschaft, alles richtig und nichts falsch machen will).
Seitdem lese ich viel von Hage. Das geht mit Unbehagen einher, der Hage behagt nicht. Er schreibt, was ich nicht lesen will. Der Westen, die Regierung, die Industrie, der Krieg, die Israelis, die Palästinenser: Der stochert im Summenloch aller derjenigen, die, wie ich, in ihrer Kindheit auf den Einen und das Eine, etwa den Gott, die Wahrheit und das Gesetz konditioniert wurden. Was denn für ein Summenloch? Im Summencumexall. HÄ? Na im Animierenden, Alarmierenden und Animalischen aller derjenigen, die eine große Alphareferenz hinter sich wissen wollen, das Beste wollen und dann mit doppelten Rittberger im Bodensatz der Gründe landen.
Der stochert in den Geschichten meines Kommunionsunterrichtes und in den Erinnerungen an die apokalyptischen Donnerstage, an denen wir auf unserer Schule (dem erzbischöflichen Gymnasium St. Anna) morgens zur Messe gehen sollten, bevor es dann in der zweiten Stunde mit Mathematik oder Geschichte weiter ging. Wo ich jetzt sehe, dass sich mal wieder großer Mist aufhäuft, bin ich darauf konditioniert, dass es in dem Streit zwischen Hage und der Gesellschaft eine gute Seite und eine böse Seite gibt und dass ich einer dieser Seiten angehöre. Weiter noch: bin darauf konditioniert zu denken, in dem Streit gebe es Angehörige und solche, die ungehörig seien. Noch bevor ein Wort zuende gelesen ist, macht etwas in mir schon Ah! und Oh!, noch bevor ich fort oder da sagen kann. Also etwa so bin ich konditioniert: ich gehörte der Gesellschaft an, aber nicht dem Hage, der Hage gehöre der Gesellschaft nicht an. Manchmal ist es anderes herum, das glaube ich, ich sei der einzige Außenseiter und alle anderen seien drin und fest dabei. Das ist alles schon Dogma und Schize oben drauf, schon da beginnt der Wahn desjenigen aufsitzenden Wesens, das von Natur aus phantasiebegabt ist und auch mit Illusionen eine Zukunft hat.
Schon an den Stellen beginnen die Fragen, die Ute Holl in ihrer Arbeit zu juridischen Kulturtechniken in dem Buch der Mose-Komplex stellt, schon da beginnen die Fragen, die Aby Warburg auf seinen Staatstafeln stellt oder die Fragen, die Pierre Legendre in seinem Werk stellt. Hage macht mich mit seinen Sätzen wütend, seine Sätze wüten mir. In Bezug auf den Gazakonflikt, der ein Konflikt um unsere (!) Radikalität, unsere Gründlichkeit, unser launisches Verwurzeln ist und in dem wir nur das haben, was zwischen uns steht, bin ich, wie in dem Konflikt um die Ukraine, fröhlich pessimistisch oder aber, wie Brock sagt, auf apokalyptische Weise optimistisch. Warum? Weil ich das übe. Ich trainiere, Züge machen zu können, auch für Fälle, die näher rücken können. Aus der Hoffnungslosigkeit springt der Vorschlag heraus, einmal denen zu begegen, die in dem Konflikt eine Widerständigkeit und Insistenz jenseits der Gründlichkeit, jenseits der Radikalität suchen. Teresa Cabita hat dazu gestern Abend am chinesischen Tisch (dem Polobjekt) den Begriff der Maskerade ins Spiel gebracht, man kann auch das Theater denken. Cabita hat den Eindruck, dass in dem Konflikt um Hage Maskeraden aufgefahren werden (unter anderem von mir würden die aufgefahren, was ich nicht zurückweisen will, Masken mit phobischen Stellen will ich fassbar machen). Man kann versuchen, den Konflikt zu demaskieren (ich würde das nicht versuchen) : ich rechne damit, dass man nach der Maskerade in jenes Summenloch starrt, das für das Animierende, Alarmierende und Animalische verkehrender Wesen einstehen soll und das manche darum gern den Kern der Sache, den Grund, den Anfang, die Seele nennen.
Hage ist nicht the bad guy in diesem Konflikt, auch nicht the good guy. Akademische Freiheit ist auch nicht gerade paradiesisch, auch sie kann für Schurkenstücke verwendet werden. Die Max-Planck-Gesellschaft ist hier nicht the bad guy, nicht the good guy. Es kann sein, dass die Aktion des MPI eine Reaktion ist, eine Gegenhaltung. Muss nicht gut sein, muss auch nicht schlecht sein. Eine deutsche Gesellschaft muss ihren Begriff des Genozides nicht mit der ganzen Welt abstimmen, sollte aber beobachten, dass dieser Begriff ihr auch nicht gehört. Nur weil ich denke, dass die Entscheidung der Max-Planck-Gesellschaft, das Verfahren und die Pressemitteilung dazu falsch waren (und ich im schlauen Nachhinein bequem den Wunsch entwickeln und ausführen kann, ich hätte beides verhindern können), gehe ich nicht davon aus, dass an den Kettenreaktionen, die so etwas passieren lassen, prinzipiell etwas repariert werden kann oder repariert werden muss. Wenn diesmal es falsch war, Hage den Gaststatus zu entziehen, kann es demnächst richtig sein, ihn nicht gastlich zu empfangen. Die Welt dreht sich, alles darin ist schon verdreht- Vielleicht kann eine Gesellschaft zögerlich und zaudernder, vorsichtiger werden. Vielleicht entwickelt die Max-Planck-Gesellschaft größere Widerständigkeit gegen Journalisten, die die Welt reparieren wollen und die die Welt eventuell reparieren wollen, um in und mit der Welt gut zu leben und Karriere zu machen. Mein persönlicher und privater Schurke in dem Fall Hage ist dirk Banse, aber denn kenne ich nicht - das ist meine Phantasie, für die ich unter anderem aus einem masochistischem Grund gerne die Verantwortung übernehme: Ich hafte eh' an meinen und für meine Erwartungen, an meinen und für meine Illusionen und Imaginationen, für alles das, was mir normativ scheint (und in dessen Licht sich Dirk Banse grell als Schurke zeigt). Ich bin nicht the good guy, ich bin der Polarforscher, ein entfremdeter, wendiger und windiger Charakter schlechthin.
In ihren Arbeiten zu den Medien der Rechtsprechung hat Cornelia Vismann versucht, das Recht über zwei Dispositive zu beschreiben: ein agonales und ein theatrales Dispositiv. Wie das Aktenbuch, so ist Vismanns Buch über Gerichte ein Anfang. Den kann man wegwischen, man kann ihn aber auch aufgreifen, etwa um weiter Überlegungen zum Diagonalen zu entfalten.
2 notes
·
View notes
Text
Katrina’s nails dug into her palms as she stared into space, trying to think of anything else but the sight of blood pooling into red hair. The sound of gunshots. The fact that now the only friend she had here, the last link to home and any semblance of sanity, was gone.
“Hey.” Katrina snapped out of her trance to find a boy and a girl standing in the doorway. “I saw what happened to your friend. I’m sorry,” the boy said, stepping forward.
“Thanks.” Katrina glanced at them before turning her gaze back to the wall. The sentiment was appreciated, but the reminder of what had just happened was not.
“I’m Wilhelm.” Her brow furrowed slightly as she glanced back up at the boy, a bit surprised he was still talking. But there he stood, with a slight smile on his face. “And this is Jess,” he said, gesturing to the girl beside him. Jess didn’t speak, but gave Katrina a slight nod of acknowledgement.
“...Katrina,” she responded.
“So, do you have any siblings back home?” Wilhelm asked, taking a seat across from her. Jess followed.
“A brother. Older.”
He nodded appreciatively. “I have two sisters. One younger, one older.” He paused for a moment, glancing almost expectantly at the short-haired girl next to him - but she still was silent. “Jess is an only child,” he said, filling in for her.
“Must be nice,” Katrina responded, partially just out of politeness.
“It’s lonely,” Jess finally said, making Katrina look over in surprise. The shorter girl didn’t shy away, holding her gaze steadily.
“Well, hey, now you have me,” Wilhelm piped up, giving Jess a small nudge. “We have each other.” With the way that he smiled and looked over, it almost felt to Katrina as if he was including her in the sentiment. Was he?
His enthusiasm felt almost out of place here, in this dark dungeon of a building surrounded by armed guards and lab coats. But… it was welcome. And despite herself, Katrina summoned a small smile in return.
“I guess so.”
#[this is the scene where they first meet!]#[märchenstunde].drabble#[du hast uns angelogen].hydra#[es sollte mich gewesen].wilhelm#death mention tw
2 notes
·
View notes
Photo

“Berliner Fernsehturm” * Foto: BernardoUPloud
Nach ihrer gescheiterten Ehe mit Frank Randall findet Claire Beauchamp in Berlin ein neues Zuhause. Doch dann brechen Spannungen zwischen dem zwischenzeitlich aus der EU ausgeschiedenen Großbritannien und der EU aus und alle Inhaber eines englischen Passes werden aufgefordert, das Territorium der EU innerhalb von sechs Wochen zu verlassen … und plötzlich ist Claires Zukunft ungewisser denn je.
Diese Geschichte ist im Rahmen des #14DaysofOutlander Events entstanden, der von @scotsmanandsassenach initiiert wurde.
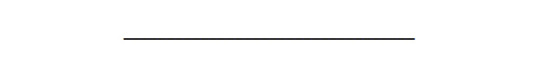

“Glencoe” by dowchrisr
Kapitel 2: 14 Männer (1)
James Alexander Malcolm MacKenzie Fraser war in den Schottischen Highlands geboren worden und auch dort aufgewachsen. Doch die Entwicklung der Weltgeschichte sollte es unmöglich machen, dass er auch den Rest seines Lebens in der geliebten Heimat verbringen konnte. Belesen in europäischer Geschichte und als aufmerksamer Beobachter der weltweiten politischen Entwicklungen, hatte er früh erahnt, dass der harte “Brexit” Großbritanniens das (bis dahin noch) Vereinigte Königreich in ein bisher ungeahntes Chaos führen würde.

“Brexit” by Foto-Rabe
Als dann die Corona Pandemie in Europa und auch auf der britischen Insel verebbte und die Reisebeschränkungen weitgehend aufgehoben wurden, entschied James Fraser als Oberhaupt seines Clans, dass es nun höchste Zeit war, das Land zu verlassen. Viele Menschen in seiner Umgebung, insbesondere die anderen 13 Mitglieder des “Bundes der Neuen Jakobiner”, sahen es genauso. Einige seiner Freunde emigrierten in die Republik Irland, andere nach Frankreich oder in die Niederlande. Für Jamie und seine Familie hatte sich bereits viele Jahre zuvor eine andere Tür geöffnet. Jared Fraser, einer von Jamies Onkeln, war in seiner Jugend nach Frankreich gegangen und hatte von Paris aus einen florierenden, europaweiten Weinhandel aufgebaut. Auch in Berlin hatte er eine Filiale eröffnet. Von dort aus wurde das gesamte Geschäft für Deutschland und Süd-Ost-Europa koordiniert. Um Steuern zu sparen und um die Erlöse seines Geschäfts trotz der 0-Zins-Politik der Europäischen Zentralbank gewinnbringend anzulegen, hatte Jared Fraser Immobilien gekauft. Unter den Häusern, die er in u.a. im Land Brandenburg erworben hatte, befand sich auch ein gut erhaltenes Herrenhaus vor den Toren Berlins. Nach seinem Tod war dieser Teil von Jareds Besitz an Jamie und seine Schwester Jenny gefallen. So kam es, dass an jenem Tag, an dem in Westminster beschlossen wurde, dass die wegen der Corona Pandemie erlassenen Notstandsgesetze auch weiterhin in Kraft bleiben sollten, ein Containerschiff den Hafen Edinburghs in Richtung Rostock verließ. In den Containern, die es transportierte, befand sich der Großteil des beweglichen Besitzes der Familie Fraser/Murray. Die Familie selbst, Jamie, Ian, Jenny und die Kinder, hatten bereits am Abend zuvor ein Flugzeug der Norwegian Airlines bestiegen, dass sie mit einen Zwischenstopp in Oslo-Gardermoen innerhalb von viereinhalb Stunden nach Berlin-Schönefeld gebracht hatte. Auf dem dortigen Flughafen angekommen, hatte sie Felix Kloppstock, der noch von Jared Fraser eingesetzte stellvertretende Geschäftsleiter der Berliner Zentrale, mit einem Kleinbus der Weinhandlung abgeholt. Als sie in Wilhelmshorst bei Potsdam eintrafen, war das Haus schon für sie vorbereitet. Die Betten waren bezogen und aus der Küche kam ihnen der Geruch eines Rehbratens entgegen, der sie wissen ließ, dass das Abendessen bereit stand. Dann wurden sie auch von Helene Ballin begrüßt. Auch die 55-jährige Hauswirtschafterin und ihr Mann Frieder waren noch von jared Fraser eingestellt und mit der Verwaltung des hauses betraut worden. Als alle Frasers bzw. Murrays am späten Abend in ihre Betten fielen, da taten sie es mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Lachend, weil sie wussten, dass sie nun in Sicherheit waren. Weinend, weil sie ihre Heimat vermissten. Und James Fraser bewegten noch ganz andere Gedanken. Er war froh, dass seine Eltern die politischen Entwicklungen der Gegenwart nicht mehr miterleben musste. Gleichzeitig befiel ihn ein Gefühl großer Trauer, wenn er daran dachte, dass er ihre Gräber auf dem nahe Lallybroch gelegenen Friedhof wahrscheinlich für sehr lange Zeit nicht mehr aufsuchen konnte.

“Brandenburg” by reinhardweisener
Wie richtig und wie entscheidend ihr Schritt gewesen war, sollten sie wenige Tage nach ihrer Ankunft in Wilhelmshorst durch die Medien erfahren. Sie hatten die Kinder nach dem Abendessen zu Bett gebracht und saßen nun noch ein wenig in der Küche zusammen. Jenny wurde kreidebleich als das Radio meldete, dass die Londoner Regierung angekündigt habe, die Notstandsgesetze nun explizit dazu nutzen zu wollen, um gegen die die immer größer und lauter werdende schottische Unabhängigkeitsbewegung vorzugehen. Jeder, der auch nur mutmaßlich den “Neuen Jakobiten” oder ihren Anhängern zugerechnet wurde, sollte verhaftet und wegen Hochverrats angeklagt werden. Ian, der neben Jenny am Küchentisch saß, blickte erschrocken auf. Und Jamie, der gerade für sich und Ian zwei Flaschen Bier aus dem Kühlschrank genommen hatte, drehte sich zu ihnen um, sah sie an und seufzte nur.
“Genau das habe ich immer befürchtet. Aber keine Sorge, unsere Einbürgerungspapiere sind schon unterwegs. Ich habe gestern Abend mit Ernst gesprochen.”
Ernst, genaugenommen Ernst Neuenburger, war Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Jamie hatte den Beamten im Jahr 2018 kennengelernt, als sein Onkel Jared ihn zu dem Sommerfest des Ministeriums mitnahm und seinen Neffen auf diese Weise in das Netzwerk einführte, das er seit vielen Jahren in ganz Europa aufgebaut hatte. (Jared Fraser hatte sein Leben mit großem Eifer in den Dienst der “Neuen Jakobiten” gestellt. Wo immer er konnte, hatte er seinen Einfluss und seine finanziellen Mittel dazu genutzt, um auf dem Kontinent für ein unabhängiges Schottland mit guten Beziehungen zur EU zu werben.) James Fraser und Ernst Neuenburger waren sich sofort sympathisch. Und im Verlauf des Abends stellte Jamie nicht nur fest, dass Ernst Neuenburger ein kompetenter Gesprächspartner in Wirtschaftsfragen war, sondern auch eine große Zuneigung zu Schottland hegte.

BMWi Goerckehof mit Brunnen by Fridolin freudenfett - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62265692
“Wenn wir das Selbstbestimmungsrecht der Völker ernst nehmen, wie es in Artikel 1 Ziffer 2 der UN-Charta, durch den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte sowie den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte vom 19. Dezember 1966, festgelegt wurde, dann muss Schottland das Recht bekommen, ein eigener Staat zu sein,” hatte der Staatssekretär gesagt.
Jamie hatte zustimmend genickt und anschließend, mehr im Scherz, gefragt:
“Sind Sie insgeheim ein Jakobiner, Herr Neuenburger?”
“Nein, Herr Fraser,” hatte der Politiker lächelnd, aber mit einem sehr ernsten Unterton in seiner Stimme entgegnet, “ich glaube nicht, dass man irgendeiner Gruppe angehören muss, um für Freiheit und Selbstbestimmung einzutreten. Demokrat zu sein reicht meiner Meinung nach vollkommen aus.”
Neunburger, der ganz offensichtlich Freude an der Unterhaltung mit Jared Frasers Neffen gefunden hatte, sah sich kurz um.
“Lassen Sie uns doch einige Schritte gehen,” sagte er dann und wies mit einer Hand in Richtung eines Weges, der sie vom Zentrum des Festes wegführen würde.
“Gern,” antwortet Jamie und gemeinsam entfernten sie sich von der Masse der Feiernden. Auch Jahre später erinnerte er sich noch gut daran, wie er beim Fortgehen seinen Onkel Jared gesehen hatte, der, ebenfalls etwas entfernt von allen anderen, im Schatten einer hohen Hecke mit einem Mann und einer Frau sprach. Jared hatte gelächelt, seinem Neffen kurz zugenickt und sich dann sofort wieder seinen Gesprächspartnern gewidmet.
Als sie sich ungefähr zweihundert Meter entfernt hatten, war es Jamie, der das Gespräch wieder aufnahm:
“Interessant, dass Sie das als Deutscher sagen, revolutionäre Töne sind wir doch nur von Franzosen gewöhnt. Die Franzosen haben uns ja auch unterstützt, in früheren Jahrhunderten, die Deutschen hingegen …”
“Wenn Sie erlauben, Herr Fraser,” warf Neuenburger ein, “die Deutschen gab es damals noch gar nicht. Als die Franzosen sie unterstützten, gab es, Dank der politischen Ränkespiele der Franzosen, Österreicher und Russen, nur einem Flickenteppich kleiner und kleinster deutscher Länder. Erst Bismarck …”
“Ich weiß, ich weiß. Aber es waren doch Deutsche, der König von Hannover, der …”
“Oh ja, natürlich. Sie brauchen mich auch nicht daran zu erinnern, dass das Königreich Preußen mit dem Königreich Hannover alliiert war … Aber Sie kennen doch das Sprichwort: ‘Man kann sich seine Familie nicht aussuchen, seine Freunde hingegen schon.’ Wie Sie vielleicht wissen war Georg August II ein Cousin von Friedrich Wilhelm I, dem Vater von Friedrich des Großen. Beide, Georg II und Friedrich I, wurden von ihrer gemeinschaftlichen Großmutter, der Kurfürstin Sophie in Herrenhausen bei Hannover erzogen. Es ist historisch überliefert, dass die Männer bereits als Kinder eine Abneigung gegeneinander hegten. Diese Abneigung hielt auch später, als sie Männer bzw. Könige wurden, an.”
Neuenburger hielt mit seinen Ausführungen inne, als eine Bedienung mit einem Tablett gefüllter Sektgläser erschien und den beiden Männern ‘Nachschub’ anbot. Beide Männer tauschten ihre leeren Gläser gegen volle und setzten den Spaziergang fort.
“Zweimal wäre es auch beinahe zu einem Krieg zwischen Hannover und Preußen gekommen. Wussten Sie das?” fragte Neuenburger.
Jamie sah ihn fragend an und schüttelte leicht den Kopf.
“1731 kam es zum Streit zwischen den Reichen und Familien, weil Preußen, wo immer möglich, Siedler anwarb. Georg II erließ ein Edikt und zog ein Heer an den Ufern der Elbe zusammen. Friedrich Wilhelm I hingegen ließ 40.000 Soldaten in Magdeburg stationieren, um notfalls sein Territorium zu verteidigen. Die Herzöge von Braunschweig und Gotha vermittelten und konnten den Streit einigermaßen schlichten. Ein Krieg wurde verhindert. Doch der Friede sollte nicht lange andauern. Zur gleichen Zeit, als in Culloden der Schottische Widerstand niedergeschlagen wurde, schwehlte ein anderer Streit zwischen Hannover und Preußen. Nachdem 1744 der letzte Fürst aus dem Haus der Cirksena verstorben war, war streitig, wer die Grafschaft Ostfriesland erben würde. Von Seiten der Friesischen Fürsten gab es seit 1691 einen Erbvertrag mit Hannover, doch Friedrich I hatte am 10. Dezember 1694 von Kaiser Leopold einen Expektanzbrief auf Belehnung mit Ostfriesland nach Aussterben des dortigen Fürstenhauses erhalten. Den Ausschlag in diesem Konflikt gab jedoch die Stadt Emden. Die Stadt war zwar zu diesem Zeitpunkt politisch isoliert und wirtschaftlich geschwächt. Grund dafür war der 1726/27 ausgefochtene ‘Appelle-Krieg’. Dieser Krieg war eigentlich ein Bürgerkrieg und entstand aus einem Konflikt zwischen dem Fürsten Georg Albrecht von Ostfriesland und den ostfriesischen Ständen. Es ging, wie konnte es anders sein, um die Steuerhoheit. Doch auch nach ihrer Niederlage gaben die Stadtoberen ihr Ziel, aus Emden wieder eine bedeutende Wirtschaftsmetropole zu machen, nicht auf. Seit der ‘Emder Revolution’ im Jahr 1595 hatte die Stadt den Status einer quasi-autonome Stadtrepublik. In dieser - erfolgreichen - Revolution hatte sich die Stadt bereits einmal von der Herrschaft der Cirksena befreit und erreichte als ‘Satellit’ der Niederlande de facto die Stellung einer freien Reichsstadt. Die Vertreter der Stadt unterzeichneten fortan alle Verträge und öffentlichen Publikationen nach Römischem Vorbild mit “S.P.Q.E.“ (Emdischer Senat und Bürgerschaft). Der Titel ‘Respublica Emdana’ und die Abkürzung ‘S. P. Q. E.’ wurden fortan von der Stadt Emden offiziell geführt. Zu dieser bereits einmal innegehabten Freiheit und Unabhängigkeit wollten die Ratsherren der Stadt zurückkehren. Schon als der letzte Cirksena Fürst 1734 seine Herrschaft antrat, hatte die Stadt ihm die Huldigung verweigert. Aber spätestens ab 1740 planten die Emder Ratsherren ihr Ziel mit der Hilfe des aufgeklärten Preußischen Königs zu erreichen. Heimlich handelten sie mit den Preußen die Emder Konvention aus. In diesem Vertrag erkannte Preußen die Rechte und Privilegien der Stadt Emden und der Ostfriesischen Landstände an.Im Gegenzug erkannten die Ostfriesischen Stände die Herrschaft Preußens nach dem Tod des letzten Fürsten aus dem Haus Cirksena an. Es war eine Win-win-Situation. Das aufgeklärte Preußen ließ den Ostfriesen ihre Ständischen Freiheiten und erhielt im Gegenzug ein Land mit einem Zugang zur Nordsee. Am 25. Mai 1744, zwei Wochen nachdem die Emder Konvention von beiden Parteien ratifiziert worden war, starb der letzte Fürst Ostfrieslands. Preußen machte umgehend sein Nachfolgerecht geltend. Die verwitwete Fürstin von Ostfriesland erkannte am 26. Mai die Erbfolge Preußens an und empfahl sich “der Protektion und Generosität des Königs”. Friedrich II hatte seine Vertreter sofort angewiesen, überall bekanntzumachen, daß die Privilegien und Rechte der Ostfriesen ungeschmälert bleiben würden und keine Abwerbung Ostfriesischer Bürger zu befürchten sei. Mit diesen beruhigenden Versicherungen wurden die preußischen Soldaten in Aurich und Leer sogar positiv aufgenommen. Die Besitzergreifung war bereits am 2. Juni abgeschlossen, nur eine Woche nach dem Tod des Fürsten. Drei Wochen später, am 23. Juni 1744, huldigte die gesamte Grafschaft der Preußischen Krone.

“Rathaus Emden” by fokkengerhard
Was meinen Sie, Fraser? Hat man sich darüber in Hannover, respektive London, gefreut? Wohl kaum. Am 3. Juni traf der Hannoversche Oberappellationsrat Voigt mit einer entsprechenden Vollmacht in Ostfriesland ein. Aber da war die ganze Sache bereits abgeschlossen. Die Geschwindigkeit, mit der die Übernahme Ostfrieslands geschah, möglich geworden durch die sorgfältige und geheime Vorbereitung, stellte einmal mehr den hannoverschen Mitbewerber in den Schatten. Man kann sich des Eindrucks von Dilettantismus seitens Hannovers nicht erwehren. Zwar hatte man auch dort umgehend reagiert, indem man den Oberappellationsrat Voigt am 3. Juni mit einer entsprechenden Vollmacht nach Ostfriesland sandte, aber niemand wollte ihn oder seine Ansprüche offiziell annehmen. Die Stände gaben ihm am 10. Juni sehr treffend zu verstehen, daß der Vertrag, der zwischen dem Haus Cirksena und Hannover geschlossen worden war, ihnen weder bekannt sei noch sie etwas anginge, da weder sie noch der Kaiser das Dokument abgesegnet hätten. Ostfriesland sollte auch noch länger Konfliktpotential besitzen. 1748 wurden die Streitigkeiten um den Seehandel insbesondere mit den Niederlanden, aber auch mit England und Schweden stärker. Im Siebenjährigen Krieg benötigte England dann jedoch die Unterstützung durch Preußische Soldaten und erst im Zuge dessen gab es alle Ansprüche in Bezug in Bezug auf Ostfriesland auf.”
Die beiden Männer waren stehen geblieben und hatten ihre Gläser geleert.
“Warum erzählen Sie mir dies alles?”

“Brunnen im Kanonenhof des Invalidenhauses, heute Bundesministerium für Wirtschaft, Berlin” by Dirk Sattler - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62311136
“Nun, Sie sagten, dass es ungewohnt sei, von einem Deutschen ‘revolutionäre’ Töne zu hören. Sicher, wie schon Friedrich Engels sagte, ‘werden Revolutionen in Preußen von oben gemacht’. Wir mögen nicht so revolutionär sein, wie die Franzosen, aber vergessen Sie bitte nicht, dass wir ein sehr, sehr freiheitsliebendes Volk sind. Die Geschichte des Ersten und des Zweiten Weltkrieges ist allseits bekannt. Dabei wird jedoch die Geschichte unseres Freiheitskampfes, 1813 bis 1815, gegen Napoleon oft übersehen. Die Unterstützung aus dem Volk war so groß, dass einige Historiker sogar vom Preußischen Volkskrieg sprechen. Männer und Frauen tauschten ihre goldenen Eheringe gegen eiserne Ringe ein, um auf diese Weise ihr Land zu unterstützen. Ein bekanntes Bild, das sich nach dem Befreiungskrieg verbreitete, zeigt einen heimkehrenden Soldaten. Seiner ihn mit offenen Armen begrüßenden Frau ruft er nicht zu: ‘Ich bin wieder da’, sondern ‘Das Vaterland ist frei! Victoria!’ Und das war nicht nur damals so. Bedenken Sie, dass dieses Land 40 Jahre um seine Wiedervereinigung und damit um seine Freiheit gerungen hat. Nicht aggressiv, aber beständig. Und als dann die Deutschen im Osten das SED-Regime zu Fall brachten, war es eine friedliche Revolution, mit der sie die Diktatur in die Knie zwangen. Was meinen Sie wohl, welche Gefühle die Menschen hier für ein Volk hegen, dass von seinem, sagen wir mal, größeren Nachbarn, unterdrückt wird?”
Neuenburger begann langsam wieder zu gehen. Jamie klinkte sich ein.
“Warum genau erzählen Sie mir das alles?” fragte er dann.
“Nun, vielleicht wollte ich Sie daran erinnern, dass sich revolutionäre, sprich umwälzende, Gedanken nicht immer gleich in einem Sturm auf die Bastille entladen müssen. Manchmal ist es weiser, sie für sich zu behalten und … sagen wir, die Ratifizierung einer Emder Konvention abzuwarten. Ein freiheitsliebendes Volk wird die Freiheit oder besser gesagt, die Befreiung, eines anderen Volkes jedenfalls immer begrüßen und … unterstützen.”
Neuenburger lächelte. Jamie schüttelte leicht den Kopf und lächelte ebenfalls.
“Kommen Sie Fraser,” sagte der neu gefundene Freund dann, “lassen Sie uns gehen. Das Buffet ist eröffnet.”
Das Gespräch der beiden Männer war nicht ohne Folgen geblieben. Zweimal, einmal im Herbst 2018 und einmal im Sommer 2019, hatte Ernst Neuenburger das heimische Gut der Frasers im schottischen Hochland als Feriengast besucht, ehe die politischen Geschehnisse diese Reisen für ihn unmöglich machten. Doch das Vertrauen der beiden Männer zueinander war in diesen Wochen gemeinsamer Wanderungen, Ausritte und Jagden, soweit gewachsen, dass es Jamie Ende 2020 möglich war, über zuvor vereinbarte ‘private’ Kanäle unbemerkt Kontakt zu seinem Freund in Berlin aufzunehmen. Alles, was dann geschah, ja geschehen musste, um die Familie Fraser/Murray in ihr sicheres Exil zu bringen, geschah sehr schnell. Es musste sehr schnell geschehen, denn das Zeitfenster, in dem es geschehen konnte, war, wie in jedem historischen Moment, nur kurz geöffnet.

“Schottland” by Emphyrio
Am ersten Samstagabend, den die Frasers/Murrays in ihrem neuen Zuhause verbrachten, kam Ernst Neuenburger vorbei, um die Pässe und Einbürgerungspapiere für alle Familienmitglieder zu überbringen. Jenny lud ihn zum Abendessen ein und anschließend verzogen sich Jamie und der Gast in die Bibliothek. Nachdem die beiden Männer bei einem Glas Whisky vor dem Kamin eine Weile über die politische Situation in Europa gesprochen hatten, lehnte sich Ernst Neubauer zu Jamie hinüber.
“Wir hätten da auch eine Frage an Dich …”
Jamie war klar gewesen, dass Neuburger früher oder später mit einer Bitte an ihn herantreten würde. Er sah es nicht als Erpressung oder Bezahlung an. Im Gegenteil, er war dankbar, wenn er im Gegenzug für die gewährten Privilegien auch etwas tun konnte. Nur ungern wäre er ein Schuldner seines Freundes geblieben.
“Du musst mir glauben, dass ich das nicht geplant habe. Ich habe mich gern für Dich und Deine Familie eingesetzt und werde es auch weiterhin tun …”
“Sprich Ernst, gerade heraus.”
“Nun, Du besitzt einige Fähigkeiten, die für uns sehr nützlich wären. Du sprichst Englisch, perfekt Französisch, sehr gut Deutsch. Du bist intelligent und ein Mann, der schweigen kann. Außerdem besitzt Du einen florierenden Weinhandel und als Geschäftsmann …”
“... kann ich problemlos überall hinreisen?”
“Genau. Aber das Wichtigste ist, dass ich Dir vertraue.”
Die Männer schwiegen einen Moment.
“Wärest Du bereit,” fragte Neuenburger dann, “in unserem Auftrag als Unterhändler zu fungieren und zu reisen, wenn es notwendig sein sollte?”
“Soll ich ‘Emder Konventionen’ für Euch abschließen?”
“Vielleicht.”
Neuenburger musste schmunzeln.
“Und wohin für mich das führen?”
“Nun, zuerst einmal auf den afrikanischen Kontinent. 116 Millionen Afrikaner in 31 Länder sprechen Französisch. Tendenz steigend. Deine Sprachkenntnisse prädestinieren Dich für Aufgaben in diesem Gebiet. Wir würden Dich allerdings bitten, auch Spanisch und eventuell Portugiesisch zu lernen. Dann könnten wir Dich auch in Südamerika einsetzen. Wir stellen Dir natürlich einen von uns bezahlten Sprachlehrer zu Verfügung.”
Wieder schwiegen die Männer einen Augenblick.
“Wie gefährlich könnten mir diese ‘Aufträge’ werde?” fragte Jamie dann.
“Nicht besonders,” antwortete Neuenburger. “Du reist ja als Geschäftsmann und das erregt wesentlich weniger Aufsehen als die Reisen eines Politikers oder eines politischen Beamten. Es gibt eine ganze Reihe von, sagen wir ‘Geschäftsleuten’, die so etwas für uns tun. Bis jetzt ist jeder von ihnen wieder zurückgekehrt. Wir werden Dich natürlich auch eingehend auf deine Aufgabe vorbereiten.”
Jamie überlegte einen Moment, dann nickte er und antwortete:
“Travailler pour le roi de Prusse? Jes suis prest! Ihr habt mir und meiner Familie die Freiheit erhalten und hier einen Neuanfang ermöglicht. Wenn wir jetzt nicht hier wären, würde ich wahrscheinlich mittlerweile in einem englischen Gefängnis sitzen. Es ist nur fair, wenn ich etwas zurückgebe.”
“Danke,” sagte Neuenburger. Dann griff er in die rechte Innentasche seines Jacketts und holte daraus einen frischen Reisepass hervor, den er Jamie reichte.
Dieser griff danach und schlug das kleine Buch auf.

“Reisepass” by Edeltravel_
“So, so, na habt Ihr Euch ja einen netten Aliasnamen für mich einfallen lassen.”
Neuenburger lächelte.
Vier Wochen später trat Etienne Marcel de Provac Alexandre, alias James Fraser, seine erste Reise als gut getarnter diplomatischer Unterhändler an.
Diese und weitere Reise sollten ihn zuerst in zahlreiche Staaten des Afrikanischen Kontinents führen. Er verhandelte mit anderen Unterhändlern über politische und wirtschaftliche Verträge, setzte sich für die Freilassung und Rückführung von in Schwierigkeiten geratenen Staatsbürgern ein und überbrachte mündliche Botschaften, deren Inhalt zu geheim war, als dass man ihn auf papierenen noch elektronischem Wege übermitteln wollte. Als er dann fließend Spanisch sprechen konnte, setzte man ihn ab 2023 auch in Südamerika ein. Eine seiner letzten Reisen führte ihn nach Buenos Aires, wo er einen Handelsvertrag abschloss. Offiziell besuchte er allerdings die “Konferenz argentinischer und chilenischer Weinhändler”. Um seine Reise möglichst unauffällig erscheinen zu lassen, flog er nicht auf direktem Weg nach Berlin zurück, sondern machte einen Zwischenstopp in Boston. Offiziell würde er dort einen befreundeten Geschäftsmann treffen, der Frasers Weine in sein Sortiment aufzunehmen gedachte. In Wirklichkeit aber sollte dieser Zwischenstopp sein Leben grundlegend verändern. Doch davon wusste James Fraser zu diesem Zeitpunkt noch nichts.
#14DaysofOutlander#Outlander#Outlander fan Fiction Deutsch#von boston nach berlin in 14 stunden#Claire Beauchamp#Jamie Fraser#Berlin#Ian Murray#Jenny Murray#Schottland#Deutschland#Etienne Marcel de Provac Alexandre
1 note
·
View note
Text
Ein Religionsgespräch in Karakorum
Am heutigen Tag schickte Khan Möngke seine Schreiber mit der Nachricht zu mir, dass wir alle, Christen, Sarazenen und Tuinen uns versammeln sollen, um unsere Religionen miteinander zu vergleichen. Jeder von uns behauptet, seine Religion sei die bessere und wahre, doch Khan möchte die Wahrheit kennen. Also teilte ich seinen Schreibern mit, was unsere Schrift besagt: „Ein Diener des Herrn soll nicht streiten, sondern freundlich gegen alle sein; daher bin ich bereit, ohne Zank und Streit über den Glauben und die Hoffnung der Christen jedem, der es verlangt, Auskunft zu geben“.Einen Tag vor Pfingsten war es dann so weit. Wir versammelten uns bei unserem Gebetshaus. Es kamen mehr Leute, als ich gedacht habe. Drei Schreiber des Khan Möngke sollten die Schiedsrichter sein. Ich saß mich schließlich in die Mitte und sah die Tuinen erwartungsvoll an. Sie stellten mir einen entgegen, der von Cathay gekommen war und seinen Dolmetscher bei sich hatte. Ich dagegen hatte den Sohn des Meisters Wilhelm bei mir.Er fragte mich, worüber ich zuerst disputieren wolle, wie die Welt geschaffen wurde oder was nach dem Tod mit den Seelen geschieht. Ich antwortete ihm daraufhin, dass dies nicht der Beginn unseres Gespräches sein könne. Alles kommt von Gott, weshalb wir zuerst über ihn sprechen müssen. Ich dachte mir, Möngke soll schließlich erfahren, wer den besseren Glauben an Gott besitzt.Die Schiedsrichter schienen gelangweilt und wollten mit den oben genannten Fragen anfangen, da sie sie für die wichtigsten hielten. Sie gehören nämlich zur Sekte der Manichäer. Sie glauben, die Hälfte der Welt sei böse und die andere Hälfte gut. Die Tiere sollen von einem Körper in den anderen übergehen. Mögen Gott sie rechtleiten, ich halte dies für eine Irrlehre.Sie wollten ihren Glauben jedoch bekräftigen und schickten einen Knaben aus Cathay, der wahrscheinlich noch keine drei Jahre alt war und dennoch vollen Verstand besaß. Es ist außergewöhnlich für sein Alter, dass er bereits lesen und schreiben kann. Er sagte von sich selbst, dass er schon dreimal in einem Körper gewesen sei.Schließlich machte ich dem Tuinen meinen Standpunkt klar, nämlich dass nur einen einzigen Gott gibt, an den ich mit meinem ganzem Herzen glaube. Ich erklärte ihm, Gott sei allmächtig und bedarf niemandes Hilfe, vielmehr bedürfen wir alle der seinen. Er weiß alles, alles Wissen kommt von ihm. Er ist in höchstem Maße gut. Der Tuine hat mir widersprochen und tatsächlich behauptet, es gebe mehrere Götter im Himmel und einer davon ist der höchste Gott, dessen Ursprung sie nicht kennen. Auf der Erde hingegen, dort gebe es angeblich unzählige Götter.Der Tuine fragte mich anschließend, weshalb der christliche Gott das Böse schuf. Ich erläuterte daraufhin, dass das Böse nicht Gottes Werk ist. Alles, was es gibt, ist gut. In den Gesichtern der Tuinen brach Verwirrung aus. So stellte er die Frage, woher das Böse überhaupt käme. Bevor ich ihm allerdings diese Frage beantwortete, verlangte ich eine Gegenleistung. Er sollte mir eine Antwort auf die Frage geben, ob er glaubt, dass sein Gott allmächtig ist. Es folgte langes Schweigen, bis er dann sagte, dass kein Gott allmächtig sei. Es brach lautes Gelächter von den Sarazenen aus, verständlich.Abschließend machte ich den Nestorianern Platz für die Disputation mit den Sarazenen. Ich konnte zuerst nicht glauben, was die Sarazenen von sich gaben. Sie gaben zu, dass das Christentum die wahre Religion sei. Alle hörten zwar ohne Widerspruch zu, doch auch nach diesem Geständnis hat keiner behauptet, er wolle Christ werden. Der Abend endete damit, dass die Nestorianer und Sarazenen laut miteinander sangen. Nur die Tuinen schwiegen. Danach tranken sie in Mengen...
0 notes
Text
Fundstück
Wilhelm von Bode, Fünfzig Jahre Museumsarbeit
Die Berliner Museen und ihre Protektoren
Jeder kennt die Begründer unserer Sammlungen alter Kunst: Friedrich der Große, der feinsinnige Kunstfreund und erste leidenschaftliche Sammler unter den Hohenzollern, bestimmte seine Galerie in Sanssouci als Kunsttempel für jedermann; Friedrich Wilhelm III. ging weiter, indem er – schon bald nach seinem Regierungsantritt – durch Schinkel Pläne für ein Museum in Berlin entwerfen ließ, das alle plastischen und Gemälde-Schätze aus königlichem Besitz aufnehmen sollte. 1830 wurde der Schinkelsche Bau eröffnet, nachdem inzwischen noch manches erworben war, vor allem die große Galerie Solly mit ihren reichen Schätzen namentlich an Werken des fünfzehnten Jahrhunderts. Während der König der Kunst persönlich nicht näher stand, aber für ihre Förderung im öffentlichen Interesse volles Verständnis hatte, war sein Sohn Friedrich Wilhelm IV. von seltener künstlerischer Begabung; ihm verdankt das Museum auch seine Erweiterung durch das Neue Museum und die Überweisung und Erweiterung des Kupferstichkabinetts und der Kunstkammer, sowie die Begründung der ägyptischen Abteilung und einer großen Sammlung von Gipsabgüssen. Aber um die Gemäldesammlung in ähnlicher Weise zu bereichern wie sein Vater, fehlte es ihm an Entschluß und Ausdauer, Als sein Bruder Wilhelm ihm als König folgte, ließen zunächst innere und äußere Kämpfe nicht an die Förderung der Museen denken. Gefördert konnten sie erst wieder werden, nachdem der Kampf mit Frankreich siegreich ausgefochten war. Gerade damals wurde ich an die Berliner Museen berufen und habe hier seither unter den drei Hohenzollern-Kaisern tätig mitgewirkt und über ihre Stellung zur Kunst, vor allem zu den Berliner Museen, mir ein Urteil bilden können; mit wenigen Worten sei hier angedeutet, welchen Dank die Museen den drei Herrschern schulden, wie jeder dieser unserer Herrscher sich zu ihnen gestellt und in welcher Art er sie gefördert hat. (Bild: Museumsinsel, Berlin, Masterplan)

Wilhelm I. war so ausschließlich als Soldat erzogen und so lebhaft für diesen Beruf begeistert, fühlte sich in allen Fragen der Kunst hinter seinem älteren Bruder so weit zurückstehend, daß er sich selbst als völligen Laien betrachtete. Als ernste Fragen der Kunstverwaltung an ihn als Herrscher herantraten, war er ein Greis; sein erstes war daher, daß er diese Sorge seinem Sohn übertrug, indem er ihn Anfang 1872 zum Protektor der königlichen Museen ernannte. In echt staatsmännischem Sinne hat er aber trotzdem die Förderung der Museen sich am Herzen liegen lassen. Die Ausgrabung von Olympia und bald darauf die Ausgrabung von Pergamon fanden seine Billigung und warme Unterstützung; auch für unsere Erwerbungen in der Gemäldegalerie war er interessiert.
Ein Besuch, bei dem ich den damals Achtzigjährigen selbst führen durfte, hat mir auch den überraschenden Beweis geliefert, daß der Kaiser infolge seines Mangels an jeder Übung und durch Unterordnung unter seinen älteren Bruder seinen Kunstsinn sehr unterschätzte und sehr mit Unrecht auch im Publikum als Kunstbanause galt. Ich hatte damals Gelegenheit, gerade seine natürliche Begabung für echte Kunst zu beobachten. Die ersten Gruppen des großen Frieses von Pergamon waren angekommen, zu deren Besichtigung der Kaiser mit seiner Suite sich angemeldet hatte. Da am gleichen Tage auch Michelangelos Giovannino aus Pisa eingetroffen war, ließen wir in aller Eile diese Marmorfigur auspacken und auf einer der Kisten im Direktionszimmer aufstellen, für den Fall, daß der Kaiser Zeit und Lust haben sollte, nach den Pergamenischen Reliefs auch diese Figur noch anzusehen. Wir waren eben fertig damit, als der Kaiser eintrat. »Ein Johannes soll das sein? Ich hätte mir ihn anders vorgestellt!« war seine erste Bemerkung. »Ja, es ist eine recht törichte Figur und zudem so unsinnig teuer,« akkompagnierte der mitanwesende Kultusminister. »Da verstehen Sie mich falsch, mein lieber P.«, antwortete der Kaiser; »mir erscheint die Auffassung des Wüstenpredigers als schöner, honignaschender Jüngling recht merkwürdig; doch das ist Sache des Künstlers. Dagegen finde ich die Haltung und Ausführung ganz wundervoll.« Er betrachtete die Figur von allen Seiten und stieg sogar auf eine der Kisten, um sie ganz in der Nähe zu sehen. »Das ist wirklich eine prächtige Erwerbung! Wem verdanken wir sie denn?« Der Generaldirektor wies auf mich. »Ach, da danke ich Ihnen, junger Herr; hoffentlich haben Sie etwas dabei verdient!« »Doch nein,« sagte der Generaldirektor, ich sei ja Beamter der Galerie und mir unterstünde auch die Abteilung der christlichen Plastik, für die der Johannes erworben sei. Dem Kaiser war diese Verwechslung offenbar peinlich. Er fragte mich, ob meine Abteilung nahebei sei; und als ich das bejahte, sagte der Kaiser, trotz dem Einspruch des Adjutanten, daß Vorträge im Schloß angemeldet seien: »Dann kommen Sie, junger Mann, da wollen wir uns Ihre Sachen mal zusammen ansehen!« Er ging selbst voran und fand sofort die nicht sehr zahlreichen Hauptwerke, die wir damals besaßen, aus der Menge des Mittelguts heraus: die Büsten Minos und Benedettos da Majano und die Marietta Strozzi von Desiderio, und machte treffende Bemerkungen darüber. Besondere Freude hatte er an der Mädchenbüste von Mino und an der Marietta. »Hat die aber einen häßlichen, langen Hals.« Ja, es ist eine garstige Büste, urteilte der Herr Minister, worauf der Kaiser sofort erwiderte: »Sie sind ja recht streng heute, lieber P.; was konnte denn der arme Künstler dafür, dass das junge Mädchen solchen Gänsehals hatte! Ich finde die Büste ganz prächtig; sehen Sie nur den Mund! Ich möchte wohl den Witz wissen, den sie gerade machen wollte.« Ein so naives, gesundes Kunsturteil, verbunden mit der wiederholten Versicherung, daß er ja leider nichts von Kunst verstünde, habe ich nur selten bei einem Laien gefunden.
Der Kronprinz – in den traurigen hundert Tagen, in denen er König und Kaiser war, habe ich ihn nicht mehr gesehen – war der häufigste Gast in unseren Sammlungen; oft allein, aber meist mit der Gattin. Für jede Erwerbung, jede Änderung in der Aufstellung und Ausstattung interessierte er sich und ließ uns seine Hilfe dabei angedeihen.
Auf einer Reise in Oberitalien 1875 traf ich das kronprinzliche Paar in Florenz. Später kam ich wieder in Venedig mit ihm zusammen; die Kronprinzessin fuhr täglich mit einigen Künstlern hinaus, um zu aquarellieren, während ich den Cicerone des Kronprinzen in den Kirchen und Sammlungen Venedigs machen mußte. Dieser war bei der Besichtigung stets sehr gründlich. Sein besonderes Interesse erweckte S. Maria dei Miracoli, die köstliche Schöpfung Pietro Lombardis und seiner Söhne, die damals gerade in Restauration war. Wir hatten uns einschließen lassen, um alles in Muße betrachten zu können. Während der Kronprinz die dekorativen Skulpturen im Chor eingehend musterte, war ich auf einer hohen Leiter bis zur Decke hinaufgeklettert, um mir von dem Gerüst aus die sonst kaum erkennbaren Deckenbilder des G. Pennacchi anzusehen. Als der Kronprinz mich oben bemerkte, stieg er mir, trotz meines Abratens, nach. Beim Abstieg erklärte er plötzlich, er werde schwindelig; ich müsse vorangehen, müsse die Sprossen, von denen eine Anzahl fehlten oder lose waren, eine nach der anderen abtasten, sein rechtes Bein fassen und von einer zuverlässigen Stufe auf die andere ziehen, während er selbst nach oben blicken werde, um den Schwindel zu überwinden. Langsam machten wir den gefährlichen Abstieg und kamen ohne Unfall wieder unten an. Ich erwähne dies kleine Abenteuer nur wegen des feinen Taktgefühls, das der Kronprinz dabei bewies. Er half sich aus seiner ersten Verlegenheit mit einem Witz über die Energie, mit der ich ihn bei seinen »königlichen Hammelbeinen gepackt hätte«, blieb aber in seinem Benehmen gegen mich, damals wie später, stets von der gleichen, natürlichen Güte und Sachlichkeit, während mancher andere hohe Herr Leute, die ihn in solcher schwachen Stunde gesehen, nicht gern wieder um sich hätte haben wollen.
Der Kronprinz ist sechzehn Jahre lang der Protektor der königlichen Museen gewesen. Besondere künstlerische Begabung oder Kenntnisse hatte er nicht, prätendierte auch nicht, sie zu haben. Wenn er Vertrauen zu seinen Direktoren gefaßt hatte, so vertrat er ihre Anträge, auch wenn er selbst kein persönliches Verhältnis dazu hatte. Er hat sein Amt mit größter Gewissenhaftigkeit und nicht ermüdendem Eifer verwaltet, trotz aller Schwierigkeiten, die sich ihm dabei entgegenstellten. Denn er hatte wahrlich keine leichte Stellung, weder seinem Vater und Bismarck gegenüber, noch bei seiner Gemahlin. Dies schwächte auch seinen Einfluß bei den Ministern. Er empfand das selbst in hohem Maße; wiederholt hat er mir gesagt: »Warum haben Sie die Sache nicht selbst beim Kaiser vertreten? Mir wird ja doch alles abgelehnt.« Aber er ließ sich dadurch nicht abschrecken; bis auf sein jammervolles Sterbelager hat er pflichtmäßig aller Museumsangelegenheiten sich angenommen. Auch gegenüber – seiner Gattin! Die Kronprinzessin war eine begeisterte Kunstfreundin, ja fast mehr, als es ihre Pflichten erlaubten. Aber ihr Interesse lag mehr auf dem Gebiete der dekorativen als auf dem der hohen Kunst; die Einrichtung ihrer Räume, der Bau ihres Schlosses in Homburg und dessen Ausstattung mit Mobiliar und Kleinkunst war ihre größte Freude. Sie hatte auch die charakteristische Eigenschaft mancher Sammler, neidisch und egoistisch andern Sammlern gegenüber zu sein; auch den Museen gegenüber, trotz der Stellung ihres Gatten als Protektor der Museen. Freilich interessierte sie sich lebhaft für die Ausstattung unserer Museumsräume und für ihre Erweiterung, aber wenn wir eine Erwerbung von Kunstwerken machten, für die auch sie schwärmte, dann trat ihr Sammlerneid in den Vordergrund. Das sprach sie wiederholt ganz offen aus. Gleich im ersten Jahr der Protektorschaft ihres Mannes schenkte sie uns ein Mädchenköpfchen von Grenze, das einer ihrer Kammerherrn in Augsburg um 10 Taler für sie gekauft hatte. Es war stark übermalt; ich ließ es daher putzen, wobei es schön und tadellos zutage kam; zufällig fand ich auch einen passenden, prächtigen Rahmen der Zeit dafür, so daß das Bild sich zwischen unseren wenigen französischen Gemälden sehr gut ausnahm. Lange Jahre später sah es die Kronprinzessin zufällig in der Galerie wieder. »Ist dies nicht das Bild, das ich Ihnen einmal geschenkt habe?« war ihre erstaunte Frage. »Freilich, Majestät,« war meine Antwort; »wir haben das Bild reinigen lassen, wobei sogar zwei echte Bezeichnungen zutage gekommen sind, und haben den schönen Rahmen dafür gefunden, so daß es sich jetzt als echt kaiserliches Geschenk präsentiert.« »Verspotten Sie mich nicht! Glauben Sie, ich werde dem Museum echte Bilder schenken? Die behalte ich doch für mich!« Fast noch krasser sprach sie sich einmal vor der herrlichen Büste der Prinzessin von Urbino aus. Kurz vor dem Tode des Kaisers Friedrich war mir die Erwerbung dieser seit Jahren von uns umworbenen Büste gelungen. Kaiser Friedrich wünschte sie zu sehen, und da ich verreist war, brachte sie Tschudi ins Schloß Charlottenburg; der Kaiser war aber so schwach, daß ihm die Büste nicht gezeigt w erden konnte ; die Kaiserin kam, um sie anzusehen. Unter Tränen warf sie einen Blick darauf und unterbrach ihren traurigen Bericht über den Zustand des Kaisers mit den Worten: »Sie sollten doch nicht immer solche Fälschungen kaufen!« Nicht lange, ehe sie dauernd nach Homburg übersiedelte, um einen ähnlich furchtbaren Tod zu sterben wie ihr Gatte, blieb sie bei einem Besuch des Kaiser-Friedrich-Museums vor dieser Büste stehen. Sie betrachtete sie lange. »Warum ist es mir nie gelungen, ein solches Prachtstück für meine Sammlung zu erwerben?« waren ihre Worte. Ich konnte mich nicht enthalten zu erwidern: »Aber, Eure Majestät haben die Büste ja bei der Erwerbung für eine Fälschung erklärt.« »Weshalb sind Sie immer so boshaft, Bode! Freilich habe ich es damals gesagt, aber können Sie sich denn gar nicht in die Empfindung eines Sammlers hineindenken, dem ein schönes Stück nach dem andern vor der Nase weggeschnappt wird?« Dies nur ein paar Beispiele dafür, dass der Protektor sowohl als wir Direktoren es oft auch da nicht leicht hatten, wo wir Förderung unserer Interessen erwarten durften.
Wilhelm II. hatte von Jugend auf Freude an der Kunst und hat ein dilettantisches Geschick in ihrer Ausübung bewiesen. Er wußte das und wollte diese seine Begabung – wie überhaupt seine vielseitigen großen Anlagen – auch als Herrscher betätigen. Als wir gelegentlich bei ihm anfragten, wen er als Protektor wünsche, erfuhren wir, das sei natürlich er selbst. Aber jahrelang hat er sich als Protektor nur ausnahmsweise betätigt; so gelegentlich bei der Besetzung einer Direktorstelle, um einen ihm sympathischen Lehrer dafür heranzuziehen. Unsere Museumsmaschine lief damals so gut, die Kollegen hatten sich untereinander, mit dem Generaldirektor und dem Minister so gut eingearbeitet, daß es kaum nötig war, an den Protektor heranzutreten; auch konnte der Kaiser bei den schwierigen sozialen, wirtschaftlichen und militärischen Aufgaben, die er sich gestellt hatte und mit Übereifer in Angriff nahm, kaum an die Museen denken. Inzwischen war durch das starke Anwachsen der meisten unserer Sammlungen das Bedürfnis nach Erweiterung der Museumsbauten immer dringlicher geworden. Unser Minister trat warm dafür ein, fiel aber bei dem allmächtigen Finanzminister Miquel, der der Kunst fern stand und in seiner großen Steuerreform nicht gestört sein wollte, vollständig ab. An den Protektor unmittelbar heranzutreten, wagte weder der Generaldirektor noch der Minister. Schließlich versuchte ich es durch Vermittlung der Kaiserin Friedrich; hatte sie doch stets für den Gedanken eines Renaissancemuseums geschwärmt und mir, als ich zusammen mit jüngeren Kollegen einen großen, reich illustrierten Katalog ihrer Sammlung im damals von Ihne gerade vollendeten Schloß Friedrichshof am Taunus anfertigte, die Unterstützung bei der Durchsetzung dieses Museumsbaus als Honorar für jene Arbeit versprochen. Als ich den fertigen Katalog überbrachte, erinnerte ich sie an ihre Zusage, aber sie lehnte schroff ab; ihren Sohn bäte sie um nichts! Der anwesende Hofmarschall, der mich später hinausbegleitete, beruhigte mich jedoch; er würde die Kaiserin bestimmen, noch heute bei Gelegenheit eines Hoffestes dem Kaiser die Notwendigkeit eines Baus zur Erinnerung an die Tätigkeit seines Vaters als Protektors der Museen vorzustellen. Gleich am folgenden Tage bekamen wir die Aufforderung zur Besprechung des Neubaus, für den der Finanzminister die Gelder aus Überschüssen zugesagt hatte, und zu dem Ihne die Pläne machen sollte. Dieser Bau, der alsbald rüstig in Angriff genommen wurde, hat das Interesse des Kaisers für die Museen lebhaft angeregt; bis in den Krieg hinein hat er es sich in gleicher Lebendigkeit erhalten.
Wenn die besondere Aufmerksamkeit des Kaisers auf eine Angelegenheit gelenkt war, pflegte seine starke Phantasie sie lebhaft zu ergreifen und das Bestreben zu eigener Betätigung auszulösen. In unsere Museumsangelegenheiten hat er aber kaum je eigenmächtig eingegriffen. Wenn freilich der Architekt eine monumentalere Lösung vorschlug, wenn Ihne nachträglich noch eine Kuppel auf das Kaiser-Friedrich-Museum aufsetzen wollte, wenn Ludwig Hoffmann die luxuriöseste Ausführung der Inselbauten in Haustein, selbst an der Rückseite und neben der Stadtbahn, wo die Fassaden unsichtbar sind, verlangte, so waren sie der Zustimmung des Kaisers sicher; aber ebenso war er auch für anspruchslose Entwürfe, wie Bruno Pauls Pläne zum Asiatischen Museum in Dahlem, zu haben. Trotz seiner Prachtliebe war er daher auch Vorstellungen gegen unnütze Prachträume, die den Zweck ihrer Bestimmung unmöglich gemacht hätten, wie Hoffmanns riesige Galerien mit hundert Säulen in den Messelbauten, sofort zugänglich. Wenn diese Bauten heute noch weit entfernt sind von ihrer Vollendung und weiter Millionen über Millionen verschlingen, so ist das wahrlich nicht Schuld des Kaisers!
Sooft es sich darum handelte, wertvolle Erwerbungen für die Museen zu machen, wenn durch Ausgrabungen oder Expeditionen in Mesopotamien, Ägypten, Kleinasien oder Turfan unsere Sammlungen oder die archäologische Wissenschaft bereichert werden konnten, hat er sie stets gefördert; wenn durch Vereine – den Kaiser-Friedrich-Museumsverein, den Verein der Freunde antiker Kunst, die Deutsche Orientgesellschaft – den Interessen unserer Museen genutzt werden konnte, hat er sich stets an die Spitze gestellt. Seiner wirksamen Befürwortung verdanken alle Abteilungen unserer Museen hervorragende Erwerbungen, zum Teil von ganzen Sammlungen.
*
In den bald vier Jahren, seit die königlichen Museen zu Staatsmuseen geworden sind, galt es weniger, sie zu mehren und zu erweitern, als Unheil von ihnen abzuwenden. Auch das ist nicht immer gelungen: die Eyckschen Altartafeln sind ohne jeden Anstand den Belgiern ausgeliefert, obgleich sie Krongut sind, und unsere vier frühgotischen Sandsteinfiguren von der Liebfrauenkirche in Trier mußten dem Bischof Korum aus politischen Rücksichten zum Geschenk gemacht werden.
An gutem Willen fehlte es sonst anfangs nicht. Von den Zwillingsministern der ersten Revolutionswochen war die Kunst dem Spartakisten Adolf Hoffmann zugefallen. Ich meldete mich bei ihm, um ihm mein Amt zur Verfügung zu stellen; ich sei zwar kein Politiker, aber den drei Kaisern, unter denen ich gedient hätte, sei ich für ihre Förderung der Museen zu größtem Dank verpflichtet. Hoffmann bat mich dringend, davon abzustehen ; auch die Republik könne und wolle mich nicht entbehren. An Reflektanten auf mein Amt fehle es zwar nicht. »Sehen Sie diesen Haufen Briefe hier neben mir; lauter Bewerbungen um Museumsämter! Jeder hat plötzlich sein republikanisches Herz entdeckt und möchte sein Licht leuchten lassen, jetzt wo der Tyrann beseitigt sei. Na, da lese ich denn man gar nicht weiter, gucke bloß noch auf die Unterschrift, ob der verdienstvolle Mann Meyer oder Müller heißt, lege den Brief zu den andern und sage mir: hast du deinen alten Herrn so leicht verraten, so wirst du ja, wenn es mal wieder anders kommen sollte, den neuen ebenso ruhig verraten.« Ob sich Adolf Hoffmann als Protektor unserer Museen bewährt haben würde, wage ich nach diesen Worten allein nicht zu entscheiden: seine Herrschaft währte zu kurz. Nicht lange nach seinem Abgang schien sich noch einmal den Spartakisten die Aussicht auf Besetzung der preußischen Ministerien zu bieten. Da wir zur Sicherung unserer wiederholt beschossenen und selbst erstürmten Museen dringend einer Wache bedurften, hatte mich unser Minister Haenisch, da der Stadtkommandant Wels auf seine wiederholten Anforderungen eines Wachtkommandos überhaupt nicht antwortete, an seine Freundin Rosa Luxemburg verwiesen, die auf ihren Parteigenossen Einfluß habe. In der Tat bekamen die Museen auf ihre Verwendung sofort eine Wache. Bei der Gelegenheit ließ mir Rosa Luxemburg sagen, sie hoffe bald noch wesentlichere Dienste den Museen erweisen zu können, da ihre Partei in nächster Zeit wieder ans Ruder kommen werde; sie freue sich darauf, dann mit mir zusammen für die Berliner Museen sorgen zu können, für die sie sich mit meiner Hilfe eine neue große Zeit verspreche, Ihr trauriges Ende verhinderte, daß die Probe auf diese großen Worte gemacht werden konnte; daß sie aber nicht bloß eine schöne Geste waren, wie wir damals annahmen, beweist die Behandlung, welche die Museen in Rußland durch die Bolschewiken erfahren haben: sie sind durch alle furchtbaren Stürme hindurch gerettet, die Sammlungen sogar vermehrt worden, und die bewährten Leiter der alten Kaiserzeit stehen heute noch an ihrer Spitze. Das ist freilich nicht so unbegreiflich, wie es auf den ersten Blick erscheint, da manche von den Führern der russischen Sowjets jahrelang als Flüchtlinge in London und Paris lebten und dort ihre Zeit nicht bloß nihilistischen Verschwörungen widmen mochten, sondern manche Mußestunde in den Museen zugebracht haben werden und dabei gelegentlich Freude an der Kunst und selbst Verständnis dafür bekommen konnten. Wie manche dieser Führer war ja auch Rosa Luxemburg russische Jüdin, die lange mit ihren nihilistischen Gesinnungsgenossen in den westlichen Hauptstädten gelebt hat.
Ob ein Adolf Hoffmann, ob eine Rosa Luxemburg als Protektoren unserer Museen sich wirklich bewährt haben würden? – Unser eigentlicher Minister ist seit den Tagen Haenischs – als Unterstaatssekretär, Staatssekretär und vorübergehend auch als Minister – stets Professor Becker gewesen. Er hat junge Fachleute als Referenten für die Kunst berufen, und diese haben es, wie ihr Chef, an Energie nicht fehlen lassen; ob sie aber später einmal als echte Protektoren der Museen dastehen werden, muß erst die Zukunft erweisen.
0 notes
Photo

Um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. Jesaja 53,5
Der elegante Herr, der da vor Pfarrer Wilhelm Busch (1897-1966) sitzt, redet sich immer mehr in Rage: „Ja, ich bin Christ. Und natürlich braucht man Religion, deshalb habe ich meinen Jungen ja auch in den Konfirmationsunterricht geschickt. Jetzt kommt der nach Hause und erzählt mir von Sünde und Schuld und Golgatha. Ist die Kirche nicht weitergekommen, um mittlerweile mehr praktische Lebensweisheiten zu vermitteln? Wer kann denn heute noch etwas mit Golgatha anfangen? Und Sünde - so ein antiquiertes Wort! Wenn damals im Krieg jemand mal etwas versiebte, dann gab es einen Anpfiff - und damit war die Sache vorbei. Sollte Gott das nicht ähnlich sehen?“
Freundlich fragte Wilhelm Busch: „Sie sind doch im Krieg Offizier gewesen. Und da haben Sie alle Leute, die etwas versiebt haben, nur mit einem Anpfiff weggeschickt? Allerhand!“ - „Nein, nein“, sagte der Mann, „wenn einer die Gesetze übertreten hatte, dann wurde er natürlich verurteilt. Es gibt ja ein Recht, und wer das verletzt, der wird verurteilt.“
Da wurde Wilhelm Busch energisch: „Es gibt ein Recht - gerade darum geht es doch! Wer also die Rechte Gottes übertritt, wird verurteilt! Denn Gott ist gerecht. Doch auf Golgatha ist Einer als Bürge für mich eingesprungen und hat das Urteil abgewendet - Jesus Christus! Entweder erkennen Sie also Gottes Urteil an und wenden sich an Den, der als Bürge für Sie eingetreten ist - oder Sie gehen Ihrer Verurteilung bei Gott entgegen!“
Auch heute können viele Menschen mit dem Sühnetod Jesu am Kreuz von Golgatha nichts mehr anfangen. Weil sie nicht verstehen, dass Gott gerecht ist. Und dass sie vor Ihm schuldig geworden sind. Und dass Jesus Christus „um unserer Übertretungen willen“ gelitten hat - auf Golgatha! Aus www.gute-saat.de
0 notes
Text
Frau Holle

Frau Holle - Märchen von Jacob und Wilhelm Grimm

Frau-Holle-Goldmarie Eine Witwe hatte zwei Töchter, die eine war schön und fleißig, und die andere hässlich und faul. Die Frau aber hatte die hässliche und faule, weil sie ihre rechte Tochter war, viel lieber, und die andere musste alle Arbeit tun und der Aschenputtel im Hause sein. Das arme Mädchen musste sich täglich auf die große Strasse bei einem Brunnen hinsetzen, und musste so viel spinnen, dass ihr schon das Blut aus den Fingern drang. Nun trug es sich zu, dass die Spule einmal ganz blutig war. Da bückte sich das Mädchen in den Brunnen und wollte sie abwaschen. Die Spule aber sprang ihr aus der Hand und fiel hinab in die Tiefe. Das Mädchen weinte nun sehr, lief zur Stiefmutter und erzählte ihr das ganze Unglück. Diese aber schalt sie heftig und war ganz unbarmherzig mit ihr. Sie sprach zu ihr: »Du hast du die Spule hinunterfallen lassen, jetzt hol sie auch wieder herauf!« Da ging das Mädchen wieder zum Brunnen zurück und wusste nicht, wie sie es anfangen sollte. Und in seiner Herzensangst sprang das Mädchen schließlich in den Brunnen hinein, um die Spule wieder zu holen. Sie verlor dabei die Besinnung, und als sie erwachte und wieder zu sich selber kam, lag sie auf einer schönen Wiese, wo die Sonne schien und viel tausend Blumen standen. Sie stand auf und ging etwas umher und kam zu einem Backofen, der voller Brot war. Das Brot im Ofen aber rief: »Ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenne ich noch, bin schon längst ausgebacken.« Da trat das Mädchen hinzu, und holte mit dem Brotschieber alles Brot nacheinander heraus. Danach ging es weiter und kam zu einem Baum, der hing voller Äpfel und rief ihr zu: »Ach schüttle mich, schüttle mich, mir sind bereits alle Äpfel reif.« Da schüttelte das Mädchen fest den Baum, dass die Äpfel herunter fielen, als würde es regnen. Sie schüttelte und schüttelte, bis keiner mehr oben war. Und als sie alle Äpfel in einen Haufen zusammengelegt hatte, ging sie wieder weiter. Endlich kam sie zu einem kleinen Haus, aus dem eine alte Frau guckte. Und weil diese so große Zähne hatte, wurde ihr gleich Angst und sie wollte fortlaufen. Die alte Frau aber rief ihr nach: »Was fürchtest du dich, liebes Kind? Bleib bei mir! Wenn du alle Arbeit im Hause ordentlich tun willst, so soll es dir bei mir gut gehen. Du musst nur acht geben, dass du mein Bett immer gut machst und es fleißig aufschüttelst, dass die Federn fliegen. Dann schneit es nämlich in der Welt. Ich bin die Frau Holle.« Und weil ihr die Alte so gut zusprach, fasste sich das Mädchen ein Herz, willigte ein und begab sich in ihren Dienst. Sie besorgte auch alles nach ihrer Zufriedenheit, und schüttelte ihr immer das Bett gewaltig aus, dass die Federn wie Schneeflocken umher flogen. Dafür hatte sie aber auch ein gutes Leben bei ihr. Kein böses Wort fiel und alle Tage hatte sie gesundes Essen. Nun war sie aber schon eine lange Zeit bei der Frau Holle, da wurde das Mädchen traurig und wusste anfangs selbst gar nicht, was ihr fehlte. Endlich merkte sie, dass es einfach nur Heimweh war. Obwohl es ihr bei der Frau Holle viel tausendmal besser ging als zu Hause, so hatte sie doch das Verlangen zurück zu kehren. Endlich sagte sie zur Frau Holle: »Ich habe im Herzen den Jammer nach Haus gekriegt. Und wenn es mir bei dir auch noch so gut geht, so kann ich doch nicht länger bleiben. Ich muss wieder mal zu den Meinigen.« Die Frau Holle antwortete: »Es gefällt mir, dass du wieder nach Hause verlangst, und weil du mir so treu gedient hast, will ich dich auch selbst wieder zurück bringen.« Dann nahm Frau Holle das Mädchen bei der Hand und führte sie vor ein großes Tor. Das Tor ging auf, und wie das Mädchen gerade darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldregen hernieder. Das Gold blieb alles an ihr hängen, so dass sie über und über davon bedeckt war. »Das sollst du haben, weil du immer so fleißig gewesen bist«, sprach die Frau Holle und gab ihr auch die verlorene Spule wieder zurück, die ihr in den Brunnen gefallen war. Darauf war das Tor wieder verschlossen, und das Mädchen befand sich wieder oben auf der Welt, nicht weit weg von zuhaus. Als das Mädchen sodann in den Hof kam, saß der Hahn auf dem Brunnen und rief: »Kikeriki, unsere goldene Jungfrau ist wieder hie.« Dann ging sie ins Haus hinein zu ihrer Mutter, und weil sie mit so viel Gold bedeckt ankam, wurde sie von ihr und der Schwester auch wieder gut aufgenommen. Nun musste das Mädchen alles erzählen, was ihr begegnet war. Und als die Mutter hörte, wie sie zu dem großen Reichtum gekommen war, wollte sie auch der faulen Tochter dasselbe Glück verschaffen. Diese musste sich nun auf den Brunnen setzen und spinnen. Und damit ihre Spule etwas blutig war, stach sie sich mit einem Dorn von der nahen Dornenhecke in den Finger. Dann warf sie die Spule in den Brunnen und sprang sogleich auch selber mit hinein. So kam sie auch, wie das andere Mädchen, auf die schöne Wiese und ging auf dem beschriebenen Weg weiter. Als sie zu dem Backofen gelangte, schrie das Brot: »Ach zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenne ich noch, bin schon längst ausgebacken.« Das faule Mädchen aber antwortete: »Ich habe keine Lust, mich schmutzig zu machen«, und ging einfach fort. Bald kam sie zu dem Apfelbaum, auch der rief wieder: »Schüttle mich, schüttle mich, mir sind alle Äpfel reif geworden.« Die Faule aber antwortete: »Du kommst mir gerade recht. Wenn ich schüttle, könnte mir einer auf den Kopf fallen«, und ging weiter. Als sie vor das Haus der Frau Holle kam, fürchtete sie sich nicht, weil sie ja von ihren großen Zähnen schon gehört hatte, und verdingte sich sogleich zu ihr. Am ersten Tag bemühte sie sich noch, war fleißig und folgte der Frau Holle, wenn sie ihr etwas sagte, denn sie dachte immer an das viele Gold, das sie ihr schenken würde. Am zweiten Tag aber fing sie schon an zu faulenzen, und am dritten Tag noch viel mehr. Da wollte sie morgens schon gar nicht mehr aufstehen. Die Faule machte auch der Frau Holle das Bett nicht, wie sie es hätte machen sollen. Sie schüttelte es nicht und keine Federn flogen davon. Das gefiel der Frau Holle nun gar nicht und sagte ihr den Dienst auf. Die Faule war damit wohl zufrieden und meinte nun, jetzt würde endlich der Goldregen kommen. Die Frau Holle führte auch sie zu dem Tor, und als sie darunter stand, wurde statt des Goldes ein großer Kessel voll mit Pech über ihr ausgeschüttet. »Das ist die Belohnung für deine Dienste«, sagte die Frau Holle und schloss das Tor wieder zu. Als die Faule schließlich heim kam, war sie über und über mit Pech bedeckt, und der Hahn, der auf dem Brunnen saß und sie sah, rief: »Kikeriki, unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hie.« Das Pech aber blieb fest an der Faulen hängen und wollte, solange sie lebte, nicht mehr von ihr abgehen. Frau Holle - Märchen von Jacob und Wilhelm Grimm Read the full article
0 notes
Quote
Der Wunsch, entfernte Weltteile zu besuchen und die Produkte der Tropenwelt in ihrer Heimat zu sehen, ward erst in mir rege, als ich anfing, mich mit Botanik zu besch��ftigen. Bis in mein 17tes und 18tes Jahr waren all meine Wünsche auf meine Heimat beschränkt. So sorgfältig auch unsere literarische Erziehung war, so ward doch alles, was auf Naturkunde und Chemie Bezug hatte, in derselben vernachlässigt. Kleinlich scheinende Umstände haben oft den entschiedensten Einfluss auf ein tätiges Menschenleben, und so muss man die Spuren wichtiger Ereignisse oft in diesen Umständen suchen. Der Hofrat [Ernst Ludwig] Heim, von dem das Gymnostomum heimii den Namen führt und der mit dem jungen [Friedrich Wilhelm Daniel] Muzel lange in Sir Joseph Banks Freundschaft gelebt, war unser Hausarzt. Er hatte eine große Sammlung von Moosen und gab sich eines Tages die Mühe, meinem älteren Bruder die Linnéschen Klassen zu erläutern. Dieser, des Griechischen schon damals kundig, lernte die Namen auswendig, ich klebte Lichen parietinus und Hypna auf Papier, und in wenigen Tagen war uns beiden alle Lust zur Botanik wieder verschwunden. Heim verschaffte unserem Nachbar, dem H[errn Friedrich August] von Burgsdorf, botanischen Ruf, dieser legte dendrologische Sammlungen an. Ich sah dort [Johann Gottlieb] Gleditsch und viele Glieder der Naturforschenden Gesellschaft – krüppelhafte Figuren, deren Bekanntschaft mir ebenfalls mehr Abscheu als Liebe zur Naturkunde einflößte. Meine jugendliche Neigung war von jeher der Soldatenstand gewesen. Meine Eltern hielten mich durch Zwang davon zurück, und man bildete mir ein, dass ich Lust zu dem habe, was man in Deutschland Kameralwissenschaften nennt, eine Weltregierungskunst, die man erst dann versteht, wenn man alles, alles weiß. Dies alles sollte ich bei einem Amtmann lernen, und ein Pachtanschlag wäre dann das Maximum meiner Kameral-Kenntnis gewesen. Ein halbverrückter Gehlehrter, der Prof. [Christian Ernst] Wünsch in Frankfurt an der Oder, las mir ein Privatissimum über [Johann] Beckmanns Ökonomie. Er fing an mit botanischen Vorkenntnissen. Seine eigene Unwissenheit und sein Vortrag waren abermals weit entfernt, mir Lust zur Botanik einzuflößen, doch sah ich ein, dass ich ohne Pflanzenkenntnis ein so vortreffliches Buch als Beckmanns Ökonomie nicht verstehen könne. Wir besaßen durch Zufall Willdenows Florae Berolinensis prodomus. Es war harter Winter. Ich fing an, Pflanzen zu bestimmen, aber die Jahreszeit und der Mangel an Hilfsmitteln machte alle Fortschritte unmöglich. Wir verließen Frankfurt an der Oder, und ich brachte abermals ein Jahr in Berlin zu, wo mich [Johann Friedrich] Zöllner in der Technologie unterrichtete. Ich fühlte aufs Neue die Notwendigkeit botanischer Kenntnisse, quälte mich mit neuem Eifer, Pflanzen nach Willdenows Florae zu bestimmen. Ich legte nun ein förmliches Herbarium an, und da man mir nun zuerst gestattete, allein auszugehen, fasste ich allein den Entschluss, unempfohlen Willdenow selbst aufzusuchen. Von welchen Folgen war dieser Besuch für mein übriges Leben! Schriebe ich ohne diesen diese Zeilen im Königreich Neu-Granada? Ich fand in Willdenow einen jungen Menschen, der damals unendlich mit meinem Wesen harmonierte […] Er bestimmte mir Pflanzen, ich bestürmte ihn mit Besuchen. Ich lernte neue ausländische Pflanzen kennen. Er schenkte mir einen Halm Oryza sativa [eine Reispflanze], den [Carl Peter] Thunberg aus Japan mitgebracht. Ich sah zum ersten Mal in meinem Leben die Palmen des botan[ischen] Gartens, ein unendlicher Hang nach dem Anschauen fremder Produkte erwachte in mir. In drei Wochen war ich ein enthusiastischer Botanist. Willdenow trug sich damals mit der Idee, eine Reise außerhalb Europas zu machen. Ihn zu begleiten, war der Wunsch, der mich tags und nachts beschäftigte. Ich durchlief alle Floren beider Indien [Asien und Amerika], kaufte alle Rinden der Apotheken zusammen, verweilte mit unendlichem Wohlgefallen bei einem Reishalm in meinem Herbarium und gewöhnte mich, unbändige Wünsche nach weiten und unbekannten Dingen zu hegen.
Alexander von Humboldt 1801 in Bogotá über sein erwachendes Interesse für Botanik, Carl Ludwig Willdenow und sein Studium
#alexander von humboldt#mein vielbewegtes leben#o-ton#tagebuch#diary#und wie er über willdenow fanboyt#♥
4 notes
·
View notes
Text
Lange war es ihm nicht vergönnt gewesen
LePenseur:"… die Hitlerei und den totalen Zusammenbruch Deutschlands im Zweiten Weltkriegs zu überleben: schon am 3. Januar 1947 starb er — zum siebzigsten Male jährt sich heute sein Todestag — zu Ichenhausen bei Günzburg, Bayern, in den damaligen Zeitumständen wohl unrettbar verloren, an Lungenkrebs: Ernst Hardt, Schriftsteller, Übersetzer, Theater- und Rundfunkintendant, geboren am 9. Mai 1876 zu Graudenz, in Westpreußen, wie Wikipedia vermerkt. Auch er ein Fall eines „Ein-Stück-Autors“, was sein Überleben in Literaturgeschichten (und nur dort) sichert. Und dabei ist es — auch das ist in solchen Fällen nicht unüblich — keineswegs sein bestes, reifstes Werk, sondern ein inzwischen hoffnungslos veraltetes, und eigentlich schon zur Zeit seiner Entstehung eher zu Kopfschütteln als zu anderem anregendes Stück: „Tantris der Narr“ (mit seiner in geschmäcklerisch überladenem Jugendstil gehaltenen Titel-Vignette Fixstarter in Schulbüchern, um den „Symbolismus“ auch noch für den dümmsten Schüler so recht handgreiflich zu symbolisieren …). Daß es 1908 gleich zwei Schillerpreise (den halben Staats- sowie den Volks-Schillerpreis) erhielt, rettet das Werk nicht: die Handlung holpert, gestelzte Dialoge schleppen sich endlos dahin. Das ganze ist vielleicht noch als üppigstes Ausstattungstheater, das keinen Kulisseneffekt, kein Samtpolster — oh, pardon: keine Sammetpfühle! — ausläßt, um die Figuren in Schönheit sterben zu lassen, inszenierbar, und nur ein symboltrunkener Max Reinhardt (mit wenigstens hundert Schwänen, oder so …) kann eigentlich derlei dramatische Totgeburten retten, die — durch kühne Textkürzungen auf ein Drittel zusammengestrichen — vielleicht als Libretto für eine gewitterschwüle nachromantische Oper à la Schrekers „Schatzgräber“ taugen mögen. Der unbestechliche P. Anselm Salzer spricht über den Dramatiker Ernst Hardt ein fürwahr hartes Verdikt aus: Tantris der Narr (1908) lebt nur von dem Stimmungsreiz der Situation und den sinnlichen bildern der Sprache, in der der alte Sagenstoff gröblich entstellt geboten wird. […] Das Stück ist arm an Bewegung, reich an Stimmung, aber, um diese zum Ausdruck zu bringen, hätte einer der fünf Akte genügt. Verwundert fragt der Zuhörer wie der Leser: „Was ist an dem Drama preiswürdig?“ Etwa die dunkle, sinnbeschwerte Sprache, die jeder Anschaulichkeit entbehrt und der Lüsternheit ein schönes Kleid verleiht? […] Trotz aller an das Perverse streifenden Schwächen hat das Stück, dessen Eindruck einem erotisch-schwülen, die Sinne betäubenden Treibhausdufte gleicht, über fünfzig Auflagen erlebt. (A. Salzer, Illustrierte Geschichte d. Deutschen Literatur, Bd. IV, S. 1668 — wo auch auf den Einfluß durch Eduard Stucken hingewiesen wird) Wie so viele aus seiner Generation war Hardt dem magischen Einfluß Stefan Georges und Hugo von Hofmannsthals erlegen, und hat sich davon lange nicht wieder freimachen können (und vielleicht nicht einmal wollen). Daß er diesen Neigungen als „Mittelpunkt einer Künstlergemeinde“ (wie Wikipedia schreibt) am Hof des kunst- und wissenschaftsfördernden, weltanschaulich freilich sehr konservativen Großherzogs Wilhelm Ernst von Sachsen-Weimar-Eisenach (der aber z.B. seine schützende Hand über den Biologen und „Monisten“ Ernst Haeckel hielt, den sein Großvater und Vorgänger als Professor nach Jena hatte berufen lassen) nachgehen konnte, spricht für eine heute oft übersehene Qualität vieler der „Duodez-Fürsten“ jener Vorkriegsjahre. Nach dem Ersten Weltkrieg engagierte sich Hardt freilich als eher „fortschrittlicher“ Demokrat — und von der Rechten deswegen gleich als Linker, als „Sozi“ denunziert und bekämpft — am ehemaligen Weimarer Hoftheater (dessen Umbenennung in „Deutsches Nationaltheater“ er betrieb), und es war auch auf seinen Vorschlag hin gewesen, daß sich die verfassungsgebende Nationalversammlung in Weimar traf. Ohne Ernst Hardt also keine „Weimarer Republik“ — weiß das eigentlich noch einer? Er war offenbar eine Person, an der man leicht Anstoß nahm, aber auch einer, der Fehden oft und gerne austrug, wenn sie sich anboten. Irgendwann reichte es ihm in Weimar, und auf Empfehlung des damaligen Kölner Oberbürgermeisters Adenauer erhielt er die Intendanz des „Westdeutschen Rundfunks“. Einerseits betrat er als Rundfunkintendant mutig Neuland — denn das Medium war ja quasi „neu geboren“, andererseits brachte er seine Theatererfahrung und sein sensibles künstlerisches Gespür ein, und konnte so Rundfunkarbeit leisten, die in vieler Beziehung anderen Sendern jener Tage voraus war. Daß ein „Hörspiel“ nicht einfach ein „mit verteilten Rollen“ ins Studiomikrophon vorgelesenes Drama ist, erscheint uns heute selbstverständlich — doch das ist es aber dank Ernst Hardt. Rundfunk nicht bloß als „technisches“ Medium, sondern als Herausforderung zu neuen Kunstformen: das von Anfang an zu erkennen war Hardts große Leistung … Daß die Nazis ihn nicht mochten, war vorhersehbar; sie hatten ihn schon vor 1933 auf ihrer schwarzen Liste. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wurde Hardt als Leiter des Westdeutschen Rundfunks „beurlaubt“, erhielt Hausverbot und wurde nach einigen Wochen entlassen… informiert die Wikipedia in ihrem recht detailverliebten Artikel über den Dichter. Sein Schicksal war danach „auf des Messers Schneide“, denn die Nazis versuchten ihm, mit einem Prozeß den Garaus zu machen, verhafteten ihn sogar — allerdings war um 1933/34 die Justiz noch nicht hinreichend „gleichgeschaltet“, als daß eine Anklage in jedem Fall schon die Verurteilung bedeutete. Und in der Tat: in zwei Anklagepunkten wurde Hardt freigesprochen, und dritte wurde stilschweigend fallengelassen. Ernst Hardt suchte um Aufnahme in die „Reichsschrifttumskammer“ nach (ohne das hätte er als Autor nicht tätig sein können), und hielt sich mit Zeitschriftenartikeln und Übersetzungen über Wasser. Daß sogar die Nazis ihm gegenüber etwas schlechtes Gewissen empfanden, ersieht man aus der Tatsache, daß ihm 1938 auf Veranlassung von Hermann Göring eine Abfindungssumme von RM 9.000,00 ausgezahlt wurde — das war zwar nicht die Welt, aber damals doch eine Menge Geld. Sicher waren es auch Persönlichkeiten wie Rudolf G. Binding (der nach Hardts Entlassung im März 1933 einen ebenso feinfühligen wie offenherzigen Brief an ihn richtete) und andere, die von den Nazis aus welchen Gründen immer hofiert (oder wenigstens wohlwollend oder taktisch klug toleriert) wurden, die im Hintergrund so manches für den fast Verfemten „regeln“ konnten. 1945 wollte Ernst Hardt — verständlicherweise — an seine Intendanz beim Westdeutschen Rundfunk anknüpfen. Seine fortschreitende Erkrankung war schneller freilich als die Mühlen der Besatzungsbürokratie. Es blieb ihm aber vergönnt, sein größtes, sein reifstes Werk, die Novelle „Don Hjalmar“ abzuschließen. Buchstäblich an sein Totenbett wurde ihm die erste Auflage dieses Meisterwerkes gebracht (Wolfgang Goetz beschreibt es in seiner wunderbaren Literaturgeschichte „Du und die Literatur“, und brachte mich damit auf die Spur, nach dieser Novelle überhaupt zu suchen — der unlesbare „Tantris“ hätte mich kaum dazu veranlaßt). „Don Hjalmar“ ist — und ich bin mit Superlativen eher vorsichtig — wohl eine der schönsten Novellen, die je in deutscher Sprache verfaßt wurden. Und, lassen wir Goethes klassische „Novelle“ (dem Rang des Dichterfürsten angemessen erlaubt sich kein Vergleich) einmal beiseite, wie viele „große“, wahrlich „vollendete“ Novellen haben wir denn in der deutschen Literatur? Ein paar Handvoll werden es vielleicht sein, aber wohl nicht mehr: so Kleists „Marquise von O...“, einige von C.F. Meyer, Storm, Heyse, aus dem 20. Jahrhundert bspw. einiges von Thomas Mann, Zweigs „Schachnovelle“ oder Bergengruens „Drei Falken“— und meines Erachtens zählt Ernst Hardts Novelle zu diesen „paar Handvoll“. Erzählte Erzählungen haben immer etwas Mißliches, deshalb unterlasse ich die Inhaltsangabe, die — wie bei jedem wirklich bedeutenden Werk — ohnehin nur das Unwesentliche gäbe: den „Inhalt“, die „Handlung“ — als ob es nicht vor allem auf die Behandlung durch den Autor ankäme. Und in diesem Werk weiß man ohnehin recht bald, „wie’s ausgeht“ (denn es wird mit einer umfangreichen „Rückblende“ erzählt), aber das ist (anders als in einem Krimi) doch nicht das Entscheidende an einer Novelle! Das Entscheidende sind die Charaktere, und ihr — eben „Novelle“: möglichst „neuer“, nie dagewesener — Konflikt mit der Situation, in die sie gestellt sind. Nicht nur dem Mimen, nein, auch vielen Autoren flicht die Nachwelt keine Kränze. Und es verwelkt manch zu Lebzeiten geflochtener, und entlaubt sich nur allzu rasch. Doch sei es mir gestattet, mit diesem kleinen Artikel wenigstens ein kleines Lorbeerblatt als Weihegabe zum Totengedenken zu streuen: für den Dichter Ernst Hardt und für seinen „Don Hjalmar“, den man gelesen haben sollte, um moderne Wikinger, Land und Menschen Andalusiens, Atheisten, das Theater, Stierkämpfe … und das Leben überhaupt — verstehen zu können … http://dlvr.it/N1jKSl "
0 notes
Text
When Katrina’s mind snaps back into focus, there’s blood all over her hands. But that isn’t the thing she’s focused on. At the moment, she couldn’t care less. The chill and the still-dying body and her stinging half-healed hands are inconsequential. What matters is the boy she’s currently scrambling back to reach.
“Wilhelm.” Her voice is little more than a breath, and somewhere in the back of her mind she’s sure she looks like a mess, all bloody and shaking. “Hey. Wilhelm. You’re okay. Yeah?”
The cannon goes off. But that might be the boy she’s just finished with, right? If you take the knife out, the person actually bleeds out faster, which is why the knife is still in his head. So he doesn’t bleed out. Because he’s not going to die. It’s not fucking fair.
And then off goes cannon number two. Wilhelm just lays there, staring up at the sky. Not the sky. The fake arena sky. He lays there and nothing happens.
All at once she feels a deep, wrong feeling in everything around her. Sick and angry and painful. If she opens her mouth, she’s not sure if she’ll scream or vomit. Somewhere, behind the loud silence, in the back of her mind, is Johanna’s voice.
They’re watching every second. The more fucked up, the better.
And then in the place of that wrong, burning nothingness comes the immediate feeling of eyes. Like a physical presence, pressing in from all sides, hundreds of people watching. Waiting. Witnessing. And she’s torn in three directions - the part of her that wants to play for the cameras, the part of her that never wants to give them the satisfaction, and the part of her that is still stuck kneeling here staring in horror because Wilhelm is fucking dead. Dead. Nothing will bring him back.
And without even thinking, she settles somewhere in the middle.
Trying not to look, she pulls out the knife, wiping it on the grass before tucking it into her belt. Hands on the sides of his head, she tilts it back the way it was, like he’s laying on his back and looking up at the sky. She brings his hands up to rest over his stomach. She’s getting blood all over him, her hands are practically covered in it, but he would understand. And then, with a shaking hand, she closes his eyes. For a moment she just stares. She could just leave right now. The thought of all those people watching her do this almost makes her run off. Fucking sick pieces of shit. But if she doesn’t say goodbye now, she’ll never get to.
Leaning forward, she presses her forehead to his, eyes closing. One last moment with the boy who seemed to be the last truly good person in the world. The one point of light in all this. There’s the metallic smell of blood, in his hair, on the ground.
“I’m so sorry,” she whispers, in a voice so quiet there’s a chance the Capitol hadn’t heard. Good.
Slowly, she lifts her head, leaving a kiss right above his brow before standing up. She sniffles, wipes the tears from her cheeks. Covering her face with blood in the process. Some of it’s his. And back into the woods she goes.
#hello this is. a dark drabble but i have been thinking of thg katrina and this moment would not leave my mind#so you all get angst :)#blood tw#death tw#injury tw#‘ was sind die chancen ‘ - hunger games verse.#‘ märchenstunde ‘ - drabble.#‘ es sollte mich gewesen ‘ - wilhelm.
4 notes
·
View notes
Text
thinking about how wilhelm and katrina have mirroring but opposite flaws in the way that wilhelm cared too much about others despite all the darkness to the point of self destruction and katrina lets that fear of the darkness isolate her and lead her to self destruction
#[shut up quinn].mun rambles#[AND ALSO how wilhelm joined to put less strain on his family and help them and katrina joined to escape her family#wilhelm was led by hope and compassion and it's not that katrina doesn't have those it's that her cynicism and wariness override them#so she acts out of fear and the want to preserve the things she cares about#anyways. thinking about them#me. knowing that it was me who decided to kill off wilhelm: he shouldn't have died i miss him :( ]#[es sollte mich gewesen].wilhelm#death mention tw
1 note
·
View note
Text
Ohne Sorge - Prolog

”Morgenstimmung” by Splashi
In dieser von der ursprünglichen Geschichte abweichenden Erzählung ist Claire nicht schwanger und geht dementsprechend auch nicht zurück in ihre Zeit. Jamie überlebt die Schlacht von Culloden, wird jedoch gefangen genommen und umgehend in das Gefängnis von Ardsmuir gebracht. Nicht lange danach wird er nach Helwater verlegt, von wo er fliehen kann. Nachdem Jamie und Claire wieder vereint sind, führt ihre Suche nach einem Leben in Freiheit und Frieden sie in ein fremdes Land.
Das ehemalige Gehöft von Wilhelm & Elsa Schnelle April 1749
Claire erwachte als die Sonne gerade aufging. Sie ließ ihre Augen geschlossen. Vorsichtig ließ sie ihre rechte Hand auf die andere Seite des Bettes hinüber wandern und tastete suchend nach Jamie. Ihre Gedanken waren immer noch von ihm und der vergangenen Nacht erfüllt.
Ihr Ehemann hatte früh am Morgen gleich nach dem gemeinsamen Frühstück das Haus verlassen und den ganzen Tag über schwer gearbeitet. Um die Mittagszeit hatte sie Fergus auf das Feld geschickt, damit er Jamie einen Korb mit belegten Broten, zwei Flaschen Wasser und einigen Äpfeln brachte. Jamie war spät am Abend nach Hause gekommen und am liebsten hätte sie es gesehen, wenn er sofort am Abendbrottisch Platz genommen hätte. Doch er hatte darauf bestanden, zuerst sein Werkzeug zu reinigen und nach den Tieren zu sehen. Als er endlich ins Haus kam, hatte sie Fergus bereits auf sein Zimmer geschickt. Als Jamie sich dann in der Küche umsah, antwortete sie auf seine unausgesprochene Frage:
"Er war sehr hungrig. Ich konnte ihn nicht noch länger warten lassen. Er hat zu Abend gegessen und ich habe ihn ins Bett geschickt. Ich habe ihm gesagt, dass er noch so lange lesen darf, bis Du kommst und ihm eine gute Nacht wünscht.“
Jamie nickte und ging hinauf. Fünf Minuten später war er wieder zurück in der Küche.
"Er hat bereits geschlafen. Das Buch lag noch auf seiner Brust. Ich habe ihn zugedeckt und die Nachtlampe außen neben sein Zimmer gehängt.”
"Danke, Jamie. Das sollte jetzt aber Deine letzte Arbeit für heute gewesen sein. Komm’ lass’ uns zu Abend essen."
“Nur noch eine weitere Sache.”
Er zog sie an sich und küsste sie.
Als er sie wieder los lies, lächelte Claire und fragte: "Ist es Arbeit, mich zu küssen?“ "Ja, Sassenach! Dich zu küssen ist die schönste und lohnendste Arbeit, die ich kenne.”
Sie verdrehte die Augen und schüttelte lächelt ihren Kopf. Während Jamie sich setzte und sie einen Topf mit Eintopf auf den Tisch stellte, fragte sie sich, wie er - nach allem, was geschehen war, nach allem Leid und nach allem Schmerz - immer noch der Mann sein konnte, der er war.
Sie aßen in aller Stille, bis Claire sich nicht länger zurückhalten konnte. "Ich hoffe, es schmeckt nicht zu schlecht. Ich wünschte, ich könnte Dir und Fergus besseres Essen servieren. Aber das ist nicht so einfach, wenn man nur so wenige Zutaten hat. Immer nur Rüben, Kohl, Brühe und ein wenig Schinken."
Jamie hörte auf zu essen und nahm ihre Hände. Er sah in ihre Augen und küsste langsam ihre Hände.
“Claire, das wird sich im Verlauf dieses Jahres ändern. Wenn wir erst einmal im Garten und auf den Feldern unsere erste Ernte einbringen, dann werden unsere Mahlzeiten auch abwechslungsreicher. Fergus und ich sind dankbar für alles, was Du für uns tust. Wir wissen, dass Du versuchst das Beste aus dem Wenigen, das wir haben, zu machen. Bitte, mo ghraidh, glaub mir."
"Ich glaube Dir, Jamie, wirklich, es ist nur so … fremd. In der ganzen zeit, in der ich mit meinem Onkel Lamb gereist bin, habe ich mich niemals so fremd gefühlt … Die Landschaft ist fremd, das Essen ist fremd, die Art und Weise, wie die Menschen hier miteinander umgehen, ist mir fremd, alle diese Regeln und Verordnungen sind mir fremd, und dann diese schrecklich harte Sprache … alles ist so fremd.”
Sie seufzte. Jamie, der immer noch ihre Hände hielt, lächelte und versicherte ihr:
"Sassenach, Du hast schon viel größere Herausforderungen gemeistert. Du wirst auch diese Herausforderung meistern. Da bin ich mir ganz sicher. Und vergiss niemals: Wir sind jetzt zu zweit!"
Endlich konnte sie wieder lächeln.
Nachdem sie den Tisch abgewischt hatte, trat er von hinten an sie heran, legte seine Arme um ihre Taille und küsste sanft ihren Nacken. "Ich trage das Abwaschwasser hinaus und schließe das Tor. Dann folge ich Dir in unsere Kammer."
Sie drehte sich um und küsste ihn.
"Hast Du dazu nach all’ der harten Arbeit heute noch Kraft?”
"Ich werde immer Kraft für meine Frau haben, Sassenach,” antwortete er. Dann nahm er die Schale mit dem Abwaschwasser.
"Lass’ mich nicht zu lange warten!“
Ein breites Lächeln war die einzige Antwort, die er ihr gab, bevor er die Küche verließ.
In dieser Nacht liebten sie einander auf behutsame und tröstliche Weise, aber dennoch genauso unglaublich intensiv wie immer. Das Letzte, woran Claire sich erinnerte bevor sie in Jamies Armen einschlief, war seine Stimme, die in verschiedenen fremden Sprachen die Worte ‘Ich liebe Dich’ in ihr Ohr flüsterte.
#OhneSorge#Outlander#Outlander Fan Fiction#Outlander Fan Fiction Deutsch#Claire Beauchamp#Claire Fraser#Jamie Fraser#Fergus Fraser
9 notes
·
View notes
Text
Ringverleihung 2018 – Bericht von Joachim Milberg

Bericht von Prof. Dr. Joachim Milberg (mp3) Bericht von Prof. Dr. Joachim Milberg (pdf) Prof. Dr.-Ing. Dr. E. h. mult. Dr. h. c. mult. Joachim Milberg bei der Verleihung des Werner-von-Siemens-Ringes an Joachim Milberg und Hasso Plattner am 13. Dezember 2018 in Berlin Sehr geehrter Herr Bundespräsident, meine Damen und Herren, während der Laudatio ist mir sehr deutlich geworden, dass es eigentlich leichter ist, einfacher ist, Löbliches zu tun als, sozusagen den Lob für das löbliche Tun zu bekommen, weil eigentlich tut man das Löbliche ja nicht, um gelobt zu werden, sondern aus Freude an der Sache, aus der Gestaltungsmöglichkeit, einfach aus Freude sage ich jetzt mal. Und in diesem Sinne ist es mir eben eine ganz besondere Freude, dass Sie hier heute die Laudatio gehalten haben. Sie haben eben darauf angesprochen, unsere Wege haben sich schon vor längerer Zeit gekreuzt. Es war die Zeit als Sie Kanzleramtsminister waren während der Regierung Schröder. Das Thema Leipzig haben Sie angesprochen. Wir haben in dem Thema „Rat für Wachstum und Innovation“, glaube ich, gemeinsam ein bisschen dafür gekämpft, das Innovationsklima in Deutschland positiv zu gestalten. Und wenn ich so zurückblicke, ich glaube, es ist uns da einiges gelungen. Es ist einiges in Bewegung gekommen. Schon allein deshalb, weil in diese Zeit – und ich rede jetzt über das Jahr 2002 – auch die Gründung von Acatech fällt. Sie waren eine wirklich große Unterstützung gerade in der Anfangsphase dieser Gründung – neben Roman Herzog und Angela Merkel, die uns auch sehr unterstützt haben. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen und das ist, glaube ich, ein guter Anlass auch nochmal ganz herzlichen Dank für diese Starthilfe zu sagen! Ebenso freue ich mich ganz besonders, dass ich diese Ehrung mit Herrn Hasso Plattner zusammen hier genießen darf. Ich erinnere mich nämlich wirklich mit großer Freude an unsere gemeinsame Zeit, wenn ich das jetzt so besitzanzeigend sagen darf, in Ihrem Aufsichtsrat Ihrer SAP. Es war in der Tat eine wirklich sehr inspirierende Zeit. Dafür Danke, aber insbesondere auch an Sie einen ganz herzlichen Glückwunsch! Verehrte Frau von Siemens, lieber Herr Ulrich, ich bedanke mich natürlich ganz besonders beim Stiftungsrat, dass er mir und uns diese Wertschätzung hier zuteilwerden lässt. Und es macht mich in der Tat stolz, mich einreihen zu dürfen in die Reihe derjenigen, die diesen Ring schon bekommen haben. Aber insbesondere macht es mich stolz, auch mit dem Namensgeber dieses Rings, Werner von Siemens, jetzt in einem engerer Zusammenhang genannt zu werden oder genannt werden zu dürfen. Deshalb lassen sie mich kurz auf das Wirken von Werner von Siemens eingehen, mit einigen wenigen Aspekten, die mir in diesem Zusammenhang wichtig sind. Und jetzt versetzten wir uns mal in den Wechsel vom 19. auf das 20. Jahrhundert. Und da muss ich dazusagen: Es war eine Zeit der Aufbruchsstimmung Ende des 19. Jahrhunderts, eine Zeit der Aufbruchsstimmung insbesondere in den Ingenieurwissenschaften. Und es sind dort Grundlagen gelegt worden eigentlich für die Industrienation Deutschland, so wie wir sie heute kennen. Und Werner von Siemens war für mich eigentlich der besondere Repräsentant dieser ganzen Entwicklung, dieser Dynamik, die dort stattgefunden hat. Wir haben schon vieles darüber gehört in den verschiedenen Ansprachen. Er war Technikwissenschaftler, Innovator, Entrepreneur, er war vor allen Dingen auch – das will ich auch noch mal aus meiner Recherche sozusagen in Erinnerung rufen – ein wirklich ganz besonders verantwortungsvoller Unternehmensführer mit all den Werten, die uns heute wichtig sind oder soll ich sagen, wichtig sein sollten. Er war Brückenbauer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zur Gesellschaft hin. Er war Wissenschaftsförderer. Die Physikalisch-Technische Reichsanstalt – heute Bundesanstalt – wäre ohne ihn sicher nicht zu diesem Zeitpunkt und in dieser Ausprägung gekommen. Und was mir jetzt in diesem Zusammenhang wichtig ist: Er hat dafür gekämpft, die Technikwissenschaften als eigenständige, anerkannte Wissenschaft zu etablieren oder zu positionieren. Und ich darf erinnern, dass er 1873 der erste Technikwissenschaftler war, der in die damalige preußische Akademie der Wissenschaften aufgenommen worden ist. Und ich darf zitieren aus seiner Begründung heraus oder seiner Einschätzung heraus. Er hatte nämlich in einem Zusammenhang geschrieben, dass eine Mitgliedschaft erkennen lässt, dass zwar die Ergebnisse der angewandten Wissenschaften gerne genutzt werden, als Mitglied der Akademie aber nur der die reine Wissenschaft Betreibende aufgenommen werde. In Ausnutzung dieser Aufbruchsstimmung in den Technikwissenschaften, die ich versucht habe, ein bisschen anzudeuten, ist dann auch 1899 eine Denkschrift bei Kaiser Wilhelm II. eingereicht worden, doch eine Akademie der Technikwissenschaften zu gründen. Diese Denkschrift wurde umfänglich diskutiert, von der Administration aber abgelehnt mit der Begründung, weil Technik und Techniker nach wie vor als zu weit entfernt vom Zentrum des Geistes galten. Ja. So war das damals. Jetzt sind wir 100 Jahre älter oder etwas mehr als 100 Jahre älter. Und erst ein Jahrhundert später wurde dann durch acatech – die Gründung – die erste nationale Akademie für Technikwissenschaften in Gang gesetzt. Mit viel Unterstützung von vielen Menschen, die hier im Raum sind. Ich könnte jetzt flapsig formulieren: Kaum sind hundert Jahre vergangen auch hat Deutschland eine Akademie für Technikwissenschaften. Meine Damen und Herren, ich habe eingangs von der Freude gesprochen, die mich eigentlich immer begleitet hat bei meiner Arbeit. Für mich war das wirklich ein Schlüssel. Ich hatte immer das große Glück eigentlich immer Dinge tun zu können – jedenfalls meistens – die mir Freude gemacht haben. Und ich hatte auch im Rückblick immer Menschen um mich herum, mit denen es wirklich Freude gemacht hat, zu arbeiten und auch Probleme zu lösen. Menschen, von denen ich auch eine Menge lernen durfte, die mich begleitet in vielfältiger Weise in meinem Berufsleben und in meinem Lebensweg begleitet haben und insbesondere bei dem öfteren Wechsel an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft doch sehr viel Rückendeckung gegeben haben. Und deshalb freue ich mich auch ganz besonders, dass aus allen Phasen dieses Berufslebens Menschen heute hier sind, die mich begleitet haben, die mich unterstützt haben. Mitstreiter aus der Zeit an der TU Berlin, wo ich angefangen habe mit dem Studium und auch meine wissenschaftlichen ersten Schritte getan habe, aus der Zeit an der TU München, Kollegen der wissenschaftlichen Gesellschaft Produktionstechnik, die heute hier sind, Wegbereiter, ganz besonders, und Wegbegleiter von BMW in einer wirklich tollen Zeit und natürlich – last but not least – Mitstreiter aus der Gründungs- und Anfangsphase von acatech. Ein ganz besonderer Dank gilt meiner Familie. Denn ich stand immer auf den Schultern einer kleinen, aber starken Familie und ich glaube, ohne Zustimmung meiner Frau wären so manche Kraftakte, die dahinter stecken, eigentlich gar nicht möglich gewesen. Also, es ist eine Lebensleistung für uns beide! Vielen Dank! Meine Damen und Herren, den Wechsel zwischen Wissenschaft und Wirtschaft mehrfach, gleich mehrfach vollzogen zu haben, empfinde ich nach wie vor als großes Privileg. Und ich glaube, ich habe beruflich wie auch persönlich sehr von diesen mehrfachen Wechseln gezehrt. Denn der Grenzgänger hat einfach die Chance, so zu sagen aus Vorhandenem, was er schon hat, in der neuen Umgebung Neues hinzuzufügen. Ich glaube, aus der Kombination von beiden ergeben sich Dinge, die sich als aus einer alleinigen Überlegung aus einem bestimmten Bereich so gar nicht ergeben hätten. Und das Stichwort ist es eben schon einmal gefallen. Ich verkürzte das einfach. Diese Mehrdimensionalität, die dahinter steckt, hat mir sicherlich auch geholfen, in vielen kritischen Situation, die man ja in seinem Berufsleben auch gelegentlich erlebt, doch etwas sicherer und vernünftigere Entscheidungen zu treffen, um mit komplexen Herausforderungen zurechtzukommen. Deshalb glaube ich, dass Mehrdimensionalität eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, um mit komplexen Situationen gut zurechtzukommen. Und ich möchte deshalb alle auch ermutigen, über die Grenzen zu gehen und verschiedene Blickwinkel sozusagen zu ermöglichen und damit indirekt und direkt auch Brücken zu bauen. Aus dieser Erfahrung heraus ist bei mir auch die Erkenntnis gewachsen, dass ein guter Ingenieur ein Innovator ist, oder zumindest sein sollte. Ich glaub der Innovationsbegriff ist für die Ingenieure für die Ingenieurswissenschaften im Zentrum. Das ist jemand, der in der Lage ist, Theorie und Praxis, Wissenschaft und Wirtschaft auf vernünftige und geschickte Art und Weise mit zu verknüpfen. In den Ingenieurwissenschaften – um das hier nochmal deutlich zu sagen – geht es also nie allein um die Erkenntnis, um den Erkenntnisgewinn. Es geht immer um die Umsetzung, immer um die Anwendung und damit letztlich auch das Hineintragen in den Markt und in die Wirtschaft. Und zurück noch mal zu Werner von Siemens. Dieses Bild des Ingenieurs hat Werner von Siemens vor 150 Jahren, um es mal etwas vereinfacht zu sagen, vorgelebt. Und ich wollte das eigentlich auch immer vorleben. Und ich wollte deshalb auch die Zeit als Hochschullehrer es möglichst an viele junge Menschen weitergeben – die Begeisterung für Innovationen, für das Neue – zumal ich wirklich der festen Überzeugung bin, dass der Wohlstand in Deutschland von Innovationen abhängt. Das würde ich gern noch ein bisschen vertiefen. Das heißt also von vernünftig umgesetzten Ideen, Schumpeter hat in diesem Zusammenhang, wie ich finde, einmal sehr treffend formuliert: Innovation sind die Treiber für jede Volkswirtschaft und entscheiden über Aufstieg und Fall von Nationen. Herr Bundespräsident, sie haben eben das Thema China hingewiesen. Das kann man wirklich nur mit großem Ernst an dieser Stelle noch mal einschieben. Dabei ist der Zusammenhang eigentlich relativ einfach, wie ich finde. Wohlstand braucht Beschäftigung. Beschäftigung braucht Innovation und Innovation braucht Bildung. Daraus folgt aber auch: Innovationen sind kein Selbstzweck. Es geht im Kern eigentlich darum, um die Weiterentwicklung unserer Industriegesellschaft. Das ist ein nicht einfacher Prozess, weil er in einem erheblichen Spannungsfeld stattfindet. Und ich würde das gerne ganz kurz mit drei Polen beschreiben. Auf der einen Seite haben wir die Notwendigkeit natürlich, Ressourcen, Umwelt, Klima so zu behandeln, dass sie nicht unwiderruflich sozusagen verloren gegangen sind und damit Leben vernichtet für unsere Nachfolger. Auf der anderen Seite haben wir aber auch individuelle und kollektive Bedürfnisse der Menschen. Ich meine damit nicht so sehr Konsumbedürfnisse. Ich meine damit Arbeitsplatz, Aufgaben zu haben im Leben, was in aller Regel in unserer Gesellschaft durch einen geeigneten Arbeitsplatz erreicht wird. Und an der dritten Stelle, mein dritter Pol, ist für mich die Notwendigkeit wirtschaftliches Wachstum zu ermöglichen. Wirtschaftliches Wachstum als Basis für nachhaltigen Wohlstand, als Basis für Stabilität, als Basis für Sicherheit in unserer Industriegesellschaft und letztlich darüber hinaus auch als Quelle sozusagen neuer Innovationen aus der Investitionsreserve heraus. Und ich glaube, im Spannungsfeld dieser drei Pole bewegen sich oder sollten sich unsere Diskussionen über die Zukunft unserer Gesellschaft bewegen. Und jede Einseitigkeit der Diskussion führt uns nicht zu einer stabilen Entwicklung. Es geht also in meinen Augen nicht um das Entweder-oder in dieser Diskussion. Es geht um das balancierte Sowohl-als-auch. Diese drei verschiedenen Bereiche, da geht es in meinen Augen darum, tatsächlich in sorgfältiger Balance, situationsbezogen das richtige Optimum zu finden. Und der Schlüssel für mich ist in diesem wirklich anspruchsvollen Prozess der Begriff des Vertrauens. Der Soziologe Luhmann, der vor etwa vierzig Jahren ein kleines aber lesenswertes Büchlein mit dem Titel „Vertrauen“ geschrieben hat, da würde ich jetzt gerne einen kurzen Abschnitt zitieren: “Wo es Vertrauen gibt, gibt es mehr Möglichkeiten des Erlebens und des Handelns. Weil mit Vertrauen eine wirksame Form der Reduktion von Komplexität zur Verfügung steht. Wer Vertrauen erweist, nimmt Zukunft vorweg, handelt so, als ob er der Zukunft sicher wäre. Er überspringt sozusagen die Zeitgrenze. Das ist ein Aspekt. Und für Luhmann ist Vertrauen also ein elementarer Tatbestand des sozialen Lebens. Da Vertrauen aber immer wieder durch Erfolge sozusagen untermauert werden muss und sich bewähren muss, geht er in seiner Beschreibung weiter und kommt zu dem Thema, dass Wahrheit das tragende Element für Vertrauen ist. Sagt er. Dann kann man ja die kritische Frage stellen, wie sieht es denn mit Wahrheit und Vertrauen in unserer Gesellschaft im Moment aus. Derzeit beobachten wir, zumindest aus meiner Sicht, einen deutlichen Verlust an Faktenorientierung und ebenso einen Verlust des Vertrauens in die wirtschaftlichen, politischen, leider auch in die wissenschaftlichen Eliten aus der Sicht der Öffentlichkeit. Manchmal habe ich so den Eindruck, als wenn die Aufklärung irgendwie ein bisschen im Rückzug wäre. Die in jüngster Zeit bekannt gewordenen, prominenten Fälle offensichtlichen Fehlverhaltens – dürfen wir hier auch nicht verschweigen – hat natürlich nochmal diesen Trend dramatisch verstärkt. Und dazu kommt ein weiterhin erschreckender Trend aus meiner Sicht zu vereinfachender Generalisierung, möchte das einfach mal nennen. Und ich finde, vom Vertrauensverlust sind insbesondere Schlüsselindustrien bedroht, die den derzeitigen Wohlstand und damit auch die Stabilität in unserer Gesellschaft und in unserer Volkswirtschaft sichern und darüber hinaus, wenn ich in die Zukunft schaue, auch Technologien, die in Zukunft Sicherheit, Stabilität und auch Wohlstand sichern sollten. Und da kann ich bloß noch mal sagen, Innovationen ohne Vertrauen werden es schwer haben. Denn nur wer Vertrauen hat und Vertrauen weckt, dass die Ergebnisse der gegenwärtigen Innovationstätigkeit auch zu einer besseren, zu einer vernünftigeren Zukunft führen, wird die Handlungsspielräume haben, jetzt innovativ zu sein und etwas Neues zu tun. Das ist für mich ein wesentlicher Punkt. Und ich denke in einem Klima des Misstrauens werden Innovationen es schwer haben in unsere Gesellschaft. Und das ist ein Standortrisiko, auf lange Sicht jedenfalls. So, die Frage ist nun, was ist zu tun. Erster Punkt ist: Wir müssen was tun! Ich glaube nicht, dass wir es laufen lassen sollten, weil ich nämlich nicht glaube, dass sich die Situation von alleine verändern wird oder verbessern wird – schon gleich gar nicht kurzfristig. Das ist natürlich leichter gesagt als getan und ich kann jetzt hier einfach nur vielleicht ein paar Gedanken mal anreißen, über die wir dann vielleicht mal an anderer Stelle weiterdenken müssen. Ich glaube, auf der einen Seite müssen wir erkennen, dass eben nicht nur ökonomische sondern auch ökologische und soziologische Auswirkung von unternehmerische Tätigkeit – aber auch von wissenschaftlicher Tätigkeit, das ist ja ein weiterer Aspekt, der in der letzten Zeit zu erkennen ist – in einer immer zunehmend kritischeren Öffentlichkeit einen immer höheren Stellenwert einnehmen. Ich glaube, dass die Konsequenz daraus sein muss, dass wir viel stärker die Gründe, die Restriktionen, auch die Folgen unseres Handelns gegenüber den Menschen offen legen müssen und dass wir uns allerdings auch an ein als allseits akzeptierten Wertekanon, Verhaltenskodex, halten müssen und Verfehlungen, wenn sie denn stattfinden, als solche auch benennen und mit der richtigen Konsequenz sozusagen überwinden. Wir müssen aus meiner Sicht daran arbeiten, wieder zu einer transparenten, differenzierten, konstruktiv kritischen, öffentlichen Diskussion, zu einem Diskurs zu kommen. Schließlich müssen wir uns ja – und das haben Sie vorhin angesprochen – müssen wir uns als Gesellschaft darüber verständigen: In welcher Zukunft wollen wir eigentlich leben? In diesem Spannungsverhältnis zwischen den drei Polen, die ich eben angesprochen habe: Welche systemische Balance? Und ich betone das Wort systemische Balance, weil wenn ich über Einzelaspekte nur reden könnte: Wollen wir denn eigentlich unsere Zukunft gestalten? Eine einseitige Hegemonie in diesem Dreieck kann sicher nicht zu einer stabilen Zukunft führen. Meine Damen und Herren, auch in Zukunft gilt wohl für unsere Gesellschaft, dass unser wirtschaftliches Wohlergehen auf der Gewinnung und Anwendung naturwissenschaftlichen Wissens und technischen Könnens beruht. Wobei Innovationen ohne Sinn für Systemvertrauen für mich schwer vorstellbar sind auf die Dauer. Und ein Schlüssel dazu ist für mich darüber hinaus: Verantwortliches Handeln. Mit diesen beiden Anmerkung würde ich gern die Brücke wieder schließen, zu Werner von Siemens zurückkommen und auch zu acatech und den Technikwissenschaften. Acatech – und das darf ich in alter Verbundenheit sagen – möchte genau die Brücke zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, durch eine evidenzbasierte und systemische Arbeit schließen und einen Beitrag zu einer Verbesserung der Vertrauensbasis bilden. Nach dem Motto: Nicht nur veröffentlichen – sondern auch verändern! Mir persönlich gibt die Auszeichnung mit dem Werner-von-Siemens-Ring das Bewusstsein, dass es sich auch weiterhin lohnt, über Grenzen zu gehen und Brücken zu bauen. Es wäre für mich auch eine Botschaft, ich glaube dass, wir dieses „über Brücken gehen“, dass man „über Grenzen gehen“ einfach noch viel stärker in unserer Gesellschaft verankert muss, damit wir die Versäulung, die wir doch noch in erheblichem Maße haben, überbrücken können. Lassen sie mich abschließen mit einer Formulierung von Hermann Lübbe, den ich zufälligerweise heute auch im Hotel getroffen habe. Er hat nämlich mal formuliert: In letzter Instanz hängt die Zukunft nicht von ökonomischen, sondern von moralischen Faktoren ab. Zwei dieser Faktoren sind dabei mit Abstand die wichtigsten: Zu wissen was auf dem Spiel steht und Zuversicht. Nun bin ich zuversichtlich, dass wir alle wissen, was auch spielt steht. In diesem Sinne nochmal vielen Dank! Read the full article
0 notes
Text
Kleiner Mann
Was soll ich als kleiner Mann mir Gedanken darüber machen?
"Das Ziel der Wannsee-Konferenz war, alle Maßnahmen zur Durchführung der »Endlösung« zu koordinieren. Zunächst drehte sich die Erörterung um »komplizierte juristische Fragen« wie die Behandlung von Halb- und Vierteljuden: sollten sie getötet oder bloß sterilisiert werden? Danach folgte eine offenherzige Diskussion über die »verschiedenen Arten der Lösungsmöglichkeiten«, auf deutsch, über verschiedene Tötungsmethoden, und auch hierbei herrschte nicht allein »eine freudige Zustimmung allseits«, sondern, wie Eichmann sich deutlich erinnerte, darüber hinaus etwas gänzlich Unerwartetes, ich möchte sagen, sie Übertreffendes und Überbietendes im Hinblick auf die Forderung zur >Endlösung<«. Den außerordentlichen Enthusiasmus teilte vor allem Dr. Wilhelm Stuckart, Staatssekretär im Ministerium des lnnern, der dafür bekannt war, daß er sich gegenüber »radikalen« Parteimaßnahmen sehr zurückhaltend und zögernd verhielt, weil er eben, jedenfalls nach der Aussage von Dr. Hans Globke vor dem Nürnberger Tribunal, ein aufrechter Verfechter von Recht und Gesetz war. Es gab allerdings gewisse Schwierigkeiten. Den Staatssekretär Josef Bühler, damals der zweithöchste Mann im Generalgouvernement, erschreckte die Aussicht, daß Juden vom Westen nach dem Osten evakuiert würden, weil das zusätzliche Juden für die polnischen Gebiete bedeutete, und er schlug vor, diese Evakuierungen hinauszuschieben- es wäre besser, »wenn mit der >Endlösung< dieser Frage im Generalgouvernement begonnen würde, weil hier das... Transport- problem keine übergeordnete Rolle spielt«. Die Herren aus der Wilhelmstraße erschienen mit einem eigenen, sorgfältig ausgearbeiteten Memorandum über »Wünsche und Ideen des Auswärtigen Amtes zur vorgeschlagenen Gesamtlösung der Judenfrage in Europa«, das nicht viel Beachtung fand. Die Hauptsache war, wie Eichmann ganz richtig feststellte, daß die Staatsbeamten der verschiedenen Ressorts nicht nur ihre Meinung äußerten, sondern selbst konkrete Vorschläge machten. Die Sitzung dauerte nicht länger als ein bis anderthalb Stunden, danach wurden Getränke serviert, und man aß gemeinsam zu Mittag- »ein gemütliches Zusammensein«, bei dem sich engere persönliche Kontakte anbahnen sollten. Dieses Treffen war ein sehr wichtiges Ereignis für Eichmann, der noch nie auf einer Gesellschaft gewesen war, »WO derart hohe Persönlichkeiten daran teilnahmen«. Dienstlich wie gesellschaftlich stand er weit unter allen anderen Anwesenden; er hatte die Einladungen verschickt und einige (mit unglaublichen Fehlern gespickte) statistische Angaben für Heydrichs Einleitungsreferat zusammengestellt- elf Millionen Juden waren zu töten, ein Unternehmen von ziemlichen Ausmaßen also-, und später-sollte er dann das Protokoll vorbereiten; kurz, er amtierte als Sekretär der Konferenz. Deshalb durfte er auch, nachdem die Würdenträger des Staates gegangen waren, noch mit seinen Vorgesetzten zusammenbleiben: »ich weiß noch, daß im Anschluß an diese >Wannsee-Konferenz< Heydrich, Müller und meine Wenigkeit an einem Kamin gemütlich saßen..., nicht um zu fachsimpeln, sondern uns nach den langen, anstrengenden Stunden der Ruhe hinzugeben«; und noch im Gefängnis erinnerte sich Eichmann an die allgemeine Zufriedenheit, besonders an Heydrichs gute Laune: »Ich weiß noch ... daß ich Heydrich da zum erstenmal habe rauchen sehen ..., und ich dachte noch, heute raucht Heydrich, was ich sonst nie sah. Er trinkt Kognak, das ich jahrelang nicht gesehen habe, daß Heydrich irgendein alkoholisches Getränk trank.« Noch aus einem anderen Grund war der Tag dieser Konferenz für Eichmann unvergeßlich. Zwar hatte er ohnehin alles getan, um die »Endlösung« auf den Weg zu bringen, gewisse Zweifel »an so einer Gewaltlösung« hatten aber immer noch an ihm genagt, nun jedoch waren diese Zweifel zerstreut. »Hier auf der Wannsee-Konferenz sprachen nun die Prominenten des damaligen Reiches, es befahlen die Päpste.« Jetzt sah er mit eigenen Augen und hörte mit eigenen Ohren, daß nicht nur Hitler, nicht nur Heydrich und die »Sphinx« Müller, nicht allein die SS und die Partei, sondern daß die Elite des guten alten Staatsbeamtentums sich mit allen anderen und untereinander um den Vorzug stritt, bei dieser »gewaltsamen« Angelegenheit in der vordersten Linie zu stehen. »In dem Augenblick hatte ich eine Art Pilatusscher Zufriedenheit in mir verspürt, denn ich fühlte mich bar jeder Schuld.« Wer war er, um sich ein Urteil anzumaßen? Von solcher »Arroganz« war er ganz frei. »Was soll ich als kleiner Mann mir Gedanken darüber machen?« Nun, er war nicht der erste und auch nicht der letzte, der aus Bescheidenheit zu Fall kam."
Hannah Arendt - Eichmann in Jerusalem
0 notes
Text
Fundstück
Wilhelm von Bode: Fünfzig Jahre Museumsarbeit - Kapitel 3
Die Berliner Museen und ihre Protektoren
Jeder kennt die Begründer unserer Sammlungen alter Kunst: Friedrich der Große, der feinsinnige Kunstfreund und erste leidenschaftliche Sammler unter den Hohenzollern, bestimmte seine Galerie in Sanssouci als Kunsttempel für jedermann; Friedrich Wilhelm III. ging weiter, indem er – schon bald nach seinem Regierungsantritt – durch Schinkel Pläne für ein Museum in Berlin entwerfen ließ, das alle plastischen und Gemälde-Schätze aus königlichem Besitz aufnehmen sollte. 1830 wurde der Schinkelsche Bau eröffnet, nachdem inzwischen noch manches erworben war, vor allem die große Galerie Solly mit ihren reichen Schätzen namentlich an Werken des fünfzehnten Jahrhunderts. Während der König der Kunst persönlich nicht näher stand, aber für ihre Förderung im öffentlichen Interesse volles Verständnis hatte, war sein Sohn Friedrich Wilhelm IV. von seltener künstlerischer Begabung; ihm verdankt das Museum auch seine Erweiterung durch das Neue Museum und die Überweisung und Erweiterung des Kupferstichkabinetts und der Kunstkammer, sowie die Begründung der ägyptischen Abteilung und einer großen Sammlung von Gipsabgüssen. Aber um die Gemäldesammlung in ähnlicher Weise zu bereichern wie sein Vater, fehlte es ihm an Entschluß und Ausdauer, Als sein Bruder Wilhelm ihm als König folgte, ließen zunächst innere und äußere Kämpfe nicht an die Förderung der Museen denken. Gefördert konnten sie erst wieder werden, nachdem der Kampf mit Frankreich siegreich ausgefochten war. Gerade damals wurde ich an die Berliner Museen berufen und habe hier seither unter den drei Hohenzollern-Kaisern tätig mitgewirkt und über ihre Stellung zur Kunst, vor allem zu den Berliner Museen, mir ein Urteil bilden können; mit wenigen Worten sei hier angedeutet, welchen Dank die Museen den drei Herrschern schulden, wie jeder dieser unserer Herrscher sich zu ihnen gestellt und in welcher Art er sie gefördert hat.Wilhelm I. war so ausschließlich als Soldat erzogen und so lebhaft für diesen Beruf begeistert, fühlte sich in allen Fragen der Kunst hinter seinem älteren Bruder so weit zurückstehend, daß er sich selbst als völligen Laien betrachtete. Als ernste Fragen der Kunstverwaltung an ihn als Herrscher herantraten, war er ein Greis; sein erstes war daher, daß er diese Sorge seinem Sohn übertrug, indem er ihn Anfang 1872 zum Protektor der königlichen Museen ernannte. In echt staatsmännischem Sinne hat er aber trotzdem die Förderung der Museen sich am Herzen liegen lassen. Die Ausgrabung von Olympia und bald darauf die Ausgrabung von Pergamon fanden seine Billigung und warme Unterstützung; auch für unsere Erwerbungen in der Gemäldegalerie war er interessiert.Ein Besuch, bei dem ich den damals Achtzigjährigen selbst führen durfte, hat mir auch den überraschenden Beweis geliefert, daß der Kaiser infolge seines Mangels an jeder Übung und durch Unterordnung unter seinen älteren Bruder seinen Kunstsinn sehr unterschätzte und sehr mit Unrecht auch im Publikum als Kunstbanause galt. Ich hatte damals Gelegenheit, gerade seine natürliche Begabung für echte Kunst zu beobachten. Die ersten Gruppen des großen Frieses von Pergamon waren angekommen, zu deren Besichtigung der Kaiser mit seiner Suite sich angemeldet hatte. Da am gleichen Tage auch Michelangelos Giovannino aus Pisa eingetroffen war, ließen wir in aller Eile diese Marmorfigur auspacken und auf einer der Kisten im Direktionszimmer aufstellen, für den Fall, daß der Kaiser Zeit und Lust haben sollte, nach den Pergamenischen Reliefs auch diese Figur noch anzusehen. Wir waren eben fertig damit, als der Kaiser eintrat. »Ein Johannes soll das sein? Ich hätte mir ihn anders vorgestellt!« war seine erste Bemerkung. »Ja, es ist eine recht törichte Figur und zudem so unsinnig teuer,« akkompagnierte der mitanwesende Kultusminister. »Da verstehen Sie mich falsch, mein lieber P.«, antwortete der Kaiser; »mir erscheint die Auffassung des Wüstenpredigers als schöner, honignaschender Jüngling recht merkwürdig; doch das ist Sache des Künstlers. Dagegen finde ich die Haltung und Ausführung ganz wundervoll.« Er betrachtete die Figur von allen Seiten und stieg sogar auf eine der Kisten, um sie ganz in der Nähe zu sehen. »Das ist wirklich eine prächtige Erwerbung! Wem verdanken wir sie denn?« Der Generaldirektor wies auf mich. »Ach, da danke ich Ihnen, junger Herr; hoffentlich haben Sie etwas dabei verdient!« »Doch nein,« sagte der Generaldirektor, ich sei ja Beamter der Galerie und mir unterstünde auch die Abteilung der christlichen Plastik, für die der Johannes erworben sei. Dem Kaiser war diese Verwechslung offenbar peinlich. Er fragte mich, ob meine Abteilung nahebei sei; und als ich das bejahte, sagte der Kaiser, trotz dem Einspruch des Adjutanten, daß Vorträge im Schloß angemeldet seien: »Dann kommen Sie, junger Mann, da wollen wir uns Ihre Sachen mal zusammen ansehen!« Er ging selbst voran und fand sofort die nicht sehr zahlreichen Hauptwerke, die wir damals besaßen, aus der Menge des Mittelguts heraus: die Büsten Minos und Benedettos da Majano und die Marietta Strozzi von Desiderio, und machte treffende Bemerkungen darüber. Besondere Freude hatte er an der Mädchenbüste von Mino und an der Marietta. »Hat die aber einen häßlichen, langen Hals.« Ja, es ist eine garstige Büste, urteilte der Herr Minister, worauf der Kaiser sofort erwiderte: »Sie sind ja recht streng heute, lieber P.; was konnte denn der arme Künstler dafür, dass das junge Mädchen solchen Gänsehals hatte! Ich finde die Büste ganz prächtig; sehen Sie nur den Mund! Ich möchte wohl den Witz wissen, den sie gerade machen wollte.« Ein so naives, gesundes Kunsturteil, verbunden mit der wiederholten Versicherung, daß er ja leider nichts von Kunst verstünde, habe ich nur selten bei einem Laien gefunden.Der Kronprinz – in den traurigen hundert Tagen, in denen er König und Kaiser war, habe ich ihn nicht mehr gesehen – war der häufigste Gast in unseren Sammlungen; oft allein, aber meist mit der Gattin. Für jede Erwerbung, jede Änderung in der Aufstellung und Ausstattung interessierte er sich und ließ uns seine Hilfe dabei angedeihen.Auf einer Reise in Oberitalien 1875 traf ich das kronprinzliche Paar in Florenz. Später kam ich wieder in Venedig mit ihm zusammen; die Kronprinzessin fuhr täglich mit einigen Künstlern hinaus, um zu aquarellieren, während ich den Cicerone des Kronprinzen in den Kirchen und Sammlungen Venedigs machen mußte. Dieser war bei der Besichtigung stets sehr gründlich. Sein besonderes Interesse erweckte S. Maria dei Miracoli, die köstliche Schöpfung Pietro Lombardis und seiner Söhne, die damals gerade in Restauration war. Wir hatten uns einschließen lassen, um alles in Muße betrachten zu können. Während der Kronprinz die dekorativen Skulpturen im Chor eingehend musterte, war ich auf einer hohen Leiter bis zur Decke hinaufgeklettert, um mir von dem Gerüst aus die sonst kaum erkennbaren Deckenbilder des G. Pennacchi anzusehen. Als der Kronprinz mich oben bemerkte, stieg er mir, trotz meines Abratens, nach. Beim Abstieg erklärte er plötzlich, er werde schwindelig; ich müsse vorangehen, müsse die Sprossen, von denen eine Anzahl fehlten oder lose waren, eine nach der anderen abtasten, sein rechtes Bein fassen und von einer zuverlässigen Stufe auf die andere ziehen, während er selbst nach oben blicken werde, um den Schwindel zu überwinden. Langsam machten wir den gefährlichen Abstieg und kamen ohne Unfall wieder unten an. Ich erwähne dies kleine Abenteuer nur wegen des feinen Taktgefühls, das der Kronprinz dabei bewies. Er half sich aus seiner ersten Verlegenheit mit einem Witz über die Energie, mit der ich ihn bei seinen »königlichen Hammelbeinen gepackt hätte«, blieb aber in seinem Benehmen gegen mich, damals wie später, stets von der gleichen, natürlichen Güte und Sachlichkeit, während mancher andere hohe Herr Leute, die ihn in solcher schwachen Stunde gesehen, nicht gern wieder um sich hätte haben wollen.Der Kronprinz ist sechzehn Jahre lang der Protektor der königlichen Museen gewesen. Besondere künstlerische Begabung oder Kenntnisse hatte er nicht, prätendierte auch nicht, sie zu haben. Wenn er Vertrauen zu seinen Direktoren gefaßt hatte, so vertrat er ihre Anträge, auch wenn er selbst kein persönliches Verhältnis dazu hatte. Er hat sein Amt mit größter Gewissenhaftigkeit und nicht ermüdendem Eifer verwaltet, trotz aller Schwierigkeiten, die sich ihm dabei entgegenstellten. Denn er hatte wahrlich keine leichte Stellung, weder seinem Vater und Bismarck gegenüber, noch bei seiner Gemahlin. Dies schwächte auch seinen Einfluß bei den Ministern. Er empfand das selbst in hohem Maße; wiederholt hat er mir gesagt: »Warum haben Sie die Sache nicht selbst beim Kaiser vertreten? Mir wird ja doch alles abgelehnt.« Aber er ließ sich dadurch nicht abschrecken; bis auf sein jammervolles Sterbelager hat er pflichtmäßig aller Museumsangelegenheiten sich angenommen. Auch gegenüber – seiner Gattin! Die Kronprinzessin war eine begeisterte Kunstfreundin, ja fast mehr, als es ihre Pflichten erlaubten. Aber ihr Interesse lag mehr auf dem Gebiete der dekorativen als auf dem der hohen Kunst; die Einrichtung ihrer Räume, der Bau ihres Schlosses in Homburg und dessen Ausstattung mit Mobiliar und Kleinkunst war ihre größte Freude. Sie hatte auch die charakteristische Eigenschaft mancher Sammler, neidisch und egoistisch andern Sammlern gegenüber zu sein; auch den Museen gegenüber, trotz der Stellung ihres Gatten als Protektor der Museen. Freilich interessierte sie sich lebhaft für die Ausstattung unserer Museumsräume und für ihre Erweiterung, aber wenn wir eine Erwerbung von Kunstwerken machten, für die auch sie schwärmte, dann trat ihr Sammlerneid in den Vordergrund. Das sprach sie wiederholt ganz offen aus. Gleich im ersten Jahr der Protektorschaft ihres Mannes schenkte sie uns ein Mädchenköpfchen von Grenze, das einer ihrer Kammerherrn in Augsburg um 10 Taler für sie gekauft hatte. Es war stark übermalt; ich ließ es daher putzen, wobei es schön und tadellos zutage kam; zufällig fand ich auch einen passenden, prächtigen Rahmen der Zeit dafür, so daß das Bild sich zwischen unseren wenigen französischen Gemälden sehr gut ausnahm. Lange Jahre später sah es die Kronprinzessin zufällig in der Galerie wieder. »Ist dies nicht das Bild, das ich Ihnen einmal geschenkt habe?« war ihre erstaunte Frage. »Freilich, Majestät,« war meine Antwort; »wir haben das Bild reinigen lassen, wobei sogar zwei echte Bezeichnungen zutage gekommen sind, und haben den schönen Rahmen dafür gefunden, so daß es sich jetzt als echt kaiserliches Geschenk präsentiert.« »Verspotten Sie mich nicht! Glauben Sie, ich werde dem Museum echte Bilder schenken? Die behalte ich doch für mich!« Fast noch krasser sprach sie sich einmal vor der herrlichen Büste der Prinzessin von Urbino aus. Kurz vor dem Tode des Kaisers Friedrich war mir die Erwerbung dieser seit Jahren von uns umworbenen Büste gelungen. Kaiser Friedrich wünschte sie zu sehen, und da ich verreist war, brachte sie Tschudi ins Schloß Charlottenburg; der Kaiser war aber so schwach, daß ihm die Büste nicht gezeigt w erden konnte ; die Kaiserin kam, um sie anzusehen. Unter Tränen warf sie einen Blick darauf und unterbrach ihren traurigen Bericht über den Zustand des Kaisers mit den Worten: »Sie sollten doch nicht immer solche Fälschungen kaufen!« Nicht lange, ehe sie dauernd nach Homburg übersiedelte, um einen ähnlich furchtbaren Tod zu sterben wie ihr Gatte, blieb sie bei einem Besuch des Kaiser-Friedrich-Museums vor dieser Büste stehen. Sie betrachtete sie lange. »Warum ist es mir nie gelungen, ein solches Prachtstück für meine Sammlung zu erwerben?« waren ihre Worte. Ich konnte mich nicht enthalten zu erwidern: »Aber, Eure Majestät haben die Büste ja bei der Erwerbung für eine Fälschung erklärt.« »Weshalb sind Sie immer so boshaft, Bode! Freilich habe ich es damals gesagt, aber können Sie sich denn gar nicht in die Empfindung eines Sammlers hineindenken, dem ein schönes Stück nach dem andern vor der Nase weggeschnappt wird?« Dies nur ein paar Beispiele dafür, dass der Protektor sowohl als wir Direktoren es oft auch da nicht leicht hatten, wo wir Förderung unserer Interessen erwarten durften.Wilhelm II. hatte von Jugend auf Freude an der Kunst und hat ein dilettantisches Geschick in ihrer Ausübung bewiesen. Er wußte das und wollte diese seine Begabung – wie überhaupt seine vielseitigen großen Anlagen – auch als Herrscher betätigen. Als wir gelegentlich bei ihm anfragten, wen er als Protektor wünsche, erfuhren wir, das sei natürlich er selbst. Aber jahrelang hat er sich als Protektor nur ausnahmsweise betätigt; so gelegentlich bei der Besetzung einer Direktorstelle, um einen ihm sympathischen Lehrer dafür heranzuziehen. Unsere Museumsmaschine lief damals so gut, die Kollegen hatten sich untereinander, mit dem Generaldirektor und dem Minister so gut eingearbeitet, daß es kaum nötig war, an den Protektor heranzutreten; auch konnte der Kaiser bei den schwierigen sozialen, wirtschaftlichen und militärischen Aufgaben, die er sich gestellt hatte und mit Übereifer in Angriff nahm, kaum an die Museen denken. Inzwischen war durch das starke Anwachsen der meisten unserer Sammlungen das Bedürfnis nach Erweiterung der Museumsbauten immer dringlicher geworden. Unser Minister trat warm dafür ein, fiel aber bei dem allmächtigen Finanzminister Miquel, der der Kunst fern stand und in seiner großen Steuerreform nicht gestört sein wollte, vollständig ab. An den Protektor unmittelbar heranzutreten, wagte weder der Generaldirektor noch der Minister. Schließlich versuchte ich es durch Vermittlung der Kaiserin Friedrich; hatte sie doch stets für den Gedanken eines Renaissancemuseums geschwärmt und mir, als ich zusammen mit jüngeren Kollegen einen großen, reich illustrierten Katalog ihrer Sammlung im damals von Ihne gerade vollendeten Schloß Friedrichshof am Taunus anfertigte, die Unterstützung bei der Durchsetzung dieses Museumsbaus als Honorar für jene Arbeit versprochen. Als ich den fertigen Katalog überbrachte, erinnerte ich sie an ihre Zusage, aber sie lehnte schroff ab; ihren Sohn bäte sie um nichts! Der anwesende Hofmarschall, der mich später hinausbegleitete, beruhigte mich jedoch; er würde die Kaiserin bestimmen, noch heute bei Gelegenheit eines Hoffestes dem Kaiser die Notwendigkeit eines Baus zur Erinnerung an die Tätigkeit seines Vaters als Protektors der Museen vorzustellen. Gleich am folgenden Tage bekamen wir die Aufforderung zur Besprechung des Neubaus, für den der Finanzminister die Gelder aus Überschüssen zugesagt hatte, und zu dem Ihne die Pläne machen sollte. Dieser Bau, der alsbald rüstig in Angriff genommen wurde, hat das Interesse des Kaisers für die Museen lebhaft angeregt; bis in den Krieg hinein hat er es sich in gleicher Lebendigkeit erhalten.Wenn die besondere Aufmerksamkeit des Kaisers auf eine Angelegenheit gelenkt war, pflegte seine starke Phantasie sie lebhaft zu ergreifen und das Bestreben zu eigener Betätigung auszulösen. In unsere Museumsangelegenheiten hat er aber kaum je eigenmächtig eingegriffen. Wenn freilich der Architekt eine monumentalere Lösung vorschlug, wenn Ihne nachträglich noch eine Kuppel auf das Kaiser-Friedrich-Museum aufsetzen wollte, wenn Ludwig Hoffmann die luxuriöseste Ausführung der Inselbauten in Haustein, selbst an der Rückseite und neben der Stadtbahn, wo die Fassaden unsichtbar sind, verlangte, so waren sie der Zustimmung des Kaisers sicher; aber ebenso war er auch für anspruchslose Entwürfe, wie Bruno Pauls Pläne zum Asiatischen Museum in Dahlem, zu haben. Trotz seiner Prachtliebe war er daher auch Vorstellungen gegen unnütze Prachträume, die den Zweck ihrer Bestimmung unmöglich gemacht hätten, wie Hoffmanns riesige Galerien mit hundert Säulen in den Messelbauten, sofort zugänglich. Wenn diese Bauten heute noch weit entfernt sind von ihrer Vollendung und weiter Millionen über Millionen verschlingen, so ist das wahrlich nicht Schuld des Kaisers!Sooft es sich darum handelte, wertvolle Erwerbungen für die Museen zu machen, wenn durch Ausgrabungen oder Expeditionen in Mesopotamien, Ägypten, Kleinasien oder Turfan unsere Sammlungen oder die archäologische Wissenschaft bereichert werden konnten, hat er sie stets gefördert; wenn durch Vereine – den Kaiser-Friedrich-Museumsverein, den Verein der Freunde antiker Kunst, die Deutsche Orientgesellschaft – den Interessen unserer Museen genutzt werden konnte, hat er sich stets an die Spitze gestellt. Seiner wirksamen Befürwortung verdanken alle Abteilungen unserer Museen hervorragende Erwerbungen, zum Teil von ganzen Sammlungen.*In den bald vier Jahren, seit die königlichen Museen zu Staatsmuseen geworden sind, galt es weniger, sie zu mehren und zu erweitern, als Unheil von ihnen abzuwenden. Auch das ist nicht immer gelungen: die Eyckschen Altartafeln sind ohne jeden Anstand den Belgiern ausgeliefert, obgleich sie Krongut sind, und unsere vier frühgotischen Sandsteinfiguren von der Liebfrauenkirche in Trier mußten dem Bischof Korum aus politischen Rücksichten zum Geschenk gemacht werden.An gutem Willen fehlte es sonst anfangs nicht. Von den Zwillingsministern der ersten Revolutionswochen war die Kunst dem Spartakisten Adolf Hoffmann zugefallen. Ich meldete mich bei ihm, um ihm mein Amt zur Verfügung zu stellen; ich sei zwar kein Politiker, aber den drei Kaisern, unter denen ich gedient hätte, sei ich für ihre Förderung der Museen zu größtem Dank verpflichtet. Hoffmann bat mich dringend, davon abzustehen ; auch die Republik könne und wolle mich nicht entbehren. An Reflektanten auf mein Amt fehle es zwar nicht. »Sehen Sie diesen Haufen Briefe hier neben mir; lauter Bewerbungen um Museumsämter! Jeder hat plötzlich sein republikanisches Herz entdeckt und möchte sein Licht leuchten lassen, jetzt wo der Tyrann beseitigt sei. Na, da lese ich denn man gar nicht weiter, gucke bloß noch auf die Unterschrift, ob der verdienstvolle Mann Meyer oder Müller heißt, lege den Brief zu den andern und sage mir: hast du deinen alten Herrn so leicht verraten, so wirst du ja, wenn es mal wieder anders kommen sollte, den neuen ebenso ruhig verraten.« Ob sich Adolf Hoffmann als Protektor unserer Museen bewährt haben würde, wage ich nach diesen Worten allein nicht zu entscheiden: seine Herrschaft währte zu kurz. Nicht lange nach seinem Abgang schien sich noch einmal den Spartakisten die Aussicht auf Besetzung der preußischen Ministerien zu bieten. Da wir zur Sicherung unserer wiederholt beschossenen und selbst erstürmten Museen dringend einer Wache bedurften, hatte mich unser Minister Haenisch, da der Stadtkommandant Wels auf seine wiederholten Anforderungen eines Wachtkommandos überhaupt nicht antwortete, an seine Freundin Rosa Luxemburg verwiesen, die auf ihren Parteigenossen Einfluß habe. In der Tat bekamen die Museen auf ihre Verwendung sofort eine Wache. Bei der Gelegenheit ließ mir Rosa Luxemburg sagen, sie hoffe bald noch wesentlichere Dienste den Museen erweisen zu können, da ihre Partei in nächster Zeit wieder ans Ruder kommen werde; sie freue sich darauf, dann mit mir zusammen für die Berliner Museen sorgen zu können, für die sie sich mit meiner Hilfe eine neue große Zeit verspreche, Ihr trauriges Ende verhinderte, daß die Probe auf diese großen Worte gemacht werden konnte; daß sie aber nicht bloß eine schöne Geste waren, wie wir damals annahmen, beweist die Behandlung, welche die Museen in Rußland durch die Bolschewiken erfahren haben: sie sind durch alle furchtbaren Stürme hindurch gerettet, die Sammlungen sogar vermehrt worden, und die bewährten Leiter der alten Kaiserzeit stehen heute noch an ihrer Spitze. Das ist freilich nicht so unbegreiflich, wie es auf den ersten Blick erscheint, da manche von den Führern der russischen Sowjets jahrelang als Flüchtlinge in London und Paris lebten und dort ihre Zeit nicht bloß nihilistischen Verschwörungen widmen mochten, sondern manche Mußestunde in den Museen zugebracht haben werden und dabei gelegentlich Freude an der Kunst und selbst Verständnis dafür bekommen konnten. Wie manche dieser Führer war ja auch Rosa Luxemburg russische Jüdin, die lange mit ihren nihilistischen Gesinnungsgenossen in den westlichen Hauptstädten gelebt hat.Ob ein Adolf Hoffmann, ob eine Rosa Luxemburg als Protektoren unserer Museen sich wirklich bewährt haben würden? – Unser eigentlicher Minister ist seit den Tagen Haenischs – als Unterstaatssekretär, Staatssekretär und vorübergehend auch als Minister – stets Professor Becker gewesen. Er hat junge Fachleute als Referenten für die Kunst berufen, und diese haben es, wie ihr Chef, an Energie nicht fehlen lassen; ob sie aber später einmal als echte Protektoren der Museen dastehen werden, muß erst die Zukunft erweisen.
0 notes