#verfassungsblog
Explore tagged Tumblr posts
Text
Falls jemand was lesen möchte zu den politikwissenschaftlichen Erkenntnissen & Einschätzungen zur Fall der "Brandmauer" und wie das zur Normalisierung, Legitimierung, & Erfolg von rechten Parteien führt:
"Die Konsequenzen der Normalisierung und Legitimierung der radikalen Rechten gehen allerdings weit über die Parteienpolitik hinaus. Auch wenn die radikale Rechte noch nicht in Regierungsverantwortung ist wie in den USA, in Italien oder Ungarn, führt ihre Präsenz und Stärke, ihre größere Akzeptanz bereits zu einer Erosion basaler Prinzipien der liberalen Demokratie. Indirekt, weil andere Parteien zunehmend vor inklusiver Politik zurückschrecken, weil Grundrechte und rechtstaatliche Prinzipien in Frage gestellt werden, weil Bekenntnisse zur liberalen internationalen Ordnung ausbleiben. Direkt, weil sich Kräfte Rechtsaußen ermächtigt fühlen. Es folgen zunehmende Bedrohungen, Einschüchterungen und Gewalt gegen Minderheiten und diejenigen, die sich für eine andere Politik einsetzen. All das ist diese Woche etwas mehr Teil deutscher Realität geworden. Dazu haben Friedrich Merz und Christian Lindner fundamental beigetragen."
5 notes
·
View notes
Text
Thüringen: Aus gegebenem Anlass...
#Thüringen: Aus gegebenem Anlass...
…muss man feststellen, dass das, was aktuell in Thüringen geschehen ist und geschieht, einen Vorlauf hat und viele öffentliche Warnungen vor dem, was auf uns zukommt. Während die CDU Thüringen sich Anfang des Jahres weigerte, die notwendigen Schritte gegen die sich abzeichnende Gefahren einer “Hardball”-Strategie der Rechtsextremen in Thüringen umzusetzen. Das war “extrem unklug”, lese ich –…
0 notes
Text
Am Montag nach der Bundestagswahl kam es bei den "Omas gegen Rechts" zu erhöhtem Datenverkehr und infolgedessen zu erhöhtem Puls. "Wir waren sprachlos und sauer. Und jede von uns merkte: Unsere Arbeit wird nötig bleiben in der nächsten Zeit, es wird irgendwie immer schlimmer", schildert Kerstin Neurohr, Mitglied im "Orga-Team der Omas gegen Rechts in Neustadt an der Weinstraße". Vor erst einem Jahr gegründet, haben sich mittlerweile 230 Frauen der Gruppe angeschlossen.
Grund für ihren Ärger: Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hatte am ersten Tag nach der gewonnenen Bundestagswahl ein parlamentarisches Mittel zur Kontrolle der Bundesregierung genutzt, die sogenannte Kleine Anfrage. Unter den 551 Fragen an die Bundesregierung tauchen auch 24 Fragen zu den "Omas gegen Rechts" auf, ein "besonders umstrittenes Beispiel" für staatliche Förderung.
Es fallen Begriffe wie "Schattenstruktur", indirektes Politik-Betreiben mit Hilfe staatlicher Gelder oder "ein Verstoß gegen die demokratische Grundordnung". Eine Frage lautet: "Wurde der Verein Omas gegen Rechts Deutschland e. V. in der Vergangenheit wegen parteipolitischer Betätigung abgemahnt oder verwarnt?"
[...]
Zusammen mit sieben weiteren "Omas gegen Rechts" wandte [Kerstin Neurohr] sich umgehend in einem Offenen Brief an die örtliche CDU.
[...]
In dem Offenen Brief schreiben sie: "Wir sehen darin den Versuch, uns als demokratische, zivilgesellschaftliche Bewegung zu delegitimieren und unsere Arbeit zu diskreditieren, indem man den Missbrauch von Zuwendungen aus Steuergeldern zur einseitigen politischen Agitation unterstellt." Die Anfrage suggeriere, ihr Engagement stelle eine Gefahr für die Demokratie dar. Das sei "nicht nur falsch, sondern geradezu absurd": Sie engagierten sich gegen die antidemokratischen und rechtsextremen Strömungen, die den Rechtsstaat zerstören wollen.
Unionspolitiker wie der Landesvorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder, können diese Reaktion nicht nachvollziehen. "Es geht um Transparenz in der Haushaltsführung: Die Bundesregierung soll begründen, für welche Projekte Millionenbeträge aufgewandt worden sind", erklärt Schnieder.
Er sieht sich durch die Reaktionen eher bestätigt. "Wenn die aus einer bestimmten Richtung jetzt sehr laut rufen, dann waren die Fragestellungen doch ganz schön richtig. Lassen wir doch die Antworten mal kommen. Wenn alles in Ordnung ist, dann ist das Ding doch erledigt."
[...]
Für Verfassungsrechtler wie Sophie Schönberger, Professorin für Öffentliches Recht an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, stellen solche Fragen die genannten Organisationen an den Pranger und schüren gezielt Verdachtsmomente. "Aus der verschwörungsideologischen Szene, zu der das Geraune von den 'Schattenstrukturen' in der Einleitung ja durchaus gewisse Bezüge herstellt, ist der Mechanismus gut bekannt", erklärt Schönberger.
Es seien in Fragen verpackte Falschaussagen, "die die verschwörungsideologischen Falschbehauptungen nicht als Tatsachen aufstellen, aber über die Frageform doch sehr hartnäckig insinuieren", schreibt Schönberger beim "Verfassungsblog".
Mit den indirekten Unterstellungen und ihrer Wirkung, schlecht ins Licht der Öffentlichkeit gezogen zu werden, eignen sich die Fragen laut Schönberg dazu, die entsprechenden Vereinigungen in ihrer Meinungsfreiheit und ihrer Tätigkeit einzuschüchtern. So seien weite Teile der Kleinen Anfrage vom parlamentarischen Fragerecht nicht gedeckt.
"Zum Schutz der Grundrechte der betroffenen Vereinigungen hätte die Bundestagspräsidentin die Anfrage daher in dieser Form zurückweisen müssen und nicht veröffentlichen dürfen", folgert Schönberg.
6 notes
·
View notes
Text

Letter/ Sein lassen
Extended Version eines Beitrages vom Verfassungsblog
1.
Manchmal sagen Leute: Lass gut sein. Meist sagen Leute so etwas, um ein Gespräch oder ein Tun und Machen zu beenden. Klage nicht, gehe nicht in Berufung, gehe nicht in Revision. Bemühe den Gesetzgeber nicht! gehe nicht zum Anwalt! Lass' gut sein. Ruf das Gericht nicht weiter an, lass gut sein. Dränge nicht mehr, rüttel nicht mehr am Zaun, lasse die Löcher so, wie sie sind.
Don’t call me, I’ll call you - ruft dann ein Gesetz. Si vocat ito.
Ich unterstelle, dass das ein guter, nämlich ambuiger Rat ist. Sicher kann ein guter Rat böse Folgen haben, etwa dann, wenn jemand nicht auf den guten Rat hört oder er aber, wenn er doch darauf hört, der Rat aber in der falschen Lage gegeben wurde. Unterstellt sei es dennoch, dass der Rat, etwas sein zu lassen gut ist, sogar der beste Rat, weil er ambuige ist. Das Gute und Beste des Sein-Lassens mag dann für den, der weiter reden und weiter etwas tun und machen will, einen Mangel offenbaren, das ambuige kann eine Leere und ein Lehre offenbaren, einen Riss, der ein Entwurf ist, eine bare und bloße Tracht, die lacht, wie eine Tracht Lachen und eine Tracht Prügel in einem.
Man kann frustriert sein, dass die Moral des Gut-Sein-Lassens zwar eine ambuige Antwort ist, aber keine weiteren Antworten folgen. Warte! Der Mangel, der sich in solchen Augenblicken offenbart, muss nicht der eigene Mangel sein, er kann es aber sein. Sprich: Man kann diesen Mangel persönlich nehmen, muss es aber nicht. Jemand ruft: Lass‘ gut sein! Man ruft vielleicht zurück: Für mich ist aber gar nichts gut! Und die Stimme ruft eventuell noch einmal zurück: Dann lass gut sein! Oder sie schweigt. Warte! (Er-)Warte! Die lehrhafte Leere der Institutionen ist eine Sirene.
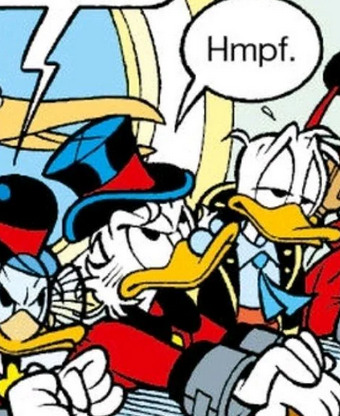
„Hmpf“ könnte man im Comic dann schreiben. Man könnte seufzen: Ach, och, ich…
2.
Was stimmt an den Stimmen solcher lehrhaften Leeren, solcher Sirenen, was am Stimmen? Darf man sagen, jemand solle etwas gut sein lassen, wenn es ihm offensichtlich nicht gut ist? Darf man selber Sirene wie bei Kafka sein? Darf man, nach dem man von dem Rat frustriert ist, noch seufzen?
Kommt drauf an. Es gibt dazu viel Antworten, etwa aus dem Komplex der praktischen Lehren zum Gesetz und zu seinen Triebfedern. Denn in dem Moment, in dem so sanft und bestimmt jemand ruft: Lass gut sein – spricht etwas zu uns, als ob ein Gesetz sprechen würde.
Ein Gesetz, das den Trieb zum Sprechen und Machen und Tun stillen soll und das manchmal funktioniert und manchmal nicht, das spricht manchmal zu uns, durch Briefe oder Buchstaben: Letter, durch Mahle und klamme Sendungen. Manchmal triggert der Ruf eines solchen Gesetzes, es gut sein zu lassen, manchmal nicht. Wie kommt es?
3.
Bester Rat ist ambuige und damit kompliziert – und man kann versuchen, sich dem dem besten Rat mit Ratschlägen von Immanuel Kant und Kommentaren von Alenka Zupančič zu nähern.
Denn eins scheint ratsam: Es ist immer ratsam, mehrere, mindestens zwei Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Es ist ratsam, technisch sein Können also so einzurichten, dass man auf den Ruf, es sein zu lassen, es sein lässt oder aber nicht sein lässt, ruhig weiter drängt oder aber sich weiter bedrängen, also von dem Ruf triggern lässt.
Alles hat nämlich Vor- und Nachteile. Es hat Vor- und Nachteile, sich von einem Ruf des Gesetzes stillen, also still stellen zu lassen. Es hat Vor- und Nachteile, die Triebfedern ruhen zu lassen. Es hat Vor- und Nachteile, sich nichts sagen zu lassen von einem Gesetz. Es hat Vor- und Nachteile, seine Triebfedern in Schwung zu bringen, sie aufwirbeln zu lassen und die Triebfedern wieder sinken zu lassen, wie nach einer Kissenschlacht.
Die Ruhe hat Vor- und Nachteile. Und die Unruhe hat Vor- und Nachteile.
Schlechthin überhaupt
Was schlägt Kant für den Fall vor, dass man gesagt bekommt, etwas sein zu lassen? Er schlägt auch vor, lässig zu sein. Kants Lässigkeit erschließt sich in einem ersten Absatz der Kritik der praktischen Vernunft – das ist wieder eine Lässigkeit, die einen auf die Palme bringen kann und schon genug Leute, vielleicht auch Kleist, auf die Palme und ins Wasser gebracht hat.
In der Vorrede, im ersten Absatz, erklärt Kant, warum seine Kritik nicht eine Kritik der reinen praktischen, sondern schlechthin der praktischen Vernunft überhaupt betitelt sei.
Der Halbsatz, in dem auf den ersten Blick unklar sein mag, was von halben Sätzen allgemeiner und weiter sein soll, weist darauf hin, dass der Leser etwas von prakltischer Vernunft schlechthin überhaupt zu lesen bekommt, nicht von nur reiner und nur praktischer Vernunft. Wäre die reine praktische Vernunft weiter, allgemeiner oder größer als die praktische Vernunft, oder wäre die reine Vernunft kleiner, besonderer und eingeschränkter? Oder ist es genau andersherum, dass die praktische Vernunft größer, weiter oder allgemeiner ist, also die reine Version davon? Macht die Reinigung der Vernunft mehr Platz, eröffnet sie mehr Spielraum? Oder wird die Kammer dieser Vernunft dadurch kleiner? Das sind Fragen für Clousseau und für Thrakerinnen, die gerne lachen.
Schlechthin, überhaupt: Mit den zwei Wörtern, die Kant verwendet, mag man glauben, dass Kant Präferenzen offenlegt. Aber was meint Kant mit „schlechthin“ und „überhaupt“? Mehr oder weniger? Im ersten Halbsatz bleibt ein Verhältnis offen. Sprich: Hier tut sich etwas auf, eine Scheide, hier wird eine Differenz operationalisiert, nämlich die zwischen der reinen praktischen Vernunft und der praktischen Vernunft.
Und man erfährt im ersten Halbsatz nicht, als was diese Differenz operationalisiert wird. Als Gegensatz? Als Widerspruch? Als Paar? Als Rivalen? Als Konkurrenz? Im zweiten Halbsatz spricht Kant von einem „Parallelism“, bezieht dies komplizierte Wort aber auf die praktische Vernunft und auf die spekulative Vernunft. Parallelen berühren sich nicht, sagt man, wenn sie nicht im Unendlichen liegen. Kant lässt hier schon etwas. Er ist hier schon lässig und lässt nämlich etwas offen, und schon diese erste offensichtliche Lässigkeit kann den einen oder anderen auf die Palme bringen.
Es geht weiter in diesem Absatz. Kant verspricht hinreichenden Aufschluss. Lässigkeit zur Geduld ist gefragt. Worüber Aufschluss? Über die Frage, warum eben von praktischer Vernunft die Rede ist. Kant gibt aber keinen Aufschluss darüber, inwieweit ein solcher Satz mit einem „nur“ zu ergänzen wäre. Lässigkeit ist gefragt, ob mit oder ohne Geduld.
Was einige Leser auch auf die Palme bringen kann, das ist das, was noch im ersten Absatz folgt. Kant erklärt, er wolle bloß dartun, dass es reine praktische Vernunft gebe, darum kritisiere er ihr ganzes praktisches Vermögen. Wenn das gelinge, bedürfe es keiner Kritik des reinen Vermögens. Dazu stellt Kant eine weitere Bedingung auf: Es ginge nur darum, zu sehen, „ob sich die Vernunft mit einem solchen, als einer bloßen Anmaßung, nicht übersteige.“ So, spekuliert Kant gleich darauf, geschehe es wohl mit der spekulativen Vernunft. Das ist hart. Hier fordert Kant schon dem Leser einiges ab. Was verlangt er ihnen ab? Erstmal weiter lesen.
„Denn wenn sie, als reine Vernunft, wirklich praktisch ist, so beweiset sie ihre und ihrer Begriffe Realität durch die Tat, und alles Vernünfteln wider die Möglichkeit es zu sein, ist vergeblich.“
Die reine Vernunft muss nicht kritisiert werden, wenn sie praktisch ist. Erwartest du zuviel, zuviel Reinheit von der Vernunft und ihren Gesetzen? Jetzt kann man Kants Rat so lesen: Sei lässig, erwarte nicht zu viel von der Vernunft, der Reinheit und den Gesetzen. Die Reinheit kann eine Leere sein. Die Lehre kann die Leere sein. Achte auf die Praxis, auf die Wirklichkeit. Alle Vernunft, aufgebracht gegen eine praktische Vernunft, verkümmert zum Vernünfteln. Das Reine lässt sich nicht beschmutzen – du kannst noch so schmutzige Gedanken entwickeln, das liegt dann an Deinem Vernünfteln. Bringt dich ein Widerstreit der Vernunft in Rage, sei vernünftig, vernünftel nicht. Lass gut sein. Realwidersprüche, unlösbare Probleme? Wie entwickelt man in Anbetracht von Realwidersprüchen und unlösbaren Problemen Lässigkeit?
Vernünftel nicht, sei praktisch. Du rufst aber noch weiter nach dem Gesetz, das die Realwidersprüche auflöst? Don’t call me, I will call you. Das ist Leere/ Lehre.
Hashem, so sagen die Gebrüder Coen wesentlich später, does not owe you anything. The obligation runs the other way. Du willst etwas vom Gesetz? Selbst schuld. Das, auch das Gesetz, sagt dir nichts? Selbst schuld. Die Widersprüche in der Realität und im Realen lassen Dir keine Ruhe? Lass gut sein. Man kann das als unerbittlich und pedantisch bezeichnen. Das wären Reaktionen der Leser, eventuell affektiv.
Dieser erste Absatz von Kant ist eine Eröffnung. Hier eröffnet er die Kritik der praktischen Vernunft, er verschließt sie nicht. Er präsentiert Differenzen, mit denen man umgehen können sollte, unter anderem diejenigen zwischen Reinheit und Praxis und die zwischen Vernunft und Vernünfteln. Und manche bringt es in Rage, dass sich diese Öffnung nicht schließen lässt. Sei lässig, lass los, von mir aus auch Kant, denn um den geht es doch gar nicht. Du musst das Buch nicht lesen, wenn es dir nicht hilft. Kalter Kant. Aber lässig.
Zupančičs Lässigkeit
Viele Jahre nach der Erscheinung von Kants Kritik der praktischen Vernunft schreibt Alenka Zupančič ein Buch, in dem es auch um Kant, seine Gesetze und seine Triebfedern geht. Das Buch ist nicht so bekannt wie Kants Kritik. Es heißt: „Das Reale einer Illusion“ – und die Begriffe des Realen und der Illusion werden dort technisch verwendet, sie stammen aus dem Horizont einer auch psychoanalytisch informierten Normwissenschaft.
Obschon im Untertitel ein Text über Kant und Lacan versprochen wird, kommt die Autorin erst auf Friedrich Nietzsche zu sprechen. Und hier tut sich wieder etwas auf, man kann sagen, zu einem Abgrund, der schon mit Kants Eröffnung zu tun hat.
Die Traditition, in der sie steht, legt immer gleich offen, dass es ihr im Kontext der Normativität nicht nur um Gründe, sondern auch um Abgründe geht. Man kann die Frage stellen, ob dies nicht bei Kant auch schon der Fall sei, ob das nicht auch eine Normativität sei, die Gründe und Abgründe überspanne. Liefert Kant nicht immer auch (Ab-)Gründe, wenn er Normen liefert? Darum wird gestritten. Darüber wird gestritten. Damit wird gestritten. Es gibt bei Kant die braven Leser, ich sage mal metaphorisch: nationalen Lesarten, und dann gibt es die mutigeren Lesarten, in denen auch so etwas wie Alienation/ Fremde/ Befremden mitgelesen wird. Unsere Gründe, die können uns fremd sein.
Wozu in diesem Kontext Nietzsche? Zupančič erinnert an eine Formulierung von dem Baseler Archäologen. Die Menschheit wolle eher das Nichts, als nichts zu wollen.
Sie historisiert diese Formulierung und fragt, ob das nicht heute anders sein. Ist der aktive Nihilismus, der noch in dem Satz von Nietzsche steckt, nicht entschärft? Habe er nicht seine Unbändigkeit verloren? Die Menschheit, behauptet Z., will heute eher nichts als das Nichts. Wir seien danach in der Phase einer „Ethik des Nicht-Wollens“. Diese Ethik lege uns nahe, anzunehmen, zu tolerieren, einzugestehen. Lass gut sein, jetzt im Sinne von: Nimm die Lage an! Toleriere! Gestehe Dir ein, etwa, dass die Welt mangelhaft ist und du es nicht ändern kannst. Really?
So lässig ist Z. nicht. Sie geht weiter, das ist ja nur die Eröffnung des Buches. Ihre Historisierung Nietzsches fußt auf der Vorstellung, dass die Ethik in den Dienst des Lebens gestellt sei, man also ohne weiteres voraussetze, dass das Leben geschützt werden müsse und vorzüglich oder vorzuziehen sei, und zwar gegenüber dem Tod. Die Bewahrung des Lebens als solche werde als löblich betrachtet, sagt Zupančič, und sie lässt darin schon eine Distanz aufscheinen, gegenüber dieser Ethik des Lebens.
Warum, fragt sie sich, soll man etwa den Todestrieb ausschließen, zumal er ja nicht einfach Trieb zum Tode sei, sondern Trieb zu etwas, was man mehr wolle als den Tod und das gegenüber dem Tod völlig indifferent sein könne, man nehme ihn in Kauf. Das Nichts zu wollen könne bedeuten, eine dunkle Katastrophe zu wollen. Es könne aber auch bedeuten, zu begehren, und das könne ein Motor sein, das Unmögliche ins Mögliche zu verwandeln. Nichts ist nicht, noch nicht. Warten wir es ab. Es gibt kein gutes Flüchtlingsrecht? Es gibt keine gutes Recht zur Flucht oder zur Migration? Das kann ja noch werden. Man kann begehren, was nicht ist, man kann das Nichts begehren. Genug Leute sagen, dass man nur das Nichts begehren könne.
Aber Z. insistiert auf ihre Fassung der Geschichte. Heute, so behauptet sie in dem Text von 2001, könne man genau die Schließung eines Spielraums beobachten. Es gibt, so kann man das lesen, keine Alternative zum Leben. Alle sollen leben, nichts und niemand soll drauf gehen. Es gäbe zwei Möglichkeiten, das zu verstehen. Man solle, wie Lacan das deutet, aufgefordert werden, von seinem Begehren abzulassen. Oder aber das Begehren werde selbst schlicht unmöglich, es gäbe gar keinen Spielraum mehr, keinen Mangel, kein Offenes, an dem sich das Begehren entzünden kann, so kann man das lesen.
„Das ist die Frage“ – so schließt Z. nach weiteren Ausführungen jenes Kapitel, das mit Nietzsche eröffnet wurde um zu Kant, zu seinem Gesetz und seinen Triebfedern zu kommen. Es gibt danach Ausführungen zum Pathologischen – auch im kantianischen Sinne, der unter der Pathologie nicht das Kranke oder Abnormale verstand, sondern ein Drängen, Ziehen oder Stoßen. Triebfedern sind pathologisch, die treiben an, zum Gesetz und erzeugen eine triebhafte Normativität, Alltag nach Kant. Das darin auch so etwas wie mindere Jurisprudenz liegt, also eine Normativität der Triebe, der Emotionen, der Affekte, des Unbegriffenen, des Flüchtigen, des Niederen, des Animalischen, des Instinktiven, des Transgressiven, des Gewaltigen, des Überwältigenden, das wird ja schon lange reflektiert – nicht erst seit den modernen und postmodernen Kritiken der Vernunft. Schon zwischen Dogmatikern und Rhetorikern gibt es einen Streit, inwieweit man im Kampf ums Recht auf Schein und Effekte setzen darf. Darf man bluffen und blaffen? Ist es redlich, Effekte einzusetzen? Darf die Zeugin ihre Aussage trainieren, und sei es der Einsatz von Tränen, von denen einige glauben, dass sie nicht lügen würden? Darf man Bilder von Kindern in Käfigen zeigen, um ein bestimmtes Recht einzufordern, oder ist das gleich emotionale Erpressung oder aber Instrumentalisierung? Nicht nur zwischen den beiden (rhetorischen und dogmatischen) Epistemologien wird darum gestritten. Auch in der Dogmatik, nämlich im unterschiedlichen Verständnis, was Dogmatik eigentlich sei ( Scheinwissenschaft oder begrifflich-systematische Wissenschaft oder aber beides) tauchen solche Fragen auf. Darf die Dogmatik mit Bildern oder ohne operieren, kann sie das überhaupt frei entscheiden? Oh je, tut sich hier viel auf. So leer und so voll das Recht.
Lass gut sein, ein guter Rat, aber eben nur ein guter Rat. Er (er-)öffnet etwas, auch die Gründe zu den Abgründen hin. Eine Frage richtig zu stellen ist oftmals viel wichtiger, als die Antwort darauf zu geben. Man solle gute Fragen nicht durch Antworten zerstören, so ein Rat geben Leerheitslehrer wie John Cage. And the answer? It’s in its cage.
Letter
Letter sind minore Objekte, die lassen, indem sie gelassen sind. Letter sind Mahle und klamme Sendungen, zum Beispiel Buchstaben und Briefe.
2 notes
·
View notes
Text
UN Special Rapporteur Francesca Albanese #DoubleStandard #FreeSpeech #Censorship #Silencing #Ziolobby: Where Is Our Outcry?
Facts and evidence speak for themselves, exposing the core issue, enabling genocide, in violation of practically all applicable laws, domestic and international, as any objective analysis of the innocent victims can’t avoid, leading to the inexplicable conclusion, the emperor is naked, it’s high time to stop obfuscating and to engage and enforce the law and stop this ongoing GENOCIDE. #BDS
Where Is Our Outcry? | Isabel Feichtner | Verfassungsblog | 19 Feb 2025 Liebes deutsches Völkerrecht, dear colleagues, We are not always on the best of terms. Nonetheless, I feel the need to write to you. I know you are busy. You have books to write, conferences to organize, funding applications to finalize and all these emails and requests piling up. Yet, I would appreciate if you could spare…

View On WordPress
0 notes
Text

Klage gegen Bayerns Bundeswehrfördergesetz
Gegen Militarisierung von Bildung und Forschung
Gegen das bayerische Bundeswehrfördergesetz haben eine große Anzahl an Bürgerinitiativen und ca. 200 Einzelpersonen eine Popularklage vor dem Verfassungsgerichtshof in Bayern eingereicht. Beim Erwerb von Wissen und dem Studium des Wissens vergangener Generationen wollen wir nicht durch militärische Strukturen und die Unternehmen der Rüstungsindustrie bestimmt werden.
Der 40 Jahre vom Verfassungsschutz unrechtmäßig beobachtete und verfolgte Publizist Dr. Rolf Gössner hat uns die Pressemitteilung der Kläger (veröffentlicht von der GEW) zugeschickt, die wir hiermit in Auszügen weiterleiten.
Die Popularklage richtet sich gegen die seit 2024 gesetzlich verordnete Militarisierung eines überaus bedeutsamen zivilen staatlich-gesellschaftlichen Sektors mit großer Tiefen- und Breitenwirkung: Es handelt sich um die Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsinstitutionen und -bereiche in Bayern, die hiervon unmittelbar und tiefgreifend betroffen sind. Denn 2024 ist in Bayern das „Bundeswehrfördergesetz“ in Kraft getreten, mit dem diese Militarisierung per Gesetz vorangetrieben wird:
Damit werden Schulen, Hochschulen, Unis und Forschungseinrichtungen angehalten, teils verpflichtet, enger mit der Bundeswehr zu kooperieren, mit dem Ziel, "ungehinderten Zugang der Bundeswehr zu Forschung und Entwicklung an den Hochschulen sicherzustellen“ und "ihren Zutritt zu Schulen zu erleichtern".
Eine Beschränkung der Forschung auf rein zivile Nutzung, wie sie sog. Zivilklauseln regeln, ist nun gesetzlich verboten. Sämtliche Forschungsprojekte und -ergebnisse sollen nun auch für militärische Zwecke offen stehen und genutzt werden können.
Schulen sollen „im Rahmen politischer Bildung“ enger mit "Jugendoffizieren" zusammenarbeiten sowie zur/„beruflichen Orientierung“ von Schüler:innen mit Karriereberatern der Bundeswehr.
Womöglich werden andere Bundesländer diesem Pilotprojekt folgen, worauf manches hindeutet.
Hunderte klagen gegen Verbot von Zivilklauseln an Hochschulen und gegen Bundeswehr im Klassenzimmer
Am Bayerischen Verfassungsgerichtshof wurde am 5. Februar 2025 im Namen von 200 Kläger*innen Popularklage gegen das „Gesetz zur Förderung der Bundeswehr in Bayern“ eingereicht. Die Klagenden sehen u.a. die Wissenschaftsfreiheit und das Friedensgebot in Gefahr. Das Bündnis aus Jurist*innen, Wissenschaftler*innen, Kirchen und Verbänden spricht sich gegen eine weitere Militarisierung von Schulen und Universitäten aus.
Im Vorfeld der Bundestagswahlen berichtet das Nachrichtenportal Bloomberg am 1.02.2025 über Forderungen der deutschen Rüstungsunternehmen Hensoldt und Rheinmetall, die an vielen deutschen Universitäten verankerten „Zivilklauseln“ abzuschaffen. Bloomberg stellt fest, dass der mögliche nächste Bundeskanzler Merz (CDU) schon jetzt erklärt hat, freiwillige Verpflichtungen von Universitäten, nur für friedliche Zwecke zu forschen, abschaffen zu wollen.
Dazu Martina Borgendale, Vorsitzende der GEW Bayern: "In Bayern sind Zivilklauseln bereits seit der Einführung des Gesetzes zur Förderung der Bundeswehr im August letzten Jahres verboten. Die Bildungsgewerkschaft GEW in Bayern hat gegenüber dem Gesetzgeber in einer ausführlichen Stellungnahme Argumente gegen dieses Verbot dargelegt, die jedoch keine Berücksichtigung im Gesetzgebungsprozess gefunden haben. Auch die von der GEW Bayern und der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) Bayern gesammelten mehr als 1.500 Unterschriften für eine Petition an den Bayerischen Landtag haben keine Änderungen am Vorhaben des Verbots von Zivilklauseln erwirken können. Deswegen klagen wir jetzt."
... In einem Artikel, welcher am 29. Januar in Kooperation mit dem „Max Planck Institute for the Study of Crime, Security and Law“ beim Verfassungsblog erschien, werden grundsätzliche Zweifel an dem bayerischen Gesetz ausgeführt. ... Die nächste Ausgabe des jährlich erscheinenden Grundrechte-Reports, die am 21. Mai in Berlin vorgestellt wird, wird sich ebenfalls mit dem bayerischen Gesetz auseinandersetzen.
Grund für die gesteigerte Aufmerksamkeit ist nicht nur der Eingriff in die Hochschulautonomie, Wissenschafts- und Forschungsfreiheit, sondern auch der Zugriff der Jugendoffizier*innen der Bundeswehr auf Schulen, der im Gesetz nun zwingend vorgegeben wird. Bisher konnten Schulen bzw. Lehrkräfte selbst entscheiden, ob sie die Bundeswehr in ihre Klassenzimmer einladen oder nicht. Aktuell ist mehr als jede zehnte Person bei der Rekrutierung minderjährig. Zudem wurde 2024 mit 2.203 rekrutierten Minderjährigen ein trauriger Höchststand erreicht.
Die Kläger*innen befürchten, dass durch den De-facto-Werbeeinsatz der Uniformierten im Unterricht der jährlich steigende Anteil minderjähriger Soldat*innen noch weiter zunehmen wird. Minderjährige sind in der Bundeswehr teilweise schweren Kinderrechtsverletzungen ausgesetzt, z. B. sexueller Gewalt, erniedrigender Behandlung, körperlichen und seelischen Schäden u. v. m. Deutschland missachtet damit die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen und die mehrmaligen Ermahnungen der UN gegenüber der Bundesregierung. Das bayerische Bundeswehrförderungsgesetz manifestiert und befördert diese untragbare Entwicklung. ...
Zu den Kläger*innen zählen u.a. der Mitherausgeber des jährlichen „Grundrechte-Report - zur Lage der Bürger- und Menschenrechte in Deutschland“ Dr. Rolf Gössner, der Friedensforscher und Professor für internationale und intergesellschaftliche Beziehungen und Außenpolitik Dr. Werner Ruf, die ehemalige Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages Dr. Margot Käßmann, der Musiker und Autor Konstantin Wecker. Unterstützt wird die Klage von Verbänden wie der Vereinigung Demokratischer Juristinnen und Juristen (VDJ), dem Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dem Bund für Geistesfreiheit, dem Münchner Freidenker-Verband e. V., der deutschen Sektion der Internationalen Katholischen Friedensbewegung – pax christi, dem Nürnberger Evangelischen Forum für den Frieden e. V., dem Friedensmuseum Nürnberg e. V. sowie dem bayerischen Landesverband der Partei Die Linke.
Mehr dazu bei https://www.gew-bayern.de/presse/detailseite/hunderte-klagen-gegen-verbot-von-zivilklauseln-an-hochschulen-und-gegen-bundeswehr-im-klassenzimmer und die Klageschrift https://cloud.gew-bayern.de/s/bmcfMxe6LgDiJ3n
Kategorie[18]: Pressemitteilungen Short-Link dieser Seite: a-fsa.de/d/3Fs Link zu dieser Seite: https://www.aktion-freiheitstattangst.org/de/articles/9059-20250213-klage-gegen-bayerns-bundeswehrfoerdergesetz.html
#Klage#Bayern#SchuleohneMilitär#GEW#Gössner#NATO#Atomwaffen#Militär#Bundeswehr#Aufrüstung#Waffenexporte#Drohnen#Frieden#Krieg#Friedenserziehung#Menschenrechte#Zivilklauseln
1 note
·
View note
Text
The Transformation of European Climate Litigation
https://justifiable.fr/?p=1429 https://justifiable.fr/?p=1429 #Climate #European #Litigation #Transformation Présentation de l’éditeur In Spring 2024, the European Court of Human Rights ruled for the first time that inadequate climate mitigation violates human rights. The Court’s landmark rulings have significant implications, ranging from the design of domestic climate laws and questions of standing to international trade issues and the European Union’s climate governance. Building on a symposium by Verfassungsblog and the Climate Law Blog, this book offers the first comprehensive assessment of the rulings in KlimaSeniorinnen, Duarte Agostinho, and Carême. It explores key innovations, missed opportunities, and the untaken paths in European climate litigation. Source link JUSTIFIABLE s’enrichit avec une nouvelle catégorie dédiée à l’Histoire du droit, alimentée par le flux RSS de univ-droit.fr. Cette section propose des articles approfondis et régulièrement mis à jour sur l’évolution des systèmes juridiques, les grandes doctrines, et les événements marquants qui ont façonné le droit contemporain. Ce nouvel espace est pensé pour les professionnels, les étudiants, et les passionnés d’histoire juridique, en quête de ressources fiables et structurées pour mieux comprendre les fondements et l’évolution des normes juridiques. Plongez dès maintenant dans cette catégorie pour explorer le passé et enrichir vos connaissances juridiques.
0 notes
Text
0 notes
Text
Der Demokratieverächter Carl Schmitt lässt grüßen
Tichy:»Der angesichts anhaltend hoher Umfragewerte der AfD geführte „Kampf gegen Rechts“ der etablierten Parteien hat neben den Medien, den Verbänden, den Kirchen und den zahlreichen NGOs inzwischen einen weiteren Mitstreiter gefunden. Es handelt sich um den von dem Juristen und Journalisten Maximilian Steinbeis im Jahr 2009 gegründeten „Verfassungsblog“, in dem lange Zeit vorrangig verfassungsrechtliche Fragen Der Beitrag Der Demokratieverächter Carl Schmitt lässt grüßen erschien zuerst auf Tichys Einblick. http://dlvr.it/T5vRYn «
0 notes
Quote
BigTech companies from the US, such as Meta and Alphabet, and from Europe, such as Aleph Alpha and Mistral – companies that hold the necessary infrastructure – are so determined to water down the current paragraph on foundation models in the AI Act. It is precisely the transferability and adaptability of these models to perform tasks in all social domains – ranging from healthcare (visual cancer detection), education (large-language-model writing tools) to social scoring (risk assessment for credit or social aid) – that makes their strict regulation so pivotal. Without thorough assessment, potential security gaps, performance issues or discriminatory biases can be disseminated and scaled widely into other AI applications. The German, French and Italian proposal shifts all compliance and liability costs from the shoulders of the biggest AI companies to the thousands of downstream users, public agencies and small-and-medium enterprises that adapt and deploy them.
BigTech’s Efforts to Derail the AI Act – Verfassungsblog
0 notes
Text
Debatte zur sog. Schuldenbremse nimmt Fahrt auf
Die notwendige Debatte zur sog. #Schuldenbremse nimmt Fahrt auf. Und das ist bitter notwendig. Hier ein Lesebefehl für den @Verfassungsblog
Die Debatte zur sogenannten Schuldenbremse nimmt Fahrt auf, und das ist bitter notwendig. Nicht wenige halten diese euphemistisch formulierte Maßnahme –ich zitiere Marcus Höfgen�� für die dümmste aller Regeln, die aber 2009 mit Zweidrittelmehrheit von CDUCSUSPD ins Grundgesetz gegossen wurde. Der damalige SPD-Finanzminister Peer Steinbrück war übrigens damals die treibende Kraft für den Bund,…

View On WordPress
#Bundesverfassungsgericht#Carl Mühlbach#Deutschland#Doris König#Grundgesetz#Haushaltsrecht#Jährigkeit#Klima-Beschluss#Klimapolitik#Lennart Starke#Lukas Märtin#Marcus Höfgen#Nachtragshaushalt#Peer Steinbrück#Schuldenbremse#Verfassungsblog#Zukunftsbremse
0 notes
Text

Unter dem Schirm arbeiten
Regierung schulen, Regierungen schulen schließlich auch. Unter dem Radar arbeiten, so arbeiten, dass niemand es sieht, niemand es wahrnimmt, das machen kluge Leute.
Georges Didi-Huberman ist ein Beispiel für jemanden, der überhaupt nur deswegen die erstaunlich hohe Anzahl von fantasischen und umwälzenden Büchern geschrieben hat, weil er unter dem Radar und unter dem Schirm blieb, weil er die Wahrnehmung unter dem Schirm mitgemacht hat. Der hat auf das Agendasetting des wissenschaftlichen Betriebes, auf den Diskurs, die täglich mit großer Dringlichkeit ankommenden To-Do-Listen, auf die Teilnahme am Diskurs immer geachtet. Das aber nur durch eine Technik, die vorbeischaut, nur vorbeischaut und diesen Diskurs nicht fixiert, ihm schon gar nicht zu genügen versucht oder dessen Erwartungen erfüllen soll. Der Alltag ist aha, so, so. Der hat die Zettel, die ihm gereicht wurden, einfach weitergereicht, hach, wenn man das in Heidelberg vermögen würde, dann wäre Heidelberg wünderschön!
60 Jahre Subversion, jetzt ist er ein Star, 60 Jahre ein Niemand, jetzt ist er nicht mehr so doof, Status persönlich zu nehmen. Achtung aus dem Augenwinkel, Achtung und Würdigung wie die Hunde das tun, wenn sie anderen Hunden begegnen und ihnen am besten begegnen, wenn sie sich nicht anstarren.
tumblr ist riskant, das ist Netz, da gucken schnell mal Leute drauf, oha! Aber es ist nicht facebook, nicht x [vormals twitter], auch nicht der Verfassungsblog.
tumblr ist nicht die Versammlung der Vereinigung der Staatsrechtslehrer. Das hier ist Geheimratseckchen, wie Wien, Weltstadt und doch unter dem Schirm, unter dem Radar. Die Spitze des Weltgeistes ist schon lange vorbeigezogen und jetzt in Washington, Beijing, Moskau, Wien hat seit mindestens 500 Jahren die Erfahrung eines Weltreiches, das untergegangen und uns verloren ist. Seitdem Wien Imperium war, war es auch hin und weg, vor allem immer wieder weg. Im Alltag fort und da. In Wien wird seitdem noch gelauert, noch geläuert, immer und nur noch auf der Lauer statt an der Spitze. Warum soviel Bars, Theken überall in Wien?
Das ist doch klar, man ist verloren gegangen, hat das jüngste Gericht hinter sich und wieder vor sich. Nur im Augenwinkel vorbeigeschaut. Man kann klagen, dass man nicht zitiert wird, dass der Diskurs die Arbeit, die man leistet, nicht berücksichtigt. Soll man aber nicht. Wenn das so ist, soll man das als genau die Cancel, die Cancellierung begreifen, von der Vismann sagt, das sie die einzig sinnfreie, also frei sinngebende und sinnnehmende Chance ist, die man hat. Scheitern als Chance, Archive enttäuschter Erwartung mute und mutual pflegen.
Das ist der Rat eines Beirats, im und aus dem wissenschaftlichen Beirat der Wiener Regierungsschule. Bitte darauf achten, dauernd lauernd und läuernd, immer fix und schnell weiter. Regierung schulen, Regierungen schulen schließlich auch.
Da ist doch gar nicht Wien! Fort auch nicht!
4 notes
·
View notes
Text

Faustschläge oder "erlernte Technik"
Die angebliche "Humanisierung des Strafens"
Der Verfassungsblog beschäftigt sich in einer tiefer gehenden Analyse mit den bei der Polizei aktuell immer öfter zu beobachtenden Schmerzgriffen. Statt Schlagstockeinsatz oder andere "unschön anzusehende" Szenen zu produzieren, wird mit der Schmerzgriff-Technik das Ziel erreicht ohne vor der Öffentlichkeit Gewalttätigkeit zu demonstrieren.
Der Artikel ordnet diese Veränderung in das Schema von Foucault ein, der über die Jahrhunderte eine "Humanisierung des Strafens" in den sich verändernden Erscheinungsweisen der Macht und der gesellschaftlichen Bedingungen von Herrschaft sah.
Allerdings ist medizinisch gesehen die Gewaltintensität von Schmerzgriffen durchaus groß. Amnesty International Österreich berichtet "über einen Schmerzgriff mit Hebeltechnik,die den davon Betroffenen dazu gebracht, laut zu schreien. Einer der beteiligten Polizisten soll das damit kommentiert haben, er solle sich 'nicht so anstellen' und keine 'Show für die Presse' veranstalten. Bei der Untersuchung des betroffenen wurde ein Bruch des Mittelhandknochens festgestellt."
So wird abschließend festgestellt: Entscheidend ist dann nicht mehr allein, ob die Gewalt tatsächlich reduziert wird, sondern vor allem, ob sie weniger gewaltsam wirkt und die erzeugten Schmerzen erfolgreich verdeckt. Schmerzgriffe bedienen diese Logik des Verbergens von Gewalt, die Foucault als das „Spiel von subtileren, geräuschloseren und prunkloseren Schmerzen“ beschreibt.
Mehr dazu bei https://verfassungsblog.de/versteckte-gewalt/ und weitere Artikel über Polizeigewalt https://www.aktion-freiheitstattangst.org/cgi-bin/searchart.pl?suche=Polizeigewalt&sel=meta
Kategorie[21]: Unsere Themen in der Presse Short-Link dieser Seite: a-fsa.de/d/3Bz Link zu dieser Seite: https://www.aktion-freiheitstattangst.org/de/articles/8834-20240709-faustschlaege-oder-erlernte-technik.html
#Polizeigewalt#Schmerzgriffe#Humanisierung#Strafen#Transparenz#Informationsfreiheit#Folter#Demos#Meinungsmonopol#Meinungsfreiheit#Pressefreiheit#Menschenrechte#Freizügigkeit#Foucault
1 note
·
View note
Quote
It is worrisome that two Colombian judges transcribed ChatGPT’s prompts to motivate their decisions without thoroughly examining whether the information was correct. There is a high risk that judges and their clerks all over Colombia start transcribing ChatGPT’s outputs as if they were a reliable source. In fact, judge Padilla stated in a radio interview that judges from all over the country would be “very happy” because the system could save “many hours transcribing things that are already on the Internet”. Judge Padilla also claimed that “what ChatGPT does is to help us choose the best of these texts from the Internet and compile them in a very logical and very short way to what we need.” This lack of understanding of how LLMs work illustrates why ensuring digital literacy of the judiciary is critical in times of generative AI. There is a tendency towards greater access to generative AI tools, freely offered by different companies through web and app-based platforms. Hence, the type of uninformed use of AI that we saw in Colombia may expand beyond the country. Moreover, plaintiffs and defendants may also use LLMs – such as ChatGPT – as an oracle, to the detriment of their clients’ interests. AI tools should only be used in judicial matters whenever such tools are sufficiently tested and when other more effective, less costly, and more accessible tools are not available.
ChatGPT in Colombian Courts – Verfassungsblog
9 notes
·
View notes
Text
Will the ECHR shake up the European asylum system?
This article was written by Dana Schmalz, visiting scholar at the Zolberg Institute on Migration and Mobility at The New School, New York. It was originally published by the German-based Verfassungsblog. It is reprinted here under a Creative Commons license.
In early 2017, a possible bouleversement of the European Asylum system appeared on the horizon. The European Court of Justice (ECJ) had to decide the case X and X, concerning a Syrian family who had applied for visas at the Belgian embassy in Lebanon in order to enter Belgium and seek asylum. Was Belgium obliged to issue such “humanitarian visa”? Advocate General Paolo Mengozzi in his opinion suggested that it was: The Charter of Fundamental Rights of the European Union (EU Charter) prohibits inhuman and degrading treatment and binds a member state whenever applying European Union law. Where refusing a visa in application of the EU Visa Code would expose a person to a serious risk of inhuman or degrading treatment, Mengozzi argued, the visa must therefore be granted. The opinion was sound in that it relied on the EU Charter’s scope of application (Article 51), which is not territorially defined; nevertheless had a revolutionary touch, since it departed from the conception that states have obligations towards asylum-seekers only as far as those are on their territory or at the border.
The ECJ in March 2017 did not follow Mengozzi’s opinion. Focusing on the intended duration of stay, it held that the issuance of visas had not been a matter of EU law but rather national law and therefore not governed by the EU Charter. Despite this matter-of-fact ruling by the ECJ, the case of X and X highlighted a deep-seated dilemma of fundamental rights protection. For persons whose life and safety depend above all on the possibility to escape a country, rights provisions that bind states only towards those already on the territory are largely meaningless. But the case also illustrated how difficult it is to move beyond that territorial conception of state obligations.
All the more remarkable is that a case with largely parallel facts is now pending before the Grand Chamber of the European Court of Human Rights (ECtHR). Nahhas and Hadri v. Belgium equally concerns a Syrian family, who in 2016 applied for visas to travel to Belgium and seek asylum. The legal framework for the decision is obviously different: while the ECJ had been called to decide about the interpretation of the Visa Code in combination with the EU Charter, the ECtHR will have to rule on a possible violation of the European Convention of Human Rights (ECHR). But the broader task faced by the court is the same: to give meaning to fundamental rights in the context of forced migration. In that sense, the decision in Nahhas and Hadri will be a next chapter in an ongoing conversation.
The facts of the case Nahhas and Hadri
Mohamad Nahhas and Bushra Hadri, together with their two children, Omar and Taima Nahhas, had applied for visas in the Belgian embassy in Beirut on 22 August 2016. (This was around two months prior to the claimants in case X and X.) As stated in the documents of the Belgian courts, the family was living at an uncle’s house in Aleppo after their own home had been destroyed, finding themselves in constant fear for their lives and in dire conditions, without electricity and without access to drinking water. At that time, refugees were no longer registered in Lebanon, and even registered refugees lived under very precarious conditions. Especially with their two young children, neither staying in Lebanon seemed conceivable, nor traveling onwards by land, since borders to Turkey were closed. When applying for visas, Nahhas and Hadri had already established a connection with a Belgian family who was willing to host them and bear all costs.
The Belgian Office des Étrangers (OE) denied their request for a visa, pointing out that the intended duration of stay exceeded 90 days – Nahhas and Hadri had openly stated that they planned to apply for asylum in Belgium. Against the visa denial, Nahhas and Hadri filed for an interim injunction before Belgian courts, arguing that the assessment did not sufficiently take into consideration their fundamental rights positions. The Belgian Conseil du Contentieux des Étrangers (CCE) granted the injunction, urging the OE to consider in its decision article 3 of the ECHR – the prohibition of inhuman and degrading treatment, and suggesting that Nahhas and Hadri might have a valid claim in light of that provision. The OE objected, and a legal back and forth between the OE and the CCE followed. Eventually, the case was referred to the Cour d’Appel, which overturned the initial decision of the CCE. Against that background, Nahhas and Hadri submitted an application to the ECtHR.
The questions that the ECtHR has to decide are clear-cut. Did Belgium have jurisdiction over Nahhas and Hadri when denying their visa requests? And if so, did the denial violate the prohibition of inhuman and degrading treatment? In addition, given the proceeding before the Belgian courts and the refusal of the OE to follow the order of the CCE, the applicants raise claims under article 6 para. 1 ECHR, the right to a fair trial, and article 13 ECHR, the right to an effective remedy. There is no doubt about the significance of the case: several governments and non-governmental organizations have intervened with submissions and the initial chamber relinquished jurisdiction to the Grand Chamber.
The interpretation of “jurisdiction”
The key question of the case will be if Belgium’s visa decision meant jurisdiction over Nahhas and Hadri. And it really is an open question. The interpretation of jurisdiction can build on prior jurisprudence of the ECtHR and other courts, but it ultimately depends on a broader conception of how to delimitate the obligations of states.
According to Article 1 of the ECHR, the contracting parties are obliged to secure the convention rights to everyone within their jurisdiction. Jurisdiction generally exists on the territory of a state, but it can also exist extra-territorially, if a state exercises effective control over persons. The criterion of effective control has been interpreted by the court mostly as a physical control. In cases such as Al-Skeini and Jaloud, the court detailed the conditions of extra-territorial jurisdiction in military operations. In the case Hirsi Jamaa, the court held that migrants intercepted in the Mediterranean and brought on board of a ship by Italian coast guards where within the jurisdiction of Italy. Clearly, the situation of Nahhas and Hadri was a different one. There was no immediate physical control of the embassy staff over them, they entered and left the embassy at discretion. Thought-provoking is the comparison to the case M. v. Denmark, in which a man trying to leave East Germany had entered the Danish Embassy in East Berlin and, after refusing to leave, was eventually handed over by the ambassador to the German police. The European Commission of Human Rights, deciding at the time about the admissibility of cases, held that M. had been within Denmark’s jurisdiction. The case was dissimilar from the situation of Nahhas and Hadri, since at stake was the physical presence in the embassy. Nevertheless, the two cases compare since the embassy agents held the key to protect those seeking refuge. Can the refusal to hand over this key constitute jurisdiction?
What is indisputable is that it is disputes. The same acts of state agents can often be framed as action or as omission. Whether a state exercised physical control over a person will be obvious in some cases, but in other cases will depend on what one chooses as frames of time and space. And the interpretation of extraterritorial jurisdiction along the lines of physical control is as such not cast in stone. From the prior jurisprudence, it seems likely that the court would deny the jurisdiction of Belgium. What speaks in favor of another outcome are the profound problems that the territorial conception of state obligations creates in the context of migration.
Universal rights, particular obligations
The questions that the interpretation of jurisdiction raises should be considered against the background of the tension that pervades universal rights treaties and their adjudication. On the one hand, basic rights and freedoms such as the right to life and the prohibition of torture apply without qualifications as to the nationality, legal status, or other characteristics of the person. They are universal in the sense that we recognize every person should enjoy these basic rights and freedoms. On the other hand, the corresponding obligations of states are, and have to be, specific. Not every state has to actively secure the rights of individuals everywhere. The criterion of jurisdiction serves to delimitate the responsibility of states. This delimitation is in general not a problem for the safeguarding of rights, since there is always one state responsible. It can become a problem, however, in the context of migration.
The dilemma of a territorial delimitation of state obligations
Migration governance is marked by the tension between a state’s legitimate interest to control access to the territory, and the commitment to refugee protection and migrants’ fundamental rights. The territorial conception of obligations here translates into a rift regarding the rights of migrants: Those who reach the territory or otherwise are under the jurisdiction of the respective state have substantive procedural and material rights, including the right to an individual assessment of their asylum claim. Those who do not reach the territory have no rights at all. This rift would not be so dramatic if it would not also mean that states can prevent the access of asylum-seekers without engendering legal liability. The court’s interpretation of jurisdiction in that sense outlines how states may hinder migrants to reach their territory without violating the convention. The case Hirsi Jamaa affirmed that extra-territorial jurisdiction existed where migrants were taken on board of a ship – but it thereby also sketched how maritime interception might take place without jurisdiction over the persons intercepted.
The territorial delimitation of state obligations – and I include in the notion the interpretation of extra-territorial jurisdiction along the lines of physical control – thus creates, firstly, a problematic incentive for states to deter the access of migrants. The effect of this incentive on the overall goal of refugee protection is enormous: it is visible in the proliferation of border fences and it contributes to a dysfunctional system, in which states compete in hindering migration and dispelling asylum-seekers. Secondly, the territorial delimitation of state obligations gives rise to a free zone for state actions which can have substantive, possibly fatal, effects on migrants’ lives, without legal responsibility. Thirdly, the arrangement of obligations along lines of territory and physical control disadvantages less physically able migrants. Under the current regime, a person’s access to protection often depends on her ability to put up with harsh conditions and obstacles in reaching a state. In theory, the particularity of obligations might not be in conflict with the universality of rights; in practice, it often is.
What to expect from a responsible judgment?
Is there a legal response to the dilemma of a territorial delimitation of state obligations? Would a different interpretation of jurisdiction solve the problem? The foremost thing to hope for, is that the court will not pass lightly over these issues. Judge Paulo Pinto de Albuquerque in his concurring opinion to the case Hirsi Jamaa described the core issue of the case as the question “how Europe should recognize that refugees have the ‘right to have rights’”. This holds true also for the case Nahhas and Hadri, and no matter how the court will rule, one can expect that it acknowledges the substantial theoretical, historical and political weight of the questions involved.
Albuquerque in this concurring opinion also argued in favor of a state obligation to grant a visa if a person is in danger of being tortured and asks for asylum in an embassy of a State bound by the EHCR. If no other escape is possible, the Convention might impose in such circumstances a positive duty on states under Article 3, Albuquerque suggested. The pressure from the side of state governments against such interpretation will, beyond doubt, be massive. They fear the “specter” of an “uncontrolled flood of applications”, as Mengozzi framed it so pertinently in his opinion to the X and X case. To address that fear, Mengozzi emphasized the particular vulnerability of the Syrian family. Not everybody applying for visas in order to flee a country would be in a comparable situation, he maintained, the obligation would remain reserved for extreme cases.
This indicates that a less territorially focused conception of the reach of human rights obligations would likely come with the delimitation of state obligations along other lines, such as the notion of vulnerability. On the one hand, a wider interpretation of jurisdiction could thus counteract some of the structural dysfunctionalities we see in the context of migration and fundamental rights, which can be an important achievement. On the other hand, the tension between universal rights and particular obligations will remain, and we should carefully look out how other criteria of delimitation endanger the access to rights.
The opinion of Advocate General Mengozzi in the case X and X and the concurring opinion of Judge Pinto de Albuquerque in the Hirsi case were remarkable interventions that, beside their legal merits, illustrated also the political role of fundamental rights adjudication. Too accustomed have we often become to the limits of state obligations to note how they can make the promise of universal rights fade into hypocrisy. It is crucial that in light of concrete cases the drawing of boundaries is reconsidered – to ask what the law requires, and to render visible the responsibility we have to mitigate shortcomings of the law. The case Nahhas and Hadri v. Belgium should be an instance that challenges our taken-for-granted assumptions about the reach of obligations. At least in that sense, it will hopefully shake up the European asylum system.
9 notes
·
View notes
