#Wirtschaft erklärt
Explore tagged Tumblr posts
Note
Hi, da du die offizielle Tumblr Autorität für die DB bist, kannst du kurz erklären was mit dem Streik aktuell los ist? Ich bin grundsätzlich immer auf der Seite der Arbeiter, aber ich höre auch immer mehr, dass die Ziele der Gewerkschaft nicht realistisch sind aus Gründen die die DB selbst nicht ändern kann (u.a. kürzere Arbeitswochen vs. Zu wenig Personal). Und in dem Fall kann ich natürlich verstehen, dass Leute zunehmend genervt sind, wenn die Sache nicht mal was bringt.
Der Tarifvertrag der Lokführer ist ja Oktober 2023 ausgelaufen. Die Streiks der GDL sind erstmal ein legitimes Mittel, unabhängig von ihren Forderungen. Solche "kleinen" Warnstreiks sind in Deutschland, insofern der Tarifvertrag einer Branche ausgelaufen ist und die Verhandlungen gescheitert sind, legal.
Die Verhandlungen waren relativ schnell für erfolglos erklärt worden. Das mag jetzt auch an dem Maße der Forderungen liegen. U.a. will die GDL eine Reduzierung von 38 auf 35 Arbeitsstunden bei Vollzeitstellen (bei voller Bezahlung), Inflationsausgleich und ca. 500 Euro mehr pro Monat. Letzteres klingt alleine schon krass, aber der Tarifvertrag der für mich relevant ist wurde letztes Jahr auch erneuert- das tarifliche Einstiegsgehalt für Facharbeiter wurde da auch mal eben um 480 Euro brutto erhöht. Inwiefern die Forderungen jetzt realistisch sind kann ich nicht beurteilen. Der Bahn fehlt's an Mitarbeitern, da ist es schwierig mal eben Arbeitszeiten noch weiter zu reduzieren. Gleichzeitig bekommst du auch schwer Zuwachs, wenn du die Stellen nicht attraktiver gestaltest.
Gerade wenn es um die Bahn geht ist die öffentliche Debatte zudem einfach extrem aufgeheizt. Wenn die Gewerkschaft der Metallarbeiter streikt bekommt der Durchschnittsdeutsche vielleicht kaum was mit, wenn die Bahn mal für acht Stunden streikt ist Endzeitstimmung. Diese stark polarisierten Darstellungen der Verhandlungsparteien ist natürlich auch irgendwie Strategie. Was man hier mitkriegt ist keine wirkliche Unverschämtheit, sondern einfach ein kleiner Einblick in das reguläre System der Tarifverhandlungen in Deutschland. Man hat hier mal ein kleines Glasfenster mit Blick auf deutsche Politik und Wirtschaft, und alle finden die Aussicht kacke.
#ask#german stuff#tarifverträge my beloveds#ich schätze das als notwendiges aber absolut bitteres übel ein#kann jeden verstehen der da frustriert ist
106 notes
·
View notes
Text
Anfang November 2024
Der digitale Überholspur-Traum trifft auf den Papierstau-Albtraum: Wie eine Handyrechnung den Digitalgipfel überlebt
Die Sperre meines Handys konnte ich nur durch einen etwas nervösen Anruf beim Telefonanbieter abwenden, das war jetzt bereits das zweite Mal. Ich verbringe recht viel Zeit beruflich außerhalb meines Büros, mein Arbeitgeber findet aber, dass ich auch dann manchmal erreichbar sein soll. Darum habe ich ein dienstliches Handy. Und da ist irgendeine Rechnung nicht rechtzeitig bezahlt worden.
Auf dem Digitalgipfel hat Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr, gerade das Ziel ausgegeben, Deutschland müsse “schnellstens ein volldigitales Land werden. Denn #Digitalisierung macht unser Land moderner, unsere Wirtschaft effizienter, unseren Alltag nachhaltiger & unser Leben besser. Deshalb muss aus der #Digitalstrategie eine #DigitalOnly-Strategie werden”.
Um diesem hehren Ziel die Realität der Verwaltung im Jahr 2024 entgegenzusetzen, beschreibe ich hier, wie das mit den Handyrechnungen bei meinem Arbeitgeber abläuft und warum es in Folge fast zu einer Sperre meines Handys gekommen wäre:
Die Handyrechnung bekommt mein Arbeitgeber jeden Monat von dem Telefonanbieter auf Papier auf dem Postweg. In der Poststelle meines Arbeitgebers wird der Brief mit der Rechnung geöffnet und es werden durch die Mitarbeiterin der Poststelle zwei Stempel darauf angebracht. Der erste Stempel hat mehrere Felder, in denen verschiedene Personen mit ihrem Namenskürzel abzeichnen müssen. Der zweite Stempel lautet: “Sachlich und rechnerisch richtig”, und darunter ein Datums- und Unterschriftenfeld.
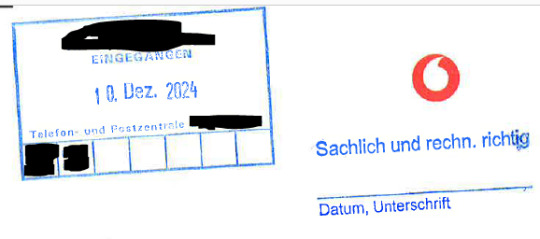
Die Kollegin in der Poststelle stempelt also diese beiden Stempel auf das Papier der Rechnung und versieht das erste Kürzelfeld im ersten Stempel mit ihrem Namenskürzel. Dann kommt die Rechnung in einen braunen Hauspostumschlag (so einer wie dieser hier), darauf schreibt sie meinen Namen, und der Brief geht über die Hauspost an mich.
Ich werfe dann einen Blick auf die Endsumme der Telefonrechnung, in den allermeisten Fällen beträgt diese knapp 10 Euro. Das entspricht der Grundgebühr des Vertrags, darin ist eine Telefon-Flatrate und ein paar GB Internetnutzung enthalten. Manchmal erklärt zum Beispiel ein Aufenthalt im Ausland eine höhere Rechnung. Ich unterschreibe handschriftlich mit Datum und vollem Namen bei dem zweiten Stempel in dem Feld “Sachlich und rechnerisch richtig”. Mir wurde eingebläut, dass hier keinesfalls mein Namenskürzel ausreichend sei, das könne die Buchhaltung nicht akzeptieren.
Dann streiche ich meinen Namen auf dem Hauspostumschlag durch und adressiere ihn an die nächste Bearbeitungsstelle, “FuB”, was für “Finanzen und Buchhaltung” steht und gebe den Umschlag wieder in die Hauspost. Es prüfen noch ein paar weitere Personen die Rechnung, zeichnen das in den jeweiligen Feldern des entsprechenden Stempel mit ihrem Namenskürzel ab, und dann wird die Rechnung durch unsere Buchhaltung beglichen und das Papier irgendwo in einen Aktenordner weggeheftet.
Insgesamt müssen fünf Personen jede dieser Rechnungen sehen und auf Papier bearbeiten. Dafür sind zwei Monate Zeit, bevor der Telefonanbieter eine Sperre androht.
Wenn nun irgendwo dieser Prozess hakt - immerhin sind damit auch ungefähr vier Postwege in der Hauspost verbunden, eine Person kann krank sein, im Urlaub, auf Dienstreise, im Homeoffice, was auch immer - dann sind die zwei Monate zeitlich knapp bemessen.
Ich versuche, das hier relativ neutral zu beschreiben. Meine ganz persönliche Einschätzung dazu ist, dass ich es für eine Bankrotterklärung von Digitalisierungs- und Verwaltungsvereinfachungsbestrebungen halte, dass eine Organisation im Jahre 2024 nicht in der Lage ist, diesen Prozess zu verbessern. Ich habe als minimale Verbesserung, um wenigstens mich da raus zu halten, mehrfach vorgeschlagen, dass zum Beispiel diese monatliche Telefon-Grundgebühr von knapp 10 Euro doch bitte automatisch als “sachlich und rechnerisch richtig” akzeptiert werden könnte. Wie schwer kann es sein, das steht ja schließlich so im Rahmenvertrag, den unsere Organisation mit dem Telefonabieter hat! Dann bräuchte eine Rechnung nur noch im Fall, dass der Rechnungsbetrag davon abweicht, in ihrem Hindernislauf die Schleife auch zu mir zu machen.
Auch wenn natürlich Rechnungs- und Buchhaltungsstellen usw zwar niemals zustimmen würden, sich selber durch so eine allgemeine Anweisung wegzurationalisieren (das könnte ja ihren eigenen Beitrag zu einer Tätigkeit weniger wichtig erscheinen lassen), hatte ich doch die naive Hoffnung, dass wenigstens mein Beitrag (als der von jemandem, der eigentlich inhaltlich arbeiten soll) hier weggelassen werden könne. Aber auch das geht natürlich nicht, da gibt es angeblich Vorschriften und Gesetze, die eingehalten werden müssen. Ich habe auch vorgeschlagen, dass wir, wenn wir schon den ganzen Prozess nicht digitalisieren können, wir doch bitte auch elektronische Unterschriften zum Beispiel per Adobe akzeptieren sollen, es wäre so unendlich viel einfacher. Aber das sei alles “nicht hinreichend rechtssicher”.
So werden also weiterhin die Hersteller von Hauspostbriefumschlägen und Stempeln ihre Daseinsberechtigung haben.
Ich bin schon ganz gespannt, wie es wohl wird, wenn ab spätestens 2025 elektronische Rechnungen akzeptiert werden müssen. Vielleicht kann ich mit unserem Telefonanbieter ein U-Boot starten, dass er uns die Telefonrechnung in elektronischer Form schickt. Was wohl unsere Organisation daraus machen würde? Ich vermute, dass mein Arbeitgeber dann ein Papierformular entwickelt, auf dem dann die ausgedruckte elektronische Rechnung abgezeichnet werden muss. Oder meine Organisation wird die Rechnung einfach nicht mehr bezahlen können und dann vielleicht das Telefon gesperrt. Wir werden sehen.
(Molinarius)
#Molinarius#Rechnung#Papier#Brief#Hauspost#Unterschrift#Handy#Telefon#Bräuche und Brüche#Digitalisierung#Verwaltung#best of
9 notes
·
View notes
Text
Die Regentrude
Der erste Satz der Geschichte schildert einen übermäßig warmen Sommer vor hundert Jahren. Eine furchtbare Dürreperiode lässt die Pflanzen verdorren und das Vieh verdursten. Die Menschen leiden unter der unerträglichen Hitze. Nur der Wiesenbauer hatte schon vor Jahren eine tiefgelegene Wiese erworben, die noch genug Feuchtigkeit besitzt, um die Heuernte reichhaltig ausfallen zu lassen. Die von der Hitze heimgesuchte Landwirtschaft verursachte eine Teuerung, von der einzig der Wiesenbauer profitierte. Er kann es sich sogar leisten, seiner Nachbarin, der etwa 50-jährigen Mutter Stine, einen Kredit über 50 Taler über den Rückzahlungstermin hinaus zu stunden. Doch selbst dabei verliert er seinen Vorteil nicht aus den Augen und fordert Stines verbliebene Ländereien zum Pfand.
Während dieses Gesprächs rügt er das Verhältnis zwischen Stines Sohn Andrees und seiner Tochter Maren, für die er nun, da es seiner Wirtschaft blendend geht, eine bessere Zukunft plant. Andrees, obwohl dem Dorf als tüchtiger junger Bauer bekannt, ist ihm als Schwiegersohn nicht mehr wohlhabend genug. Stolz brüstet sich der Wiesenbauer seiner Klugheit, da er doch einst mit Andrees’ Vater dessen nun trocken daliegenden Höhenwiesen gegen das sumpfige Tiefland eintauschte.
Die nachfolgenden heißen Sommer hatten ihm recht gegeben. Resignierend bemerkt darauf Mutter Stine, dass die Regentrude wohl eingeschlafen sei. Der Wiesenbauer hält die Regentrude für „Gefasel“ und gibt nichts auf die alten Geschichten. Mutter Stine jedoch weiß, dass die Regentrude in einem ähnlich heißen Sommer vor langer Zeit von ihrer Urahne geweckt worden ist, und nennt den Wiesenbauern einen Neugläubigen. Übermütig erklärt der Wiesenbauer, wenn es Mutter Stine gelinge, „… binnen heut und vierundzwanzig Stunden …“ Regen zu schaffen, dann möge Andrees seine Tochter Maren heiraten.
Maren hört dies und ruft den zufällig anwesenden alten Vetter Schulze und Mutter Stine zum Zeugnis dieses Eheversprechens auf.
Mutter Stine weiß zu berichten, dass die Urahne einst mit einem besonderen Spruch die Regentrude erweckte; sie kann sich aber beim besten Willen nicht mehr auf den genauen Wortlaut besinnen. Die Urahne starb, als Stine selbst noch ein Kind war.
Da aber betritt Andrees die Stube. Er trägt ein verdurstetes Schaf bei sich und berichtet, er sei auf der Weide gewesen und habe dort einen Kobold getroffen, welcher Fragmente des Spruchs vor sich hingesungen habe.
Mit Hilfe dieser Fragmente kann Stine den ganzen Spruch rekonstruieren:
Dunst ist die Welle,
Staub ist die Quelle!
Stumm sind die Wälder,
Feuermann tanzet über die Felder!
Nimm dich in Acht,
Eh' du erwacht,
Holt dich die Mutter
Heim in die Nacht!
Nun fehlt den jungen Leuten nur noch der Weg hin zur Regentrude. Andrees verspricht, er wolle noch einmal versuchen, dem Kobold das Geheimnis abzulauschen. Tatsächlich trifft er den Feuermann auf seinen versengten Feldern, und dieser weiß bereits über Andrees’ Vorhaben Bescheid.
Der Feuermann dünkt sich so unendlich klüger als der vermeintliche dumme Bauernbursch (sein kleiner Finger sei viel klüger als manch großer Kerl) und weidet sich daran. Dabei verrät er in seiner Häme und seinem Übermut alles, den Weg und die Bedingung, dass nur eine Jungfrau die Regentrude aufwecken kann. Als Andrees geht, freut sich der Feuermann: „Der Kindskopf, der Bauerlümmle dachte mich zu übertölpeln und weiß noch nicht, dass die Trude sich nur durch das rechte Sprüchlein wecken lässt. Und das Sprüchlein weiß keiner als Eckeneckepenn, und Eckeneckepenn, das bin ich!“ Kurioserweise weist der Kobold sich den Namen Eckeneckepenn zu, der doch eigentlich ein Meermann, also ein Wesen des feuchten Elementes ist.

Schon am nächsten Tage machen sich die beiden jungen Leute in aller Frühe auf den Weg und finden auch bald die hohle Weide. Durch das lange Herabsteigen in ihrem dunklen Stamm gelangen sie in eine Unterwelt, deren Landschaft sich zwar von der ihrigen unterscheidet, dennoch aber ebenfalls unter einer gewaltigen Dürre leidet. Sie spüren eine unerträgliche Hitze während sie eine unendlich lange Allee dürrer Bäume entlanggehen. Da vermeint Andrees, dass diese Hitze durch die unsichtbare Begleitung des Feuermannes entstehe. Als Maren nicht mehr weiterkann, gibt ihr Andrees von dem Met der Urahne, den ihnen Stine mitgab, zu trinken, was sie sofort stärkt. Bis zu einem weitläufigen Garten mit ausgetrockneten Flussbetten begleitet Andrees die Freundin. Ab hier muss sie nun allein gehen durch das Becken eines ausgetrockneten Sees bis zu einer Felswand, von der einst ein Wasserfall sich ergoss. Dort in der Felswand, so grau wie der Fels, findet sie denn auch eine schlafende Frauengestalt – eine hochgewachsene, edle Erscheinung, die früher einmal sehr schön gewesen sein musste, nun aber bleiche und eingefallene Augen, Lippen und Wangen hat. „Aber die da schläft nicht, das ist eine Tote!“ Maren kniet nieder, nimmt allen Mut zusammen und sagt das Sprüchlein auf. Unter dem Wutschrei des Feuermanns ist die Regentrude erwacht und steht vor ihr. Diese fragt, was sie wolle. Maren schildert das schreckliche Leiden der Natur unter der Trockenheit. Da begreift die Regenfrau, dass es hohe Zeit ist. Noch aber ist das Werk nicht getan. Erst muss Maren noch den Brunnen in einem bis in den Himmel aufragenden Schloss aufschließen, vorher den glühenden Schlüssel mit geschöpftem Wasser kühlen, immer noch bedroht vom Feuermann. Kaum ist dies aber geschehen, verwandelt sich auch die Regentrude wieder in eine wunderschöne blühende Frau, das Gespinst an der wegen der Ferne nicht zu sehenden Schlossdecke wird zu Regenwolken, die von der Regentrude und auch von Maren durch Klatschen in die Welt gesandt werden. Die Welt hat sich verändert. Überall strömt wieder das Wasser. Die beiden jungen Frauen sind sich nahe. Maren erfährt, wie wichtig es war, dass sie die Regentrude geweckt hatte. Sie hätte sonst in die Erde hinabmüssen und der Feuermann wäre der Herr über die Erde geworden. Nun löscht das aufbrausende Wasser um das Schloss den Feuermann mit Prasseln und Heulen unter dem Entstehen einer riesigen Dampfwolke. Die Regentrude erzählt Maren von den Zeiten, als sie noch von den Menschen geehrt und geachtet wurde. Als die Menschen sie jedoch später vergaßen, schlief sie immer wieder vor Langeweile ein.

Die Regentrude begleitet Maren zurück zu dem wartenden Andrees. Doch Maren hat Angst davor, dass Andrees beim Anblick der wunderschönen Regentrude seinen Kopf verlieren könnte. Die Regentrude akzeptiert dies und verabschiedet sich von ihr vor dem Treffen mit Andrees mit den Worten: „Schön bist du, Närrchen!“ Sie weist auf einen Kahn, mit dem beide nun auf kürzestem Weg über den Dorfbach zu ihrem Dorf zurückschwimmen können.
Zweimal gedenkt Maren, dass sie mit ihrem Tun gegen die Interessen ihres Vaters verstößt: Sie hat sich davongestohlen, ihn belogen und ihm nicht am Morgen sein Warmbier bereitet, um die Regentrude zu wecken. Nun sieht sie die Wiesen ihres Vaters überschwemmt – das Hochwasser schwemmt sein Heu weg. Sie denkt: „Was tut man nicht um seinen Schatz“. Andrees drückt ihre Hand und sagt: „Der Preis ist nicht zu hoch.“
Seines Versprechens eingedenk und dem kühlen Geschäftskalkül folgend, das dem Wiesenbauern sagt, dass er mit dem einsetzenden Regen nun wieder mit seinen Tieflandwiesen den schlechteren Teil erwischt hat, richtet er die Hochzeit zwischen Maren und Andrees aus. Diese findet bei strahlendem Himmel statt, aus dem nur ein winziges Wölkchen ein paar Regentropfen auf die Braut herabsendet, der Segen der Regentrude. Danach betritt das Paar die Kirche „… und der Priester verrichtet sein Werk.“
Das Märchen Die Regentrude verweist auf die vorchristlichen Religionen im norddeutschen Raum. Die Regentrude erinnert stark an Frau Holle[2], diese bringt Wasser, jene den Schnee. Beide können für Menschen nur durch gefährliche Abstiege in die Unterwelt (durch die hohle Weide bzw. durch den Sturz in den Brunnen) erreicht werden. Es sind Bilder archaischer Naturgöttinnen, denen Menschen Opfergaben mit der Bitte für reiche Ernte und günstige Witterung brachten. Im Zuge der Christianisierung wurden sie dämonisiert und verschwanden aus dem Gedächtnis der Menschen. Aber in den Volkserzählungen und Sagen leben sie weiter.
#hexe#magick#witch community#witchcraft#baby witch#witch tips#beginner witch#pagan witch#witchblr#chaos magick#märchen#regentrude#regentropfen#heirat
2 notes
·
View notes
Text
Meet Lisa Osada: Die Finanzbloggerin, die die Aktienwelt aufmischt
Hey, ihr Lieben! Nach den Schwergewichten der deutschen Management-Geschichte, über die ich in den letzten beiden Beiträgen berichtet habe, werfen wir heute noch einen Spotlight auf Lisa Osada, die kreative Kraft hinter dem beliebten Finanzblog und Instagram-Kanal Aktiengram. Lisa ist nicht nur eine engagierte Bloggerin, sondern auch eine echte Pionierin in der Welt der Finanzen, die beweist, dass Börse und Investments nicht nur Männerdomänen sind.
youtube
Vom IT-Geek zur Finanzguru
Lisa begann ihre Karriere mit einer Ausbildung zur Fachinformatikerin für Systemintegration, die sie von 2011 bis 2014 absolvierte. Während ihrer Zeit in einem börsennotierten Unternehmen entdeckte sie ihre Leidenschaft für Aktien – ein glücklicher Zufall, der ihr Leben verändern sollte. Nachdem sie acht Jahre lang in der IT-Branche gearbeitet hatte, wagte Lisa 2020 den Sprung und widmete sich voll und ganz ihrer Leidenschaft für die Finanzwelt.
Aktiengram: Mehr als nur ein Blog
Anfang 2020 startete Lisa Aktiengram, eine Plattform, die sich schnell zu einem umfassenden Ökosystem aus Blog, Instagram-Kanal und Podcast entwickelte. Ihr Ziel? Klischees über den Aktienmarkt zu zerstreuen und zu zeigen, dass Geldanlage spannend, zugänglich und nicht nur etwas für "Insider" ist. Lisa möchte insbesondere Frauen ermutigen, sich mit Themen rund um Finanzen auseinanderzusetzen und so Vorurteile und Unsicherheiten abzubauen.
Eine Welt voller Möglichkeiten
Lisa erklärt, dass die Beschäftigung mit Aktien einem die Augen dafür öffnet, wie sehr die Wirtschaft unser tägliches Leben durchdringt. Ob beim Kauf von Zahnpasta oder einem Spaziergang durch die Stadt – überall begegnen uns börsennotierte Unternehmen. Ihre Botschaft ist klar: Die Börse ist überall, und mit ein wenig Wissen kann jeder Teil dieser spannenden Welt werden.
Gaming und Natur: Lisas Ausgleich
Neben der Börse hat Lisa noch andere Leidenschaften. Sie liebt es, in ihrer Freizeit zu fotografieren, in der Natur zu sein und Videospiele zu spielen – Zelda, Final Fantasy und Assassin's Creed sind ihre Favoriten. Diese Interessen verknüpft sie geschickt mit ihrer finanziellen Bildung, indem sie in Unternehmen investiert, die ihre Hobbies widerspiegeln.
Bildung und finanzielle Unabhängigkeit
Lisa ist der Überzeugung, dass finanzielle Bildung der Schlüssel zur Unabhängigkeit ist. Durch ihre eigene Erfahrung, früh Verantwortung übernehmen zu müssen, hat sie gelernt, wie wichtig es ist, auf sein Geld zu achten. Sie sieht ihre Plattform als Möglichkeit, ihr Wissen zu teilen und andere zu inspirieren, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Zukunftsmusik: Aktiengram und darüber hinaus
Lisa bleibt nicht stehen – sie plant stets die nächsten Schritte für Aktiengram. Egal ob durch neue Blogposts, die Beantwortung von Community-Fragen oder das Hosten ihres Podcasts, sie bleibt ihrer Mission treu, die Finanzwelt verständlicher und zugänglicher zu machen.
Inspiriert? Dann schaut doch mal bei Aktiengram vorbei und taucht ein in die Welt der Finanzen, wie Lisa sie sieht – spannend, vielfältig und voller Möglichkeiten!
2 notes
·
View notes
Text

Sinnbild Verfassung
1.
In Frankfurt wird im Sommer, im Juli, eine Tagung zur Verfassung der Sinnbilder, in dem Fall zum Sinnbild Verfassung organisiert. Kulturtechnikforschung strikes back, unter anderem alle diejenigen, die behaupten, dass Rechtwissenschaft keine Bildwissenschaft sei und von Kulturtechnikforschung nicht profitieren könne.
Das Wort Sinnbild gilt als Übersetzung des Wortes Emblem, als Bezeichnung für Insignien, Wappen oder Schilder. Da bin ich gespannt, wie das Thema ausgeschöpft wird. Ein bisschen skeptisch bin ich immer ziemlich. Ab und an werden Begriffe nämlich mit großem Bedacht gewählt, nimmt man den Begriff aber zu ernst und bohrt zu dringend nach, wird abgewiegelt: Man habe das eher bildlich und den Begriff so wörtlich gemeint oder eben schlicht ein Signal für eine Tagung gebraucht. Juristen tendieren dazu, auf den Ernst der Begriffe zu pochen, bis jemand kommt, der die Begriffe noch ernster nehmen kann, dann tendieren dazu zu sagen, mal solle das alles pragmatischer verstehen. Die Schlingel!
Meine Anregung zu dieser Tagung wäre es, das Thema archäologisch und mit Mitteln der Kulturtechnikforschung anzugehen, also nach den verfassenden Techniken zu fragen, konkret und historisch im Zusammenhang mit Insignien, Emblemen, Wappen und Schildern, mit sog. stemmata und imagines, mit pictura und mit tabula picta vorkamen. Mein Anregung: keine Theorie ohne Geschichte, sonst wird es Schwierigkeiten geben, zu relativieren.
2.
Verfassen ist eine Kulturtechnik, die unter anderem durch graphische und choreographische Akte wahrgenommen und ausgeübt wird. Sie wird nicht nur durch Akte wahrgenommen und ausgeübt, auch durch Akten und Tafeln, durch Urkunde, Protokolle, Kommentare und Urteile, durch Berichte und Bilder, durch Bauten und Pläne, durch alles das, was dabei kooperiert, zu fassen und damit zu verfassen. Dieter Grimm und andere sprechen bei diesen Fassungen von der relativen Autonomie des Rechts, wir verstehen das auch als relative Heteronomie des Rechts. Etwas setzt über, etwas ist übersetzt, aber dabei sind nicht nur das Recht und die Politik im Spiel.
Grimm fokussiert die Politik, weil er an konstituierten Foren und Organisationen der Politik denkt (nicht an das Politische) und weil er vor allem die Assoziation fokussiert, die man Staat nennt. Das erklärt eventuell, dass er bei den Relationen, Autonomien und Heteronomien nur das Recht und die Politik erwähnt - und nicht von Religion, Kult, Mythos, Aberglaube, Moral, Weltanschauung, Kultur, Wirtschaft, Technik, Ökologie und allen weiteren Normen spricht.
3.
Warburg entwirft auf den Staatstafeln eine Theorie und Geschichte der Verfassung, auch wenn das gegenüber der Geschichte und Theorie des Vertrages nicht so schnell zu erkennen ist. Warburg fokussiert zuerst den Vertrag, das Tragen und Trachten, das hat mehrere Gründe. Einer davon ist der Umstand, dass die Lateranverträge als Gründungsdokument des neuen römischen Staates gelten und dieser Staat seine Gründung über den Abschluss und die Ratifikation der Verträge markiert. Keine Verfassungsgebung soll den neuen Staat konstituiert und die alte Idee einer Assoziation als Körperschaft restituiert haben. Ein zweiter Grund: Warburg hatte auch vor dem Februar 1929 und seit 1896 immer wieder das Tragen und Trachten in den Vordergrund seiner Überlegungen gerückt, das Fassen und Greifen, auch das schauende Erfassen, das Blicken und Bilden als Fassen und Greifen tauchen nicht so häufig in Warburgs Notizen auf. Aber sie tauchen auf, prominent etwa in den Notizen zum Schlangenritual und zum Greifmenschen sowie in den editierten Notizen zu den Fragmenten der Ausdruckskunde, den grundlegenden Bruchstücken.
3.
Dennoch ist Aby Warburgs Beitrag als Beitrag einer Verfassungsgeschichte und Verfassungstheorie zu lesen und dabei auch als Beitrag aus der Geschichte der Rechtswissenschaft. Warburg macht sich nicht nur Gedanken über die Rechtswissenschaft, wer macht sich rechtswissenschaftlich Gedanken, seine Methoden sind auch rechtswissenschaftliche Methoden: Juristische Quellen identifizieren und methodisch auslegen, etwa nach hermeneutischen, logischen Methoden. Besonders hilfreich wird Aby Warburgs Beitrag, wenn man die Übersetzungschritte und den Austausch beobachten möchte, der stattfindet und wegen dem das Dogma der großen Trennung eingerichtet wird. Wenn man beobachten möchte, wie etwas zwischen Kunst, Religion, Politik, Moral, aus Animalischem oder Physischem ins Recht übersetzt wird und mit dem Recht Austausch treibt und man darum sagt, dass müsse man aber trennen und ausdifferenzieren, damit solche Übersetzungen und so ein Austausch nicht ungeschieden, ungeschichtet, ungemustert oder gar maßlos vorgehe, dann ist Warburgs Arbeit hilfreich. Hilfreich ist sie auch dann, wenn man nicht unterstellt, dass das Recht Bestand hätte, beständig sei oder aber Verhaltenserwartungen kontrafaktisch stabilisieren würde. Wenn man eher davon ausgeht, dass das Recht unbeständig, meteorologisch und polar ist, dann, vielleicht nur dann, ist Warburg hilfreich. Wenn die Polizei weder dein Freund noch dein Feind, sondern mal dein Freund und dann wieder dein Feind oder auch ganz ohne Freundschaft und Feind schlicht jene verkehrende Weise der Polarität ist, die man als Polizei begreift, dann ist Warburg hilfreich, auch für eine Geschichte und Theorie der Verfassung.
Vor allem, wenn man Verfassung als nomen actionis (als das Verfassende) begreifen möchte und dann zu denjenigen Techniken forschen möchte, die etwas auch dann noch passioniert tun, wenn sie als aktiv begriffen werden sollen, dann ist Warburg hilfreich, denn er hat dafür einen Begriffsapparat und Vorarbeiten geliefert.
Keine Theorie ohne Archäologie, keine Theorie ohne Geschichte und ohne sedimentäre Geschichte. Sonst kommen Verflachungen dabei raus, die mir nicht hilfreich sind und es würde mich arg wundern, wenn sie anderen besonders hilfreich wären.
2 notes
·
View notes
Text
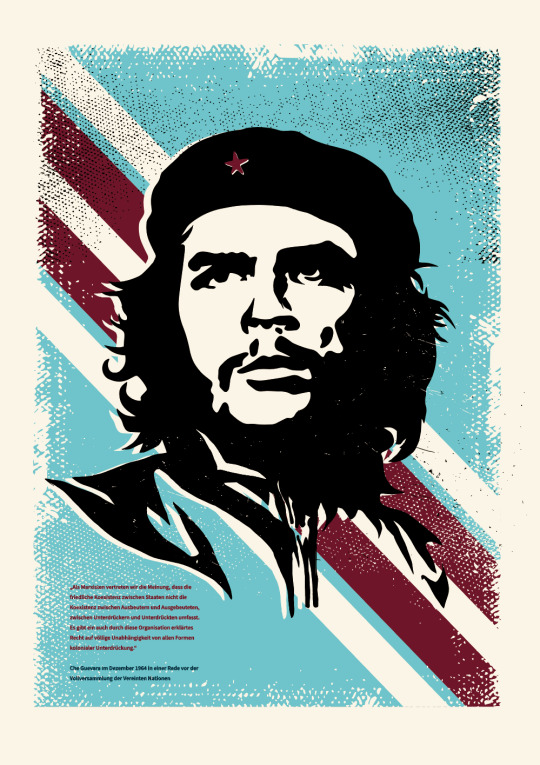
Che Guevara
Als Vertreter Kubas hält Che Guevara im Dezember 1964 eine Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen. In Militäruniform tritt er ans Mikrofon:
„Als Marxisten vertreten wir die Meinung, dass die friedliche Koexistenz zwischen Staaten nicht die Koexistenz zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten, zwischen Unterdrückern und Unterdrückten umfasst. Es gibt ein auch durch diese Organisation erklärtes Recht auf völlige Unabhängigkeit von allen Formen kolonialer Unterdrückung.“
...
1928 wird Ernesto »Che« Guevara als Sohn eines Plantagenbesitzers in Argentinien geboren. 200 Familien aus Großgrundbesitz, Handel, Industrie und Politik besitzen dort praktisch alles, während die Mehrheit der Menschen in Argentinien in Armut lebt. Unter den indigen Wanderarbeitern wütet die Tuberkulose. In den Kohlegruben sterben die Arbeiter gewöhnlich mit 30 Jahren, die Lungen von Kohlestaub zerfressen.
Che Guevara politisiert sich
Che wächst in einem kritischen Elternhaus auf. In einem Liebesbrief an eine Tochter aus reichem Hause schreibt er mit 17 Jahren: »Die Summe des Elends ist zu groß, die Schuld dieser Klasse in die du hineingeboren bist, ist zu groß, als das ich sein könnte, sein möchte wie sie: Ich verspüre diese Schuld manchmal nachts als einen Alpdruck. Der Duft Deines Körpers kann nicht aus meiner Phantasie die Anklage verdrängen, die von dem Elendsgestank ausgeht, der aus den Slums herausdampft: Reichtum; nein, ich will keinen Teil daran haben. Ich will keinen Teil daran haben, dass diese Ungerechtigkeit fortbesteht.«
Als Medizinstudent reist er mit einem Freund auf einem Motorrad durch fast alle Länder Mittel– und Südamerikas. Das Tagebuch, das er auf dieser Reise geführt hat, ist 2004 von Walter Salles verfilmt worden. Che erlebt auf seiner Reise, wie US-Konzerne riesige Mengen an Rohstoffen und Profiten aus dem Kontinent ziehen und Regierungen ein- oder absetzen, wie es ihnen gefällt. Die Länder bleiben unterentwickelt und abhängig. Die einheimischen Herrscher verprassen ihren Reichtum oder schaffen ihn ins Ausland. Überall rebellieren Menschen, doch meistens ersetzt am Ende nur eine Clique die andere.
Che Guevara trifft Fidel Castro
1955 trifft Guevara in Mexiko den kubanischen Rechtsanwalt Fidel Castro (marx21 Nachruf auf Fidel Castro), der seine Heimat von dieser Knechtschaft befreien will. Che ist begeistert: »…in diesem Kampf gab es nur Sieg. Ich teilte seinen Optimismus. Es war unausweichlich, mit dem Jammern aufzuhören und mit dem Kampf zu beginnen.« Im Dezember 1956 stechen Castro und Guevara mit 80 weiteren Kämpfern in Richtung Kuba in See. Die Wirtschaft der Insel gehört praktisch den USA: Die US-Beteiligung an der Telefon- und Elektrizitätsversorgung übersteigt 90 Prozent, bei den Eisenbahnbetrieben macht sie die Hälfte aus, in der Rohrzuckerproduktion 40 Prozent.
Zucker macht 80 Prozent aller kubanischen Exporte aus. Das Pro-Kopf Einkommen war seit 50 Jahren nicht gestiegen. Zwei Jahre Kampf genügen, um das Regime des Diktators Batista zu besiegen. Am Ende besteht die Streitmacht der Revolutionäre aus 800 Guerilleros und zivilen Einheiten von etwa 2200.
Batistas Regime in Kuba fällt
Die Bauern unterstützen die Revolutionäre passiv, auch die Arbeiter bleiben weitgehend ruhig. Die Leitung des Kampfes liegt in den Händen der Guerilla-Führung, deren Kern aus Intellektuellen besteht. Batistas Regime ist so wenig verwurzel, korrupt und so schwach, dass der Widerstand gleich null ist, als Castro und Guevara in Havanna einmarschieren. Selbst die Regierung der USA glauben nicht mehr an Batista. Als wichtiger militärischer Führer übernimmt Che leitende Funktionen. Er wird Präsident der Nationalbank, Leiter des Instituts für Agrarreform und wichtiger Vordenker der »neuen Gesellschaft«.
Castro wird zum »Marxisten-Leninisten«
Die neue Regierung will Kuba aus seiner Abhängigkeit befreien, modernisieren und industrialisieren. Aber selbst wenig radikale Maßnahmen der Regierung wie eine milde Landreform gehen den USA zu weit. Amerikanisches und kubanisches Kapital wird von der Insel abgezogen. Dann verhängt die US-Regierung eine komplette Wirtschaftsblockade, um das Regime in die Knie zu zwingen. Eine eigenständige nationale Entwicklung gegen den Druck der USA und in deren unmittelbarer Nachbarschaft ist unmöglich. Die kubanische Führung sieht keinen anderen Weg als die Annäherung an die Sowjetunion. Castro erklärt sich 1961 plötzlich zum »Marxisten-Leninisten«. Die Führung der UdSSR sieht die revolutionäre Insel vor der Haustür der USA als Trumpf im Kampf der Supermächte. Sie nutzt die kubanische Wirtschaft zum eigenen Vorteil. Guevara ist entsetzt.
Das neue Kuba in der Sackgasse
Die Sowjetunion fordert Lebensmittel und Rohstoffe, fördert aber die industrielle Entwicklung auf Kuba nicht. Für Zucker zahlen die Sowjets nur Weltmarktpreise. 1963/64 muss sich die Regierung eingestehen, dass die Abhängigkeit vom Zucker so groß ist wie eh und je. Noch unter Ches Regierung versucht man, durch Rationierung von Lebensmitteln und Textilien Geld für die Industrie vom Lebensstandard der Arbeiter abzuknapsen. Mit Appellen an die soziale Verantwortung und die sozialistische Moral versucht Guevara, die Opferbereitschaft der Arbeiter zu erhöhen. Schließlich greift das Regime mehr und mehr auf Zwang und Autorität zurück. Kuba steckt in einer Sackgasse. Jetzt treten Ches Stärken und Schwächen klar hervor.
Che Guevara: Seine Stärken und Schwächen
Seine Stärke liegt in seiner revolutionären Überzeugung, seinem Internationalismus und in seinem Tatendrang. Während Castro versucht, den Spielraum des Landes zu erweitern, indem er Spannungen zwischen der Sowjetunion und China ausnutzt, will Che die Revolution ausbreiten. Che kritisiert die politische Führung der UdSSR, weil sie bereit ist, auf Aufstände zu verzichten, um das Gleichgewicht mit den USA zu halten. 1965 klagt Guevara die »sozialistischen Staaten« an, »Komplizen der Ausbeuter« zu sein. Obwohl die UdSSR keine von ihnen unabhängige Befreiungsbewegung tolerieren will, beharrt Che: »Wir können nicht aufhören, unser Beispiel zu exportieren.« Sein Motto: »Schafft zwei, drei, viele Vietnams« wird von der Studierendenbewegung aufgegriffen, die sich im Westen während des Kriegs der USA gegen die vietnamesische Befreiungsbewegung entwickelt.
Guerillakampf in Kuba als Vorbild?
Guevara versucht, aus seinen Erfahrungen in Kuba ein Drehbuch für andere Revolutionen zu machen. In Bolivien zeigen sich die Schwächen dieser Idee. Dort will Che das Fanal für den Aufstand der Unterdrückten in ganz Südamerika setzen. Er scheitert kläglich. 1966/67 fängt Guevara mit einigen kubanischen Mitstreitern an, ein Guerilla-Lager in Bolivien aufzubauen und Kämpfer um sich zu sammeln. Auf Bolivien fällt die Wahl eher zufällig. Der Ort spielt in Ches Theorie keine große Rolle. Guevara meint, dass Revolutionäre nicht auf die Bedingungen für eine Revolution warten müssen, sondern diese selbst durch ihre Taten schaffen könnten. Die Guerillas sollten einfach in einem begrenzten Gebiet mit ihrem »heldenhaften Kleinkrieg« beginnen.
In diesem Kleinkrieg würden dann Bastionen der Partisanen entstehen. Der Kampf würde die Diktatur zwingen, sich ohne Maske und in ihrer ganzen Brutalität zu zeigen und so die Gesellschaft offen in Herrscher und Beherrschte polarisieren. Die Reihen der Partisanen könnten dann durch Bäuerinnen und Bauern aufgefüllt werden. Immer weitere Gebiete würden unter die Kontrolle der Aufständischen geraten – bis zum endgültigen Sieg.
Doch die bolivianischen Bauern haben kein Interesse an Ches Kampf. Die bolivianische Regierung ist lange nicht so wurzellos und schwach wie es das kubanische Regime unter Batista gewesen war. Die Partisanen bleiben völlig isoliert. Regierungstruppen mit Unterstützung aus den USA können immer mehr Guerilleros umbringen. Nach einem Jahr ist der Kampf endgültig verloren: Am 9. Oktober gerät Che mit seinen Mitstreitern in einen Hinterhalt. Er wird gefangen und später erschossen. Hätte die Geschichte anders ausgehen können?
Die Schwächen der Strategie von Che Guevara
Während Ches bolivianischen Abenteuers streikten die dortigen Minenarbeiter – unabhängig von Guevaras Guerillakampf. Sie waren schon 1952 die Vorkämpfer einer Revolution gewesen. In seinen bolivianischen Reisebüchern bezieht sich Guevara zwar ein paar Mal auf die Bergarbeiter, aber er hält die Verbindung zur bolivianischen Arbeiterklasse nicht für zentral oder überhaupt auf irgendeine Art und Weise für wichtig. Und das ist eine große Tragödie, denn Che hätte sein Ziel der nationalen Befreiung mit den Klassenkämpfen der Arbeiterinnen und Arbeiter verbinden können, die immer wieder auf dem Kontinent aufflammten. 1969 regierten Beschäftigte für eine kurze Zeit die argentinischen Städte Cordoba und Rosaria. Ende der 1960er Jahre wehrten sich auch in Chile immer mehr Arbeiter. Das war 1970 die Grundlage für einen gefeierten Wahlsieg einer Koalition von Sozialdemokraten, Sozialisten und anderen unter Führung von Salvador Allende.
Guerillakampf statt Selbstbefreiung
Doch für Che lag das Zentrum des Kampfes auf dem Land. Das bedeutete zwangsläufig, dass der Träger des Kampfes nicht die städtische Arbeiterklasse, sondern die Bauern – die allerdings von städtischen Intellektuellen geführt werden sollten – sein würden. Guevara hatte seit den 1950er-Jahren immer wieder Texte von Karl Marx studiert. Er teilte mit Marx eine grundsätzliche Feindschaft gegenüber Ausbeutung und Unterdrückung. In seiner Politik wich Che aber von Marx Grundüberzeugung ab, das die Befreiung vom Kapitalismus nur das Werk der Arbeiter selbst sein könne. Guevara meinte, das revolutionäre Potenzial erwachse aus der absoluten Armut und der Schärfe der Unterdrückung. Es brauche nur die Entschlossenheit der Tat, genügend Mut und die richtigen Ideen der Partisanen, um die Bauern mit zu reißen, zu erziehen und auf den richtigen Weg zu führen. Anders als auf Kuba konnten Ches Elan und seine Opferbereitschaft in Bolivien die Selbstaktivität der Arbeiterklasse nicht mehr ersetzen.
Was bleibt von Che Guevara?
Viele Menschen sehen heute in Che Guevara ein Symbol des Widerstandes. Bis heute inspiriert er Menschen undbringt ihr Verlangen nach einer besseren Welt zum Ausdruck. Che steht, trotz seiner Schwächen, für die Überzeugung, dass die Welt verändert werden kann und vor allem durch die Bewegung selbst verändert werden kann. Das Leben von Che Guevara ist eine historische Lehrstunde für uns, die mit der Annahme beginnt, dass Revolution machbar ist, dass sie gemacht werden sollte, und dass die Welt verändert werden muss. Ist man einmal soweit, stellt sich die Frage nach dem »wie?«. Die Antwort steht nicht in irgendwelchen Anleitungen oder Handbüchern, sondern sie liegt in der Geschichte, in der Erfahrung. Und das Leben dieses großen und engagierten Kämpfers für soziale Veränderung sollte Teil der politischen Bildung für eine neue Generation von Revolutionärinnen und Revolutionären sein. Wir können aus seinen Fehlern lernen.
Zwei, drei, viele Vietnam
Am 16. April 1967 erschien in Havanna die erste Ausgabe der Zeitschrift "Tricontinental" als dünnes Sonderheft. Die von der knapp ein Jahr zuvor gegründeten Organisation für Solidarität mit den Völkern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas (OSPAAAL) herausgegebene Publikation enthielt nichts weiter als einen Brief an ihr Exekutivkomitee. In diesem als "Botschaft an die Trikontinentale" bekannt gewordenen Schreiben richtete sich Ernesto "Che" Guevara, das wohl prominenteste Gründungsmitglied der OSPAAAL, an die Weltöffentlichkeit.
Der ehemalige Kommandant der Kubanischen Revolution forderte in seiner Botschaft die "Völker der Welt" dazu auf, die ihnen von den "imperialistischen Mächten" auferlegte Starre abzuschütteln und die Waffen zu ergreifen, um mit ihm für die endgültige "Befreiung der Menschheit" zu kämpfen. Er selbst befand sich, wie später bekannt werden sollte, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits seit mehreren Monaten in Bolivien und hatte den Text noch im Jahr 1966 vor seinem Aufbruch verfasst. Er hoffte, mit Unterstützung der dortigen Landbevölkerung eine Guerillaarmee aufbauen zu können, um aus dem Andenland ein leuchtendes Beispiel und die Speerspitze einer kontinentalen Revolution zu machen. Doch die in erbärmlichen Verhältnissen lebenden Bauern, die Guevara zu den Subjekten seiner revolutionären Umwälzungen erhoben hatte, konnten seinen Ruf kaum vernehmen: Die überwiegende Mehrzahl von ihnen war des Lesens und Schreibens nicht mächtig. Breite und umgehende Resonanz fand die "Botschaft" hingegen von lateinamerikanischen Metropolen über nordamerikanische Universitäten bis in die europäischen Großstädte. Die von Guevara formulierte Parole "Schaffen wir zwei, drei … viele Vietnam" stieg umgehend zu einer der ikonischen Losungen der Neuen Linken auf.
Begünstigt wurde die weitreichende Rezeption der Botschaft Guevaras durch den historischen Kontext ihrer Veröffentlichung: Wenige Monate nach der Publikation sollten die Tet-Offensive in Vietnam, das Massaker auf der mexikanischen Plaza de Tlatelolco, der Aufzug sowjetischer Panzer in Prag und die Ermordung Martin Luther Kings bis dahin geografisch voneinander getrennt politisierte Milieus in eine scheinbar globalisierte Protestbewegung verwandeln. Doch ebenso bedeutsam für den Widerhall der "Botschaft an die Trikontinentale" war Guevaras zeitgleicher Kampf und dessen von vielen Zeitgenossen als tragisch aufgefasstes Ende in Bolivien. Sein Tod im Oktober 1967, den er in der "Botschaft" scheinbar prophetisch antizipiert hatte, unterstrich auf unumstößliche Weise das von Guevara personifizierte, christlich grundierte Ideal der Synthese von Wort und Tat. Die Hinrichtung Guevaras erhob diesen letzten zu Lebzeiten des Guerillakommandanten veröffentlichten Text gleichsam zu seinem politischen Vermächtnis. Die darin formulierte Programmatik und die dezidiert religiöse Metaphorik haben, neben dem praktischen Wirken Guevaras, dessen Verklärung zu einer "christomorphen Figur" maßgeblich beeinflusst.
#poster#punk#left side#berlin kreuzberg#plakat#posters#plakate#punk shop#print#disorder rebel store#che guevara#che#cuba#kuba#communism#kommunismus#revolution#class war
6 notes
·
View notes
Text
nd.DerTag
nd.DerTag 04.12.2023
https://www.nd-aktuell.de
CDU und AfD gegen Goldstein-Ehrung Beide Parteien wollen keine Straße nach dem Holocaust-Überlebenden und Antifaschisten benennen AfD und CDU wollen keine Straße nach Kurt Goldstein benennen.
dpa/Caro Teich
Dortmunder AfD-Vertreter verweisen auf die Rolle Kurt Goldsteins in der DDR. Die CDU springt auf den Zug auf und erklärt die Straßenbennenung für unangemessen.
Louisa Theresa Braun
Am Dienstag wird in Dortmund-Scharnhorst weiter darüber diskutiert, ob ein kleines Sträßchen im Stadtteil Grevel nach dem jüdischen Nazi-Verfolgten Kurt Goldstein benannt werden soll. Goldstein ist 1914 in Scharnhorst geboren, engagierte sich bis ins hohe Alter gegen Nazis und starb 2007 in Berlin. Eigentlich sollte die Scharnhorster Bezirksvertretung die Ehrung durch einen Straßennamen schon vor einem Monat beschließen, doch die Benennung wurde vertagt.
Grund dafür war Kritik von Seiten der AfD, die die CDU aufgriff: AfD-Vertreter Mike Dennis Barthold hatte erklärt, dass Goldstein zu DDR-Zeiten der SED angehörte, dies wollten die Christdemokrat*innen überprüfen und beantragten deshalb die Vertagung auf Dezember. Nun kommt CDU-Sprecher Jürgen Focke zu dem Schluss, dass Goldsteins Lebenslauf in der Erläuterung zur Bennenung »verkürzt und einseitig dargestellt« sei. Darin sei dessen Übersiedelung in die DDR und dessen Tätigkeit als Journalist in der DDR verschwiegen worden.
Laut den »Ruhr Nachrichten« wird die CDU in der Sitzung am Dienstag gegen die Straßenbenennung stimmen, da sie es nicht für angemessen halte, einen Straßennamen an einen Menschen zu vergeben, der seine eigene Tätigkeit im staatlichen Unterdrückungssystem der DDR kleingeredet und Stasi-Unrecht ausgeblendet habe. Grünen-Sprecher Marc Schmitt-Weigand dagegen sprach sich schon im November für den Straßennamen aus und appellierte an die CDU, sich von der AfD »nicht ins Bockshorn jagen« zu lassen, wegen einiger Schatten in Goldsteins Lebenslauf.
In seiner Jugend war Kurt Julius Goldstein in einer linken, jüdischen Gruppe, der SPD-Jugend und ab 1928 in der KPD-Jugend aktiv. Als 1933 seine Festnahme drohte, tauchte er unter, schloss sich einer zionistischen Organisation an und ging für ein Jahr nach Palästina. Ab 1936 beteiligte er sich als Interbrigadist am Krieg gegen Franco in Spanien. Nach der Niederlage im Bürgerkrieg wurde Goldstein erst in Frankreich interniert und 1942 in das Konzentrationslager Auschwitz gebracht. Er überlebte das Außenlager Jawischowitz und auch den Todesmarsch nach Buchenwald, wo er am 19. April 1945 den Schwur von Buchenwald ablegte.
1951 zog Goldstein in die DDR, arbeitete dort als Journalist und war bis in die späten 1970er Jahre Intendant der »Stimme der DDR«. Sein Leben lang setzte sich Goldstein, etwa als Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, gegen den Faschismus und für Aufklärung ein. 2005 erhielt er das Bundesverdienstkreuz als einer »der letzten lebenden und sich aktiv einbringenden Zeitzeugen des größten Verbrechens der deutschen Geschichte«.
Laut CDU-Sprecher Focke erkenne man Goldsteins antinationalsozialistische Aufklärungsarbeit an, doch »seine klare Ablehnung unserer demokratischen Grundrechte wie Rede-, Meinungs- und Reisefreiheit und dem Recht auf körperliche Unversehrtheit, der Basis unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung, wiegen für uns so schwer, dass wir einer Namensgebung nicht zustimmen können«. Er verweist auf einen Artikel im »Spiegel« von 1991, laut dem Goldstein SED-Chef Walter Ulbricht auf die Idee brachte, die Berliner Mauer zu bauen, indem er ihm davon erzählt habe, dass es auch im israelischen Jerusalem eine Mauer gebe, die den arabischen vom jüdischen Teil trennt.
Weniger schwer wiegt für die CDU offenbar, gemeinsame Sache mit der AfD zu machen, unter anderem mit Matthias Helferich, der für die AfD in der Bezirksvertretung Scharnhorst sitzt und einer der Hauptgegner der Straßenbenennung ist. Er soll sich selbst schon »das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus« genannt haben und ist wegen seiner Nähe zur extremen Rechten sogar innerhalb der AfD mit einer Ämtersperre belegt. Er steht der Jungen Alternative nahe und sein Büro in Dortmund ist laut Antifaschist*innen »Treffpunkt und Organisationszentrum der Neuen Rechten in NRW«.
»Von einem Vertreter der AfD denunziert zu werden, ist für jeden Demokraten eine Ehre«, erklärt dazu Christoph Heubner, der Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees. »Kurt Goldstein hätte es gegraust, mit den Stimmen der AfD auf einem Straßenschild seiner heimatlichen Welt zu landen.« Allerdings sollte die Bezirksvertretung Scharnhorst verstehen, dass Goldstein sein Leben dafür eingesetzt habe, »Rechtsextremen und neuen Nazis nie mehr die Straßen und die Köpfe der Menschen zu überlassen«. Dafür werde er von Auschwitz-Überlebenden in vielen Ländern hoch geachtet.
2 notes
·
View notes
Text
wenn ich deutsch üben möchte, höre ich ein wissenschaft podcast, die sehr interessant ist und dessen host ich sehr nett finde. am samstag sah ich, dass die selbe wissenschaftszeitschrift, die den podcast macht, eine folge von einen anderen podcast empfohlen hat.
mein deutsch ist nicht perfekt und bei diesem anderen podcast sprachen die leute sehr schnell. deshalb war es schwer für mich alles zu verstehen. es ging über wissenschaftskommunikation.
der mann, den befragt würde, erklärte wie er strittig themen bei seinem youtube channel diskutiert mit humor und eine wissenschaftliche perspektive. er sagte, dass er nur an die wissenschaftliche fakten achtet.
das fand ich als eine red-flag, weil ich unmöglich finde, dass man über soziale oder politische problemen ohne einen menschlichen perspektive reden kann. trotzdem dachte ich „vielleicht ist es wie wenn politiker sagen, dass aktion gegen die klimakatastrophe unmöglich ist, wegen die wirtschaft. aber tatsächlich interessiert sich das klima nicht für die wirtschaft. deswegen müssen wir an die wissenschaft achten.“
später habe ich gehört, dass der mann nannte ein paar beispiele. ich habe verstanden, dass sein beispiel war die existenz von nur zwei „biologischen geschlechtern“. in diesem moment waren meine früheren zweifel bestätigt, und ich habe aufgehört, die folge zu hören.
ich bin nicht 100% sicher, dass ich habe es richtig verstanden, aber ich möchte nicht noch mal hören und diese personen (wenn sie diese ideen wirklich vertreten) zu unterstützen.
edit: ich habe nur der zweite podcast aufgehört zu hören. die originale podcast finde ich noch gut und sie halten meinungen mit denen ich einverstanden bin.
4 notes
·
View notes
Text

IVD-Präsident Wohltorf: „Der Bremsklotz ist die Politik“ Berlin, 31. Januar 2025 – In Deutschland wurden im vergangenen Jahr 242 Milliarden Euro in private und gewerbliche Immobilien investiert. Das sind rund 12,6 Milliarden Euro oder 5,5 Prozent mehr als in 2023. Zu diesem Ergebnis kommt eine Hochrechnung des Immobilienverband Deutschland (IVD) auf Grundlage der Daten des Bundesministeriums für Finanzen zum Grunderwerbsteueraufkommen. Dazu erklärt Dirk Wohltorf, Präsident des Immobilienunternehmer-Verbands IVD: „Die Immobilienmärkte haben sich stabilisiert. Wir könnten mehr Bewegung in den Märkten und ein höheres Transaktionsvolumen sehen. Der Bremsklotz ist eindeutig die Politik. Die höchsten Baustandards in Europa, massive Marktregulierung und Grunderwerbsteuersätze von bis zu 6,5 Prozent sind klare Hemmnisse, für welche die Politik allein verantwortlich ist. Es fehlen zudem Impulse, die Kaufinteressenten bei der wichtigsten Investition ihres Lebens Mut machen. Neben einer Senkung der Grunderwerbsteuer und einem Verzicht auf die Besteuerung bei Ersterwerbern, die zur Selbstnutzung kaufen, gehören für private Erwerber und Investoren bessere steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten und gezielte Förderprogramme ohne ausufernde energetische Anforderungen dazu. Die Wirtschafts- und Wohnwende ist nötiger denn je. Jede Wohneinheit zählt.“ Zur Entwicklung der Immobilientransaktionen erklärt IVD-Präsident Wohltorf weiter: „Im Jahr 2023 war das Transaktionsvolumen um 30,3 Prozent eingebrochen. Jedoch konnten wir bereits im zweiten Halbjahr 2023 eine leichte Konsolidierung beobachten. Die Talsohle war durchschritten. Nun sehen wir anhand der Zahlen für 2024 eine solide Stabilisierung bei Investitionen in Immobilien. Die Immobilienmärkte beleben sich langsam wieder, die positive Tendenz ist messbar. So liegt das Transaktionsvolumen im zweiten Halbjahr 2024 mit rund 127 Milliarden Euro über dem des ersten Halbjahres mit 115 Milliarden Euro.“ Der IVD-Präsident führt die gestiegenen Umsätze auf den hohen Wohnraumbedarf und im Besonderen auf die anhaltende Attraktivität von Immobilien als Altersvorsorge zurück. Im vergangenen Jahr begünstigten die Zinssenkungen und die gestiegene Kaufkraft den Trend, dass sich potenzielle Erwerber wieder vermehrt nach Wohneigentum an den Märkten umsehen und kaufen. Der Süden und Westen legen zu Nach Bundesländern betrachtet, wurde vermehrt im Süden, im Westen und in der Mitte Deutschlands in Immobilien investiert. Das Transaktionsvolumen legte besonders in Bayern, dem Saarland, in Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zu. Zur Ermittlungsmethode Das Immobilientransaktionsvolumen beziehungsweise der Immobilienumsatz umfasst sämtliche private und gewerbliche Immobilientransaktionen, für die Grunderwerbsteuer zu entrichten sind. Da die überwiegende Zahl der Transaktionen – mit Ausnahme der Fälle, bei denen Erbschafts- und Schenkungssteuer anfallen sowie Share-Deals – dieser besonderen Umsatzsteuer unterliegen, ist diese Statistik ein probates Mittel, die jährlichen Immobilienumsätze zu erfassen. Der IVD ist die Berufsorganisation und Interessensvertretung der immobilienwirtschaftlichen Beratungs- und Dienstleistungsberufe. Der Verband vereint rund 6.200 mittelständische Mitgliedsunternehmen. Die Immobilienverwalter im IVD betreuen rund 3,5 Millionen Einheiten. Von den IVD-Maklern wird etwa jede dritte Immobilientransaktion in Deutschland beraten. Immobilienbewerter stellen die Königsklasse dar, wenn es um den Marktwert einer Immobilie geht. Zu den Mitgliedsunternehmen zählen auch Bauträger, Finanzdienstleister und weitere Berufsgruppen der Immobilienwirtschaft. Die Aufnahme in den IVD Bundesverband erfolgt nach Abschluss einer umfassenden Sach- und Fachkundeprüfung und gegen Nachweis einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung. Der Verband ist im Jahr 2004 aus einer Verschmelzung des ehemaligen RDM und VDM hervorgegangen. www.ivd.net Read the full article
0 notes
Text
Deutschlands Wirtschaftskraft entfachen

Deutschlands Wirtschaftskraft entfachen In einem hochmodernen Konferenzraum in Frankfurt, mit deckenhohen Fenstern, die den Blick auf eine pulsierende Skyline freigeben, sitzt Tobias Weber. Sein dunkelblauer Anzug aus feiner Schurwolle ist makellos, das weiße Hemd perfekt gebügelt. Er ist Unternehmensberater und grübelnd beugt er sich über eine Statistik: Deutschlands Produktivitätswachstum stagniert. Er presst die Lippen zusammen, während sein Gegenüber, Dr. Martina Fischer, eine renommierte Wirtschaftswissenschaftlerin in einem smaragdgrünen Kaschmirpulli, ihre Brille zurechtrückt. „Wir müssen dringend umdenken“, sagt sie nachdenklich. Innovationen als Wachstumstreiber Deutschland, bekannt für seine Ingenieurskunst und seine Präzisionsarbeit, steckt in einer Schaffenskrise. Automatisierung und Digitalisierung werden oft als Heilsbringer propagiert, doch viele Unternehmen hadern mit der Umsetzung. Eine Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung zeigt, dass deutsche Firmen im internationalen Vergleich zu langsam bei der Implementierung neuer Technologien sind. Die Kernfrage lautet: Wie kann Deutschland langfristig wettbewerbsfähig bleiben? 1. Automatisierung als Chance begreifen „Viele Unternehmen haben Angst vor dem Umbruch“, erklärt Dr. Fischer. Doch Automatisierung heißt nicht Jobabbau, sondern effizientere Prozesse. Tobias Weber erinnert sich an ein mittelständisches Unternehmen, das durch KI-gestützte Produktionsabläufe nicht nur Zeit, sondern auch immense Kosten einsparte. "Die Investition war hoch, aber die Rendite übertraf alle Erwartungen", berichtet er. Bildung als Schlüssel zur Produktivität 2. Weiterbildung als Pflicht, nicht als Option Der Wandel der Arbeitswelt erfordert lebenslanges Lernen. „Deutschland hinkt hinterher“, sagt Weber und tippt auf eine Grafik. Fachkräftemangel ist eine der größten Bedrohungen für die Wirtschaft. Unternehmen sollten ihren Mitarbeitern regelmäßige Schulungen anbieten, um digitale Kompetenzen zu fördern. 3. Startups und Forschung stärker fördern Eine florierende Wirtschaft braucht innovative Ideen. Deutschland hat weltweit einen hervorragenden Ruf für Forschung, doch zu oft verlaufen bahnbrechende Erfindungen im Sand, weil ihnen die finanzielle Unterstützung fehlt. Wagniskapital muss leichter zugänglich sein, um Startups die Chance zu geben, sich zu entfalten. Arbeitswelt neu gestalten 4. Flexiblere Arbeitsmodelle einführen In Skandinavien wird bereits erprobt, was in Deutschland noch kontrovers diskutiert wird: Vier-Tage-Wochen und hybride Arbeitsmodelle. Studien zeigen, dass produktivere Mitarbeiter weniger Stress haben, wenn sie flexibler arbeiten können. 5. Bürokratie abbauen Tobias Weber erinnert sich an ein Unternehmen, das Monate auf eine Genehmigung warten musste. „Bürokratische Hürden hemmen Innovation“, seufzt er. Schlankere Prozesse sind essenziell, um Wachstum nicht zu bremsen. Dr. Martina Fischer lehnt sich zurück und blickt nachdenklich aus dem Fenster. „Die Zukunft gehört den Mutigen“, sagt sie leise. Deutschland hat alle Möglichkeiten, seine Wirtschaftskraft neu zu entfachen – doch es muss handeln. "Fortschritt beginnt dort, wo Angst aufhört und Innovation beginnt." Read the full article
#ArbeitsweltderZukunft#AutomatisierungVorteile#BildungundProduktivität#BürokratieabbauUnternehmen#deutscheWirtschaft#DigitalisierunginDeutschland#FachkräftemangelDeutschland#InnovationenWirtschaft#Produktivitätsteigern#Wirtschaftswachstumsteigern
0 notes
Text

Die deutsche Wirtschaft unterschätzt die Gefahr von Cyberangriffen. Nicht einmal die Hälfte der Industrieunternehmen führt regelmäßige Cybersecurity Schulungen für ihre Beschäftigten durch, so die Ergebnisse des „OT+IoT Cybersecurity Report 2024“. Es ist höchste Zeit, Cyberresilienz in den Mittelpunkt zu rücken. 40 Prozent der Industrieunternehmen in Deutschland führen regelmäßige Schulungs- und Trainingsmaßnahmen in Sachen Cybersicherheit für ihre Beschäftigten durch. 27 Prozent haben Regeln und Verfahren für Cybersecurity in ihre Mitarbeiterhandbücher und Firmenrichtlinien aufgenommen. „Das klingt nach viel, aber es bedeutet letztlich, dass ein Großteil der Industrie der Frage, wie man sich vor Hackern schützen kann, noch zu wenig Beachtung schenkt“, sagt Jan Wendenburg, CEO des Düsseldorfer Cybersecurity-Spezialisten ONEKEY. Dies geht aus dem „OT+IoT Cybersecurity Report 2024“ von ONEKEY hervor. Das Resultat: Die deutsche Wirtschaft unterschätzt das Risiko von Hackerangriffen auf Maschinen, industrielle Steuerungen (Operational Technology, OT) und das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT). Laut Bericht sensibilisiert nur etwas mehr als ein Zehntel (11 Prozent) der Industrie seine Beschäftigten systematisch für Bedrohungen durch Cyberkriminelle. „Wenn ein Produktionsband oder ein Verpackungsroboter nicht richtig funktioniert, sollte der Maschinenführer auch den Fall einer Hackerattacke in Betracht ziehen“, gibt Jan Wendenburg ein Beispiel, „doch ohne Schulung wird genau das nicht passieren und die Erkenntnis, dass Hacker eingedrungen sind, setzt sich erst durch, wenn der Schaden längst angerichtet ist.“ Überprüfungen der Cyber-Resilienz bei über einem Drittel der Unternehmen unklar Immerhin führen 62 Prozent der untersuchten Industrieunternehmen regelmäßig Cybersecuritiy-Audits durch. 24 Prozent der Betriebe verlassen sich dabei auf externe Bewertungen, 18 Prozent auf interne, und 20 Prozent fahren hybrid mit eigenen und externen Audits. „Bei mehr als einem Drittel der Industrie scheint unklar, ob oder in welchem Umfang eine regelmäßige oder auch nur gelegentliche Prüfung der Resilienz gegenüber Hackerangriffen vorgenommen wird“, wundert sich Jan Wendenburg über den aktuellen Umgang mit einer der größten Bedrohungen unserer Zeit. Beinahe ein Fünftel (19 Prozent) der Befragten bekennt, dass bei ihnen keinerlei Audits zur Cybersicherheit statffinden, weder intern noch extern. Laut BKA bis zu 4.000 Angriffe am Tag Die Statistik des Bundeskriminalamtes (BKA) führt für das letzte Jahr beinahe 135.000 offiziell gemeldete Fälle von Cyberkriminalität auf und geht dabei von einem Dunkelfeld von 90 Prozent aus. „Das entspräche mehr als 4.000 Angriffen am Tag“, warnt der ONEKEY-CEO. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) schreibt in seinem Lagebericht zum vergangenen Jahr: „Die Bedrohung durch Cybercrime ist so hoch wie nie zuvor.“ Der Bedrohungslage zum Trotz ist laut Umfrage weniger als die Hälfte der Unternehmen (46 Prozent) mit den getroffenen Maßnahmen zum Schutz gegen Cyberkriminelle zufrieden. „Es wird höchste Zeit zum Handeln“, mahnt Jan Wendenburg. Er führt aus: „Ein erster Schritt besteht darin, die Software in allen Connected Devices einer gründlichen Prüfung zu unterziehen, und eventuelle Schwachstellen aufzudecken.“ Product Cybersecurity & Compliance Platform als Basis für Prüfungen ONEKEY betreibt hierfür eine Product Cybersecurity & Compliance Platform (PCCP), um die Software in industriellen Steuerungen und in vernetzten Geräten einer gründlichen Analyse zu unterziehen und Sicherheitslücken aufzudecken. „Eine solche Prüfung dokumentiert den Ist-Zustand und gibt konkrete Hinweise, an welchen Stellen Verbesserungen angeraten sind“, erklärt Jan Wendenburg. Er gibt zu bedenken: „Wer ab 2027 ein vernetztes Elektronikprodukt mit bekannten ausnutzbaren Schwachstellen auf den EU-Markt bringt, haftet dafür mit bis zu 15 Millionen EUR. Der Dokumentation der Sicherheit fällt also nicht nur technisch, sondern auch rechtlich und finanziell eine Schlüsselrolle zu.“ Allein in der ersten Hälfte 2024 hat das US-amerikanische National Institute of Standards and Technology (NIST) rund 15.000 „Common Vulnerabilities and Exposures“ (kurz CVEs), also Sicherheitslücken und Schwachstellen in Software, veröffentlicht. „Die Herausforderung ist groß“, sagt Jan Wendenburg, und erklärt: „Umso dringlicher ist es, die für eine Verbesserung der Cybersecurity entlang der gesetzlichen Anforderungen notwendigen Maßnahmen zügig auf den Weg zu bringen. Audits und Schulungen der Beschäftigten spielen dabei eine Schlüsselrolle. Wir empfehlen dies in die Liste der guten Vorsätze für 2025 aufzunehmen – und dann dies auch umzusetzen.“ KI identifiziert kritische Lücken in der Cybersecurity ONEKEY ist Europas führender Spezialist für Product Cybersecurity & Compliance Management und Teil des Investmentportfolios von PricewaterhouseCoopers Germany (PwC). Die einzigartige Kombination aus einer automatisierten Product Cybersecurity & Compliance Platform (PCCP) mit Expertenwissen und Consulting Services bietet schnelle und umfassende Analyse, Unterstützung und Management zur Verbesserung der Produkt Cybersecurity und Compliance vom Produkt Einkauf, Design, Entwicklung, Produktion bis zum End-of-Life. Kritische Sicherheitslücken und Compliance-Verstöße in der Geräte-Firmware werden durch die KI-basierte Technologie innerhalb von Minuten vollautomatisch im Binärcode identifiziert - ohne Quellcode, Geräte- oder Netzwerkzugriff. Durch die integrierte Erstellung von "Software Bill of Materials (SBOM)" können Software-Lieferketten proaktiv überprüft werden. „Digital Cyber Twins“ ermöglichen die automatisierte 24/7 Überwachung der Cybersicherheit auch nach dem Release über den gesamten Produktlebenszyklus. Der zum Patent angemeldete, integrierte Compliance Wizard™ deckt bereits heute den EU Cyber Resilience Act (CRA) und Anforderungen nach IEC 62443-4-2, ETSI EN 303 645, UNECE R1 55 und vielen anderen ab. Das Product-Security-Incident-Response-Team (PSIRT) wird durch die integrierte, automatische Priorisierung von Schwachstellen effektiv unterstützt und die Zeit bis zur Fehlerbehebung deutlich verkürzt. Passende Artikel zum Thema Read the full article
0 notes
Link
0 notes
Audio
(TaxPro GmbH Steuerrechts-Experten)#
JETZT sind die Wahlprogramme der Parteien zur Bundestagswahl 2025 offiziell. Welche Partei verspricht wieviel Geld? Bei welcher Partei ist am meisten drin für Steuern und Rente? Alle Wahlprogramme erklärt RA Lederer im TaxPro Wahlcheck heute. Sei dein eigener Steuerberater mit PepperPapers.de 🌶️ Hol dir dein Rechtsdokument 🌶️ https://pepperpapers.de ________________________________________ Die Quellen zum Podcast: Sei dein Steuerberater mit PepperPapers.de 🌶️ Hol dir deinen Mustereinspruch hier 🌶️ https://pepperpapers.de/produkt-kategorie/finanzamt/einspruch-steuerbescheid-3/
Hast du Ärger mit dem Finanzamt? Buche dir direkt deine Erste Hilfe Beratung 🌶️ https://pepperpapers.de/produkt/individuelle-erste-hilfe-beratung/
Mach dich schlau! Hol dir alle Infos rund um dein Geld 🌶️ im PepperPapers Newsblog https://pepperpapers.de/news/ 👉 im TaxPro Newsblog https://www.taxpro-gmbh.de/news
Mehr Videos zum Thema: Lindner plant Steuererhöhung für Rentner! Weniger Netto vom Brutto! https://youtu.be/AZrN8JttxO4
Alarmstufe Rot 🇩🇪Wirtschaft stürzt ab! DAS muss Berlin JETZT machen! https://youtu.be/AnX9S5iUNt0
Grundsteuer Chaos in Deutschland! https://www.youtube.com/@UCGrQfvVlhJJfgjCLk6WppOw
Angriff aufs Bargeld I Neues Gesetz kommt am 1. Januar 2023 https://youtu.be/J_J_F98IiAY
Neue Gesetze 2025 sind offiziell! Mehr Geld FÜR ALLE! https://youtu.be/TzjvcBV1Hjw
Die Wahlprogramme der Parteien zur Bundestagswahl 2025 #neuwahlen #bundestagswahl CDU/CSU: https://www.politikwechsel.cdu.de/sites/www.politikwechsel.cdu.de/files/docs/politikwechsel-fuer-deutschland-wahlprogramm-von-cdu-csu-1.pdf
AfD: https://www.afd.de/wp-content/uploads/2024/11/Leitantrag-Bundestagswahlprogramm-2025.pdf
FDP: https://www.fdp.de/das-wahlprogramm-der-freien-demokraten-zur-bundestagswahl-2025
SPD: https://www.spd.de/bundestagswahl
Grüne: https://cms.gruene.de/uploads/assets/20241216_BTW25_Programmentwurf_DINA4_digital.pdf
Linke: https://www.die-linke.de/politische-bildung/wahlkampfbildung-bundestagswahl-2025/
0 notes
Link
#Altersarmut#Altersvorsorge#Betriebsrente#Demographie#Doppelverbeitragung#Rente#Rentenkasse#Rentenniveau#Rentenversicherung#Sozialversicherung#Staat
0 notes
Text
Studie über schnelleren Weg in die Ausbildung – Bayern hilft beim Start ins Arbeitsleben
15. Januar 2025 - Scharf: „Es ist keine Schande Unterstützungsangebote in Anspruch zu nehmen – dafür sind sie da“Tausende Jugendliche treten nach der Schule Praktika oder andere Übergangsmaßnahmen an, anstatt unmittelbar eine Ausbildung zu beginnen. Das geht aus einer am Mittwoch bekannt gewordenen Studie der Bertelsmann Stiftung hervor. Damit der Anschluss schnell und dauerhaft gelingt, gibt es in Bayern kompetente und individuelle Beratung. Dazu erklärt Bayerns Arbeitsministerin Ulrike Scharf: „Auszubildende sind unsere Rohdiamanten von morgen. Ein guter Start ins Berufsleben ist für junge Menschen und die Wirtschaft wichtig, um fit für die Zukunft zu sein. Wir benötigen auch ausreichend Fachkräfte, um aus der Rezession zu kommen. Um Jugendliche dabei zu unterstützen, den richtigen Beruf zu finden, ist eine frühzeitige und umfassende Berufsorientierung wichtig. Bayern bietet zahlreiche Unterstützungsangebote.“ Ø Die Plattform BOBY ermöglicht einen flächendeckenden und aktuellen Überblick über alle Aktivitäten zur Berufsorientierung. Die Internetseite wurde zuletzt umfassend überarbeitet und bietet nun einen noch besseren Überblick über Berufsorientierungsmaßnahmen in ganz Bayern. Ø Auf der BERUFSBILDUNG 2025, der größten Berufsorientierungsmesse im deutschsprachigem Raum, die vom 8. bis 11. Dezember 2025 stattfindet, können sich Schülerinnen und Schüler hautnah einen umfassenden Überblick über alle Ausbildungsmöglichkeiten verschaffen. Ø Die Ausbildungsakquisiteurinnen und -akquisiteure (AQ) bieten jungen Menschen mit Unterstützungsbedarf individuelle Hilfe bei der Ausbildungsplatzsuche an und bauen bei Betrieben Vorurteile ab. Laut der Bertelsmann-Studie nehmen pro Jahr fast 250.000 Jugendliche eine staatlich geförderte Maßnahme wahr, weil sie keinen Ausbildungsplatz finden. Zwei Drittel davon könnten aber direkt in den Beruf einsteigen. Eine individuelle Beratung könne hier teilweise entscheidend sein, so die Autoren. Scharf erklärt dazu: „Dass die Angebote durch die jungen Menschen angenommen werden, ist eine gute Entwicklung. Es ist keine Schande, Unterstützungsangebote wahrzunehmen – dafür sind sie da. Insgesamt ist die Situation in Bayern für junge Menschen, die eine Ausbildung machen wollen, im Bundesvergleich gut.“ Im September 2024 standen in Bayern 62.161 gemeldeten Bewerberinnen und Bewerbern 99.722 gemeldete Berufsausbildungsstellen zur Verfügung. Das entspricht 1,6 Stellen pro Suchendem. Zum Vergleich: Im Bund sind es 1,2.
StMas Winzererstraße 9, 80797 München
0 notes
Text

Lohnsteuer ganz einfach erklärt: So nutzen Sie Ihr Wissen, um Steuern zu sparen und finanzielle Vorteile zu sichern. Was ist Lohnsteuer und wie lassen sich die Abzüge senken? Die Lohnsteuer (LSt) ist eine Form der Einkommensteuer (ESt), die direkt bei jeder Lohnzahlung vom Arbeitslohn einbehalten wird. Sie ist also keine besondere Steuer. Denn der Begriff beschreibt nur das Verfahren, dass die Lohnsteuer gleich von Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit im Sinne des § 19 EStG (Lohn, Gehalt …) abgezogen wird. Die Lohnsteuer gehört zu den wichtigsten Steuerarten in Deutschland. Quelle: https://de.serlo.org/wirtschaft/184763/steuern Lohnsteuer wird von "Arbeitgebern" an das Finanzamt abgeführt. "Arbeitnehmer" zahlen ihre Steuer somit automatisch mit jeder Gehaltsabrechnung. Wie steht das genau im Gesetz? Die rechtlichen Grundlagen zur Lohnsteuer und zum Lohnsteuerabzug sind im Einkommensteuergesetz (EStG) geregelt, vor allem in den § 38 bis § 42f EStG. § 38 Erhebung der Lohnsteuer (1) Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit wird die Einkommensteuer durch Abzug vom Arbeitslohn erhoben (Lohnsteuer), soweit der Arbeitslohn von einem Arbeitgeber gezahlt wird" ... (2) Der Arbeitnehmer ist Schuldner der Lohnsteuer. Die Lohnsteuer entsteht in dem Zeitpunkt, in dem der Arbeitslohn dem Arbeitnehmer zufließt. (3) Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer für Rechnung des Arbeitnehmers bei jeder Lohnzahlung vom Arbeitslohn einzubehalten." Einkommensteuergesetz (EStG) § 38 Welche Vorteile können Sie aus Ihrem Lohnsteuer-Wissen ziehen? Mit dem sofortigen Abzug der Lohnsteuer will der Staat nicht nur sicherstellen, dass möglichst zeitnah und genau die Steuern einbehalten werden. Dazu dient der Steuerabzug bei jeder Lohnzahlung. Damit die Lohnsteuer auch möglichst in der richtigen Höhe einbehalten wird, sind den Steuerpflichtigen Lohnsteuerklassen zugeordnet. Darüber hinaus müssen die "Arbeitgeber" vor dem Lohnsteuerabzug elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale gem. § 39 EStG von der Finanzverwaltung abrufen, wodurch weitere persönliche Faktoren berücksichtigt werden. Diese Merkmale ersetzen die Angaben auf der früheren Lohnsteuerkarte. Sie können von den Steuerpflichtigen bei ihrem Wohnsitzfinanzamt gemäß § 39a EStG beantragt und geändert werden. Das Verständnis der Lohnsteuerabzugsmerkmale bietet viele Vorteile: - Steuerklassen optimieren: Mit der Wahl der richtigen Steuerklasse können Ehepartner und Alleinerziehende Ihre monatlichen Abzüge erheblich senken. - Freibeträge beantragen: Freibeträge für Werbungskosten, Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen müssen "Arbeitgeber" dann schon bei jeder Lohnzahlung berücksichtigen. - Steuererklärung gewinnbringend nutzen: Steuerklassen und elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale sollen eine möglichst genaue Steuerberechnung begünstigen. Doch prüfen Sie, auch wenn Sie keine Steuererklärung abgeben müssen, ob Sie damit vielleicht weitere Rückerstattungen erzielen. - Lohnsteuerrechner verwenden: Mit einem Lohnsteuerrechner können Sie die jeweiligen Abzüge und Vorteile im Voraus kalkulieren und entscheiden, wie Sie die größtmöglichen Vorteile erzielen. - Steuerfreie Sachleistungen nutzen: Nutzen Sie auch die Möglichkeiten, mit Ihrem "Arbeitgeber" steuerfreie Sachleistungen zu vereinbaren. Damit erreichen Sie in der Regel größere Vorteile als mit einer Erhöhung des Bruttolohns oder -gehalts. Was sollten Sie beachten, um keinen Schaden zu erleiden? Die meisten Steuerpflichtigen warten immer erst bis zur Steuererklärung, ob sie noch Steuern nachzahlen müssen oder Rückerstattungen bekommen. Dabei werden oft Steuern verschenkt, weil im Nachhinein kaum noch Korrekturen zulässig sind. Deshalb, vermeiden Sie die häufigsten Fehler: - Fehler bei Freibeträgen vermeiden: Beantragte Freibeträge müssen gerechtfertigt sein, sonst drohen Nachzahlungen. - Sonderzahlungen im Blick haben: Urlaubs- oder Weihnachtsgeld können in höhere Steuerabzüge münden, da sie den Steuersatz kurzfristig erhöhen. - Lohnersatzleistungen berücksichtigen: Lohnersatzleistungen wie Krankengeld, Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld und andere sind zwar häufig steuerfrei, aber erhöhen aufgrund des Progressionsvorbehalts die Steuerlast. Kalkulieren Sie das rechtzeitig ein. - Steuerklassenwechsel prüfen: Ein Wechsel der Steuerklasse kann in bestimmten Lebenssituationen, wie Heirat, Trennung, Arbeitslosigkeit, sinnvoll sein – sollte aber gut durchdacht werden. - Beratung suchen und nutzen: Komplexe Sachverhalte und ständige Steueränderungen sind für den Einzelnen oft kaum hinreichend überschaubar. Scheuen Sie sich nicht, Experten zu konsultieren. Wie heißt ein oft gebrauchter Rat von Anwälten: Guter Rat ist teuer, kein Rat oft teurer. Wie denken andere über „Lohnsteuer“? Die Meinungen zu Steuern, also auch Lohnsteuer sind vielfältig. Während viele die automatische Abführung schätzen, empfinden andere die Abzüge als intransparent oder zu hoch. Foren wie gutefrage.net oder Diskussionsplattformen wie Reddit bieten spannende Einblicke in die Erfahrungen und Meinungen anderer Arbeitnehmer. Aus den USA: "Für alles gibt es eine Arznei, außer gegen Tod und Steuern." Deutsches Sprichwort: "Bete und arbeite, sei nicht faul, zahl fleißig deine Steuern und halte das Maul." Das Gehaltsaxiom: "Die Gehaltsaufbesserung ist gerade so hoch, dass man mehr Steuern bezahlen muss, aber zu niedrig, als dass man netto mehr ausgezahlt bekäme." Leo Trotzki (1879 – 1940): "Steuern, Löhne, Preise und Kredit sind die Hauptmittel der Verteilung des nationalen Einkommens, für die Stärkung bestimmter Klassen und die Schwächung anderer." Weiterführende Links zu Lohnsteuerklassen nach § 38b EStG Lohnsteuerrechner des Bundesministeriums der Finanzen BMF-Schreiben vom 13. 12. 2024 - Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM); Lohnsteuerabzug im Verfahren der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale Read the full article
0 notes