#Aquines
Explore tagged Tumblr posts
Text

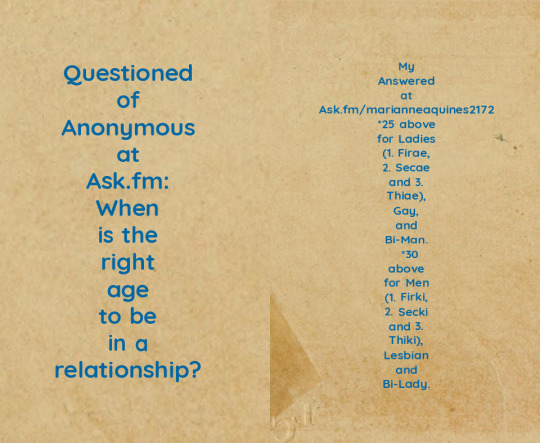
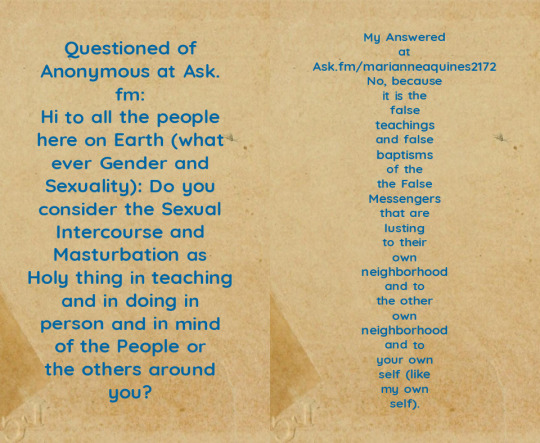
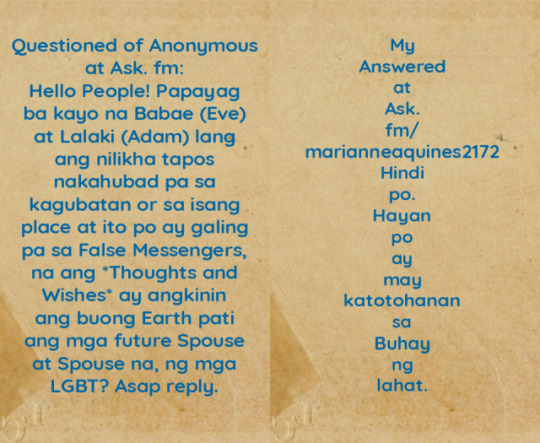


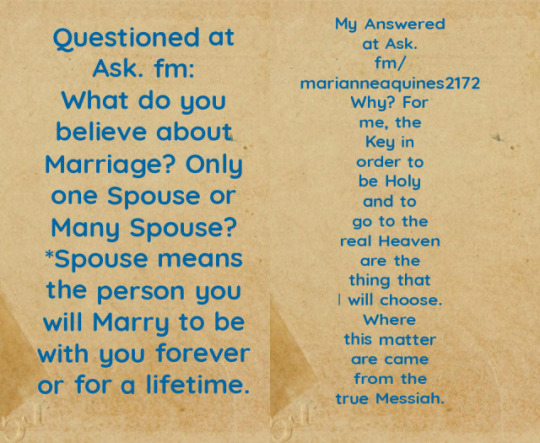
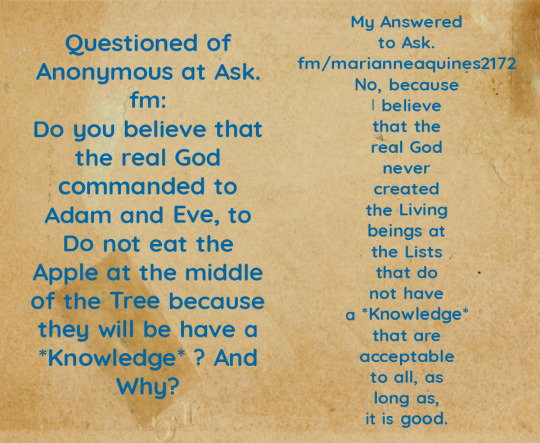
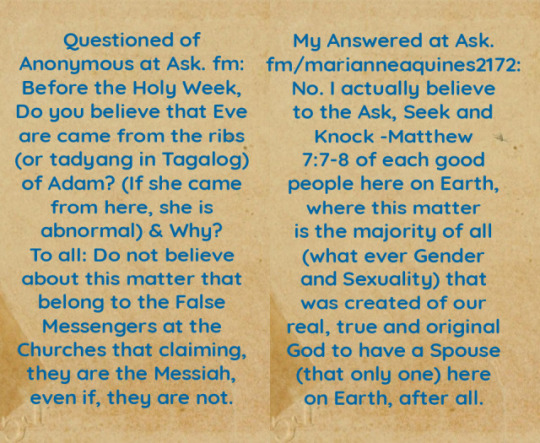
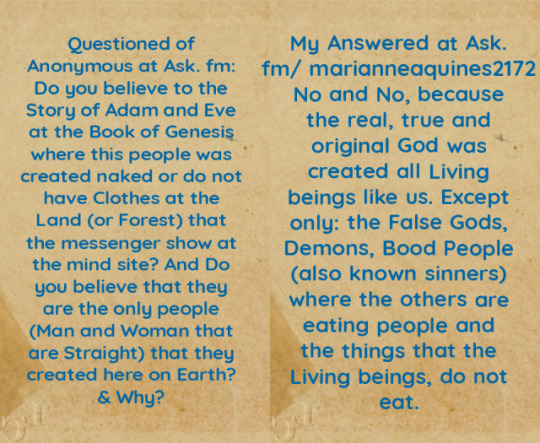
#facts#truths#My Answered at Ask.fm#Anonymous Question#marianneaquines2172#M.J. Aquines#Tomian#Tomian Barwaqui#tomianbarwaqui#Marianne#Joy#Aquines#Ask. fm#Tumblr
0 notes
Text



alternative AQUIN, cis-aligned, & cis man flags.
flags by us. for cam, 🔖, & S7. tagging @radiomogai & @in-nature-archive.
20 notes
·
View notes
Text









yarrrrr!! in celebration of the start of pirate week, here's my pirates; the crew of the Call Corruption. they're a nasty crew of pirates who have been wrecking havoc on shipping vessels exiting the Windswept Plateau and Ashfall Wastes for their exported goods.
#flight rising#fr#dragon share#the undertides tropica (orange one) and aquin (red one) fuck up the sides of enemy boats and bite off their rudders while every one else#moves the ship in to attack! it's usually a very effective strategy on wooden boats. metal ones.... not so much
17 notes
·
View notes
Text
Exister et subsister
“Phénomènes” ©Philippe Quéau (Art Κέω) 2025 Le phénomène est « tout ce qui apparaît », disent les phénoménologues. Mais quid de tout ce qui n’apparaît pas dans le phénomène, tout ce qui reste en dehors de sa lumière propre, tout ce qui disparaît dans son ombre. Si le phénomène est censé apparaître dans la lumière, quelle est la nature de l’ombre que cette lumière occulte, et que voile-t-elle,…

View On WordPress
0 notes
Text
Naturrecht heute – Zur Aktualität einer alten Denkfigur
Dass die menschliche Natur etwas mit der Moralität und dem Rechtsempfinden des Menschen zu tun hat, steht außer Frage. Was seit jeher umstritten ist und – soviel ist klar – auch weiterhin heftig umstritten sein wird, das ist die Frage, was wir denn meinen, wenn wir von der „Natur“ sprechen.
Über die natura humana
Wenn Thomas von Aquin die natura humana anspricht, um den Hang des Menschen zum Guten zu erklären, meint er nicht das gewordene Genmaterial, sondern den seienden Geist Gottes, der das menschliche Gewissen formt, vor dessen Urteilskraft dem Menschen Tugenden und Laster als solche identifizierbar sind.
Wenn die Aufklärer von „Vernunftnatur“ sprechen, erscheint ihnen dabei die menschliche Ratio als unbestechlicher „Gerichtshof“ (Kant), der in der Lage ist, Handlungen (eher: handlungsleitende Maxime und Normen) letztgültig als gut oder böse zu qualifizieren.
Thomas von Aquin meinte, der Mensch könne aus dem „Ewigen Gesetz“ Gottes das „Natürliche Gesetz“ erkennen (und zwar qua Vernunft), um daraus konkrete Schlüsse zu ziehen für Einzelvorschriften auf den unterschiedlichen Ebenen der, wie wir heute sagen würden, Individual-, Sozial- und Institutionenethik. Dabei wird das Gebot Gottes durch die Natur des Menschen in ein säkulares Rechtssystem überführt, dem alle – unabhängig von ihrer Religion – zustimmen können.
Das Naturrecht bleibt aber Ausdruck des inneren menschlichen Gespürs für das Gute und Richtige, weil sich dessen Naturbegriff nicht in der Biologie des Menschen, etwa seinen Instinkten und Trieben, erschöpft, sondern den Menschen als vom Geist der Vernunft durchdrungene leiblich-seelische Einheit sieht, die im Gewissen eine Instanz kennt, vor der sich das göttlich-natürliche Recht nicht nur als richtig, sondern auch als wahr mitteilt – unabhängig davon, was die Mehrheit daraus erkannt hat und in das faktisch geltende Rechtssystem zu überführen in der Lage war.
Nach den Erfahrungen von zwei Diktaturen auf deutschem Boden wissen wir, wie wichtig es sein kann, in diesem Sinne zwischen Recht und Gesetz zu unterscheiden – und sich im Zweifel auch illegal zu verhalten.
Benedikt über das Naturrecht
In seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag am 22. September 2011 griff Papst Benedikt XVI. diesen Naturrechtsgedanken auf. Das Generalthema in Benedikts Rede war die Frage nach den „Grundlagen des freiheitlichen Rechtsstaats“, also die Frage nach Gerechtigkeit.
Es war eine rechtsphilosophische Vorlesung zu den Quellen des Legalen im Guten und Wahren, sprich: im Naturrecht. Die Grundfrage war eine für das politische Geschäft entscheidende:
Was ist die Basis des positiven Rechts, also: der Gesetze?
Woher begründet sich der Umstand, dass die Gesetzgebung (also: das von Benedikt adressierte Parlament) Regeln erlässt, die Dinge allgemein ge- oder verbieten?
Eine mögliche und naheliegende Antwort lautet: Aus dem Mehrheitsprinzip. Das ist nicht falsch, muss aber in Einzelfällen hinter der Ahnung davon zurückweichen, dass bestimmte Dinge unserer Fähigkeit zur Konventionierung oder Konfektionierung entzogen sein sollten.
Wahrheit ist manchmal ungleich Mehrheit, Mehrheit garantiert nicht immer Wahrheit. Dieser Gedanke ist der Grund naturrechtlicher Überlegungen, Motiv der Suche nach einer Gewissheit jenseits dessen, was räumlich und zeitlich isoliert als „gewiss“ zu gelten hat.
Es ist die Suche nach Wahrheit jenseits von Stimmigkeit, von Stimmung. Es ist die Suche nach der Natur des Menschen, nach einem Sein, das die Konstante bildet bei dem Versuch, Gerechtigkeit zu schaffen durch ein Sollen.
Doch kann man ethische Normativität (Sollen) tatsächlich aus dem entnehmen, was ist, also aus der Natur des Menschen (Sein)?
Nein, soweit das Sein im Sinne der positivistischen Weltsicht ein funktionalistisches System meint, das sich wissenschaftlich komplett beschreiben lässt.
Ja, soweit es Gottes Schöpfung meint, eine Natur, der Vernunft und Freiheit eingestiftet sind.
Um diese Natur geht es im Naturrecht, diese Natur des Menschen meinen Thomas und Benedikt. Nur eingedenk dieser Natur lässt sich Kultur schaffen, kann der Rechtsstaat gelingen.
Der naturalistische Schluss vom Sein auf das Sollen geht nur fehl, wenn er auf einer positivistischen Naturauffassung basiert. Umgekehrt lässt sich die Dichotomie von Sein und Sollen aufheben, indem die Natur des Menschen nicht nur funktionalistisch, sondern als Ausdruck des göttlichen Willens verstanden wird.
Darin wiederum mag man sogar einen Hinweis entnehmen auf das fundamentale Unrecht, das Menschen (auch innerhalb der Kirche!) begehen, wenn sie die menschliche Natur und den göttlichen Willen missachten – stehe in Normen und Regeln, was auch immer dort stehe, fordere die Welt, was auch immer sie fordere.
Wir landen am Ende wieder beim Gewissen – bei Salomons „hörendem Herz“, wie es Benedikt zitierte.
Das holistische Konzept der Natur
Der rechtphilosophische Diskurs mündet bei Benedikt dort, wo er mit Blick auf die Naturrechtstradition begann: in einem holistischen Konzept von Natur, dass über die biologische Bedingtheit, die Körperlichkeit, die Umwelt hinaus auf das Wesen des Menschen verweist.
Dieser Blick auf „Natur“ schaut zwar auch auf die Schöpfung, aber immer in der Perspektive auf die „Ökologie des Menschen“ (Benedikt), denn: „Auch der Mensch hat eine Natur, die er achten muß und die er nicht beliebig manipulieren kann“. Daraus folgt die moralische Notwendigkeit eines Lebensschutzes im umfänglichsten Sinne, wie ihn etwa der im Dezember 2018 verstorbene katholische Philosoph Robert Spaemann vertrat, indem er sich gleichermaßen gegen Abtreibung und Atomkraft wandte.
Die Rede Benedikts von der „Ökologie des Menschen“ und die Naturrechtsphilosophie Robert Spaemanns nahm Andrzej Kuciński jüngst auf, um ein wirklich beachtliches Werk vorzulegen: „Naturrecht in der Gegenwart. Anstöße zur Erneuerung naturrechtlichen Denkens im Anschluss an Robert Spaemann“, 2017 erschienen bei Schöningh (Paderborn).
Rehabilitierung des Naturrechts
Kuciński holt das Naturrecht ab, wo es steht: in der Schmuddelecke des ethischen Diskurses. Er nimmt dabei die Einwände durchaus ernst, doch betont zugleich die Notwendigkeit einer Rehabilitation des Naturrecht.
Dafür stehen die Chancen gut: „Das Naturrecht rechtsphilosophisch bzw. moraltheologisch in Frage zu stellen, muss nicht notwendigerweise heißen, seine Idee gänzlich zu verwerfen“.
Hier holt sich der Verfasser sogleich Robert Spaemann zur Hilfe, der genau dafür steht: die Idee des Naturrechts neu zu begründen. Gleichwohl ist dieser Ansatz voraussetzungsreich: die Existenz Gottes wird ebenso angenommen wie die positive Rolle des Christentums als Beitrag „zur Rettung der Moderne“.
Das Naturrecht mag daher als Berufungsinstanz in der säkularen Ethik und einer daran orientierten Politik längst verschwunden sein, doch auf dem Spiel steht nach wie vor (und mehr denn je) was Kuciński die „Identität der Menschennatur“ nennt. Hier sieht er die Brücke zur Ethik Spaemanns, denn: „Kein anderer Philosoph hat den konstitutiven Zielbezug des Naturrechts auf die Person des Menschen als allem Denken vorausliegendes Sein so deutlich herausgearbeitet wie Robert Spaemann.“
Dabei sind zwei Dinge entscheidend:
1. die Definition der menschlichen Natur und damit die Bestimmung von Regeln für den geeigneten Umgang mit ihr, einschließlich von Grenzen für ihre Manipulation, und
2. die Begründung des naturrechtlich konstitutiven Verhältnisses von Faktizität (das Sein) und Normativität (das Sollen), das immer wieder umstritten ist (Stichwort: „naturalistischer Fehlschluss“) und sich andererseits auch sehr leicht missverstehen lässt – abhängig davon, was unter „Natur“ verstanden wird.
Beide Aufgaben löst Spaemann überzeugend. Insoweit kann er zurecht als Ausgangspunkt einer Erneuerung naturrechtlicher Ideen herangezogen werden.
Ebenso wie für eine überzeugende Begründung der Kategorie des „Zwecks“ in der Naturrechtsphilosophie – gegen den Begriff des „Zufalls“, der im Evolutionismus leitend ist.
Dass sich Kuciński (bzw. Spaemann, auf den Kuciński sich insoweit ganz eng bezieht) so intensiv mit der Frage der teleologischen Struktur des Naturgeschehens auseinandersetzt, hat einen Grund: Anders lässt sich der Mensch im Rahmen des Naturrechts nicht verstehen.
Die Teleologie ist die anthropologische Grundannahme des Naturrechts.
Nur, wenn der Mensch als zweckhaft und sinnvoll gedeutet wird, hat es Sinn, aus seiner Natur Rückschlüsse für Moral und Recht zu ziehen. Wäre sein Dasein zufällig, sprunghaft, launisch, sinnlos, so wäre es nicht möglich, daraus normative Maßgaben zu entwickeln.
Zweck und Sinn machen aus dem Menschen eine „Person“.
Der Person-Begriff Spaemanns ist der Schlüssel zum Verständnis seiner naturrechtlichen Ethik. Dazu gehört – wichtig für den Lebensschutz –, dass alle Menschen zugleich Personen sind, der Person-Begriff also keine Zusatzqualifikation beinhaltet (wie etwa bei Peter Singer).
Die Person steht bei Spaemann in enger Verbindung mit der entscheidenden Denkfigur einer vorrechtlichen Moralität, der Menschenwürde. Sie ist nicht von ungefähr Dreh- und Angelpunkt des naturrechtlichen Überhangs unseres Grundgesetzes, das in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag feiert.
Aber auch ethische Konzepte wie ���Wahrheit“, „Versprechen“, „Anerkennung“ fußen darauf, dass wir es mit Personen zu tun haben, die sich wahrhaftig, zuverlässig und gleichrangig begegnen.
Ausblick: Naturrecht heute
Dieses Menschenbild erfordert Grenzen.
Was soll mit Personen nicht geschehen?
In keinem Fall dürfen sie verzweckt werden, also gezwungen sein, ihren Selbstzweck aufzugeben, zugunsten eines „höheren“ Zwecks. Das begrenzt etwa die Verantwortung, die ein Mensch hat – auch das ist heute ein wichtiger Gedanke, wenn allzu oft davon die Rede ist, dem „Planeten Erde“ oder der „Menschheit“ insgesamt etwas zu schulden.
Hier ist Vorsicht geboten – nicht nur nach Kuciński und Spaemann, sondern bereits nach Kant. Es geht dem Naturrecht um die Bewahrung des Humanen – auch in der Methodik seiner Befolgung.
#naturalismus#naturrecht#kant#thomas von aquin#spaemann#humanismus#religion#christentum#glaube#rechtsphilosophie#philosophie#dr. bordat
0 notes
Text

„Liebe ist das Wohlgefallen am Guten. Das Gute ist der einzige Grund der Liebe. Lieben heißt: Jemandem Gutes tun wollen.“
hl. Thomas von Aquin (1224 - 1274)
Quelle
#heiliger thomas von aquin#religion#glaube#christ#gott#römisch katholische kirche#christentum#betrachtung#christianity#faith#jesus#Liebe#Love#meaning of love#bedeutung der liebe#der alltagskatholik
0 notes
Text
Performance-installation du compositeur Sandeep Bhagwati au MBAM coprésentée avec la SMCQ (CA)
Photo : SMCQ-MBAM_Performance-installation Samedi 20 avril et dimanche 21 avril 2024 / 10 h à 17 h Gratuit à l’achat d’un billet d’entrée au MBAM Pavillon Jean-Noël Desmarais, S2 La Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ) s’associe au Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) pour présenter une performance-installation du compositeur de renommée internationale Sandeep Bhagwati. Sur…

View On WordPress
#1380 Rue Sherbrooke O Montréal#Andi Teichmann#Deniza Popova#Eva Glasmacher#Hannes Teichmann#Klaus Janek#Longueuil#Lucy Zhao#Montréal#Murat Gürel#Musée#Musée des beaux-arts de Montréal#Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM)#musée Gropius Bau#Patricia Lachance Michèle-Andrée Lanoue#Paumé arts et littératures#Pavillon Jean-Noël Desmarais#Performance-installation du compositeur Sandeep Bhagwati au MBAM coprésentée avec la SMCQ (CA)#QC H3G 1J5#Reza Abaee#Sandeep Bhagwati#Société de musique contemporaine du Québec#Stéphane Aquin#Terri Hron#Valentina Plata
1 note
·
View note
Text



"Hello Anghel". "Saan ka na?".
1 note
·
View note
Text
i dreamed up an entire sc/arecrow (j/onathan cr/ane) film and despite some moments that should have told me it was a dream but i ignored and assumed was just w/arner b/ros being w/arner b/ros, im extremely saddened to wake up and learn its not real
#in the universe of t/b2022 ofc#w a cameo of jo/aquins jo/ker tho which is funny#it was the third film in line too not. ounting the pengy show#the second film was victor f/ries lnao#m/r fr/eeze for the folks wjo dont know#raiiot#tbd#i have a whole plot now tho reeves hire me#for both films
0 notes
Text
Dieu est-il "un", "quatre" ou "trois"?
“Un, Quatre, Trois, Deux?” ©Philippe Quéau (Art Κέω) 2024 Les quatre lettres du Tétragramme, יְהוָה , que l’on peut transcrire YHVH, se lisent respectivement Yod, Hé, Vav, Hé. Dans la Cabale juive, ces lettres sont associées à quatre attributs divins, quatre sefirot. Yod correspond à Hokhmah (la Sagesse). Hé renvoie à Binah (l’Intelligence). Vav est associé à Tiferet (la Beauté) ou à Daat (la…

View On WordPress
0 notes
Text
Il y a une conférence qui prend place à l'UQàM pour apprendre les droits de manifestation et les droits en cas d'arrestations aux manifestants pour la Palestine. C'est organisé par montreal4palestine, pymmontreal, et les lawyers4palestine. La conférence se déroule entièrement en français et l'inscription est gratuite mais obligatoire. L'évenement prend place le Samedi 16 mars au Pavillon Hubert-Aquin, à 14h.


Voici le lien pour s'inscrire.
50 notes
·
View notes
Text
For Bombalurina week I want to celebrate two of my favorite Bombalurina's: Birgit Arquin (first cast Bombalurina in the Vienna revival) and Petra Ilse Dam (first cast Tantomile in Vienna and later first cast Bombalurina in the 2022-23 Korea tour) by looking at how they each approach the first minute of their solo in Macavity.
These aren't at exactly the same angle because we weren't in the same seats, but I think you get the idea of how precise and controlled Birgit's Bombalurina is whereas Petra's Bombalurina is much more lingering, fully enjoying each slow, sweeping motion.
Also, it's really interesting to see where they punctuate the choreography, because these are exactly the same 57 seconds of the song, but I had to change the length of each gif by a second to not catch them in very awkward mid-motion.








And because we all deserve a treat: One of the best things about Macavity in German is listening to Birgit Aquin purr. (Also pls enjoy Jo Lucy as Demeter.)
#sevencatcalls2024#petra ilse dam#birgit arquin#bombalurina#stage cats#cats vienna revival#i will never be over vienna
25 notes
·
View notes
Text
Was bedeutet Glück in der Ethik?
Glück kann man haben. Wenn man im Lotto gewinnt. Darum soll es jetzt nicht gehen. Und: Glücklich kann man sein. Wenn man ein Leben führt, mit dem man zutiefst einverstanden ist. Ohne im Lotto gewonnen zu haben. Dieses Glück meine ich. Im Englischen gibt es für glücklich zwei Begriffe: lucky und happy. Der Lottogewinner ist lucky, der zufriedene Mensch im Einklang mit sich selbst ist happy. Im Spanischen gibt es analog suerte (tengo suerte – ich habe Glück) und feliz (estoy feliz – ich bin glücklich). Der Lateiner unterscheidet zwischen fortuna und felicitas, die romanischen Sprachen übernehmen dies (etwa im Französischen fortune und felicité). Im Deutschen gibt es Glück und (etwas veraltet) Glückseligkeit. Diese ist hier gemeint, auch wenn kurz und bündig von „Glück“ die Rede ist, ohne Seligkeit.
Glück als Konzept der Moralphilosophie aufzufassen, liegt einerseits nah und andererseits fern.
Nah liegt es, weil wir in der Ethik über Prinzipien menschlichen Verhaltens sprechen und diese ohne Berücksichtigung anthropologischer Grundlagen nicht sinnvoll formuliert werden können. Schließlich kann man moralisch nur gebieten, was faktisch möglich ist.
Es wäre schlicht absurd, wenn man sagte: „Du bist ein böser Mensch, wenn Du nicht mindestens einmal monatlich zehn Meter weit springst!“ Was man tun soll, muss man tun können. Und – in gewisser Weise – auch tun wollen. Die Frage, was man Menschen – eingedenk ihrer Natur – überhaupt an Moral zumuten kann, gerät damit in den Fokus.
Fern liegt die Beachtung des Glücks in der Ethik aber aus einem ebenso überzeugenden Grund: Moralisch ist u.U. auch das geboten, was nicht unbedingt und schon gar nicht unmittelbar glücklich macht.
Für Moralität gibt es andere Gründe als den Willen: Vernunft, Notwendigkeit, Offenbarung. Nicht immer ergibt sich aus moralischem Handeln ein Glücksgefühl. Kaum jemand will Steuern zahlen, sich mit Obdachlosen unterhalten oder einem störrisch-aggressiven Demenzkranken stundenlang Gesellschaft leisten. Und dennoch sehen wir ein: Es ist gut, genau das zu tun.
Wenn man nun das Glücksstreben als anthropologische Konstante und das Glück als Zielgröße des persönlichen Lebensvollzugs ansieht (und das muss man wohl), erfährt der Begriff seine ethisch relevante Spannung darin, dass ein solcher individualistischer Entfaltungszwang allgemeinen moralischen Imperativen zuwider läuft. So entstehen die klassischen Antagonismen der Moraltheorie: „gutes Leben“ vs. „gerechtes Leben“, aristotelische eudaimonia vs. kantische Pflicht.
Immanuel Kant entwickelt im Umfeld des preußischen Pietismus sein Konzept einer deontologischen Ethik, die bei ihm autonom begründet wird (kategorischer Imperativ) und nicht als tradiertes heteronomes Gebot ihre Wirkung entfaltet (Dekalog). Er trägt damit seiner Abneigung gegenüber neuen eudämonistischen Strömungen Rechnung, die mit dem frühen Utilitarismus Benthams aus England auf den Kontinent hineinzubrechen drohten: Pflicht und Gebot statt happiness und pleasure.
Das Problem ist jedoch: Nicht nur, dass das Gute und das Glück damit auseinander fallen, auch werden die Liebe und andere Tugenden zur Pflicht gemacht, nachdem sie ihrem christlichen Kontext entzogen wurden, in dem sie zwar ebenfalls normativ wirken (Jesu lex nova ist ja auch ein Gebot und nicht bloß eine unverbindliche Empfehlung zur Lebensführung), im Grunde aber Folge der Religiosität sind, insoweit der Mensch sich Gott zuwendet und dann Gottes Liebe, die Hoffnung, die der Mensch in der Gottesbeziehung erfährt, das Gute, das ihm von Gott geschenkt wird etc. weiterträgt.
Bei Kant werden sie nicht mehr um ihrer Selbst willen und wegen ihres Offenbarungsgehalts (und damit ihres glücksstiftenden Moments), sondern als Konsequenz der Gebotstreue verfolgt. Es gilt nicht mehr: Werde glücklich durch ein tugendhaftes (=gutes) Leben, sondern: Die Gebote sind gut, sie zu befolgen ist deine Pflicht. Das Glück spielt keine Rolle mehr, es ist aus der Moral ausgeklammert. Ein gefährliches Unterfangen, denn wir können – wie vorausgesetzt wurde – ohne das Streben nach Glück nicht leben.
Wir müssen dieses als anthropologische Konstante berücksichtigen. Andererseits können wir auch ohne verpflichtende Moral nicht leben – ein echtes Dilemma. Bei Kant findet sich in der Befolgung des Sittengesetzes noch eine Spur des Glücks. Moralisches Handeln geschieht zwar prinzipiell aus Pflicht, doch verursacht es eine tiefe innere Gefühlsregung, eine Bewegtheit, die Kant Achtung nennt. Diese Achtung vor dem Sittengesetz, die jeder Mensch empfindet, baut eine Brücke zur teleologischen Ethik des Glücksstrebens.
Diese Brücke wird jedoch bereits viel früher gebaut, stabiler als bei Kant, wo sie eher brüchig und schwankend wirkt, über den tiefen Schluchten der motivationalen Unterbestimmtheit des kategorischen Imperativ. Die natura humana, wie sie bei Thomas von Aquin beschrieben wird, ebnet einen breiten Weg für das Verständnis von Ethik „von innen heraus“ und ergänzt damit den äußerlichen Aspekt der gebotsorientierten Moralphilosophie und -theologie.
Mehr noch: Sie wird zum Lebensgesetz, das allen Tugenden sowie allen Gesetzen und Geboten vorausgeht. Der Widerspruch von Tugend und Pflicht in den Grundkonzepten Strebens- und Sollensethik wird aufgebrochen, wenn mit Verweis auf dieses Lebensgesetz gezeigt wird, dass die Gebote Gottes der menschlichen Natur, d. h. den Bestrebungen unseres Seelenvermögens entsprechen, und dass der Mensch qua natura auf das Gute und die Wahrheit ausgerichtet ist, was das eigene Glück und Wohlbefinden einschließt.
Das Streben nach Glück und das Vollziehen des Guten stehen also – wie Thomas behauptet – nicht im Widerspruch zueinander, sondern sie bedingen sich wechselweise. Drei Dinge sind dabei für Thomas entscheidend:
1. Die Glückseligkeit als das letzte Ziel (das übernimmt er von Aristoteles).
2. Das Gute als Ausdruck des Glücks (das ist ebenfalls Gedanke der eudämonistischen Ethik).
3. Die Erfüllung des menschlichen Glücksstrebens im Glauben an Gott; die Glückseligkeit besteht in Gott.
Damit macht er den aristotelischen Ansatz für das Christentum passend (ein Vorgang, der sein Denken insgesamt kennzeichnet). Thomas schreibt: „Die Glückseligkeit ist nämlich das vollkommene Gut, das das Streben gänzlich erfüllt. Es wäre sonst nicht das letzte Ziel, wenn noch etwas Erstrebenswertes übrig bliebe.
Das Objekt des Willens, das heißt des menschlichen Strebens, ist das allgemeine Gute, so wie das Objekt des Intellekts das allgemeine Wahre ist. Daher ist klar, dass nichts anderes als das allgemeine Gute den Willen des Menschen zur Ruhe bringen kann. Dieses findet sich nicht in etwas Geschaffenem, sondern allein in Gott, denn jedes Geschöpf hat Gutsein nur durch Teilhabe. Folglich beseht die Glückseligkeit des Menschen allein in Gott“ (Summa theologica, I-II q. 2 a. 8).
Thomas von Aquin bringt Freiheit – verstanden als „Freiheit zum Guten“ – und Glückseligkeit zusammen, indem er die aristotelische Verbindung von Glück und Moral anthropologisch begründet: Das Streben nach dem Glück und dem Guten sind verschiedene Ausdrücke der einen menschlichen Natur.
Das natürliche Sittengesetz ist somit ein inneres, es ist dem Menschen in Herz und Verstand geschrieben, auch wenn es sich in äußerer Gebotsform ausdrücken lässt, wie etwa in der Goldenen Regel. Die Natur des Menschen weckt die Tugenden und liefert damit die Bedingung der Einsichtsmöglichkeit in die Gültigkeit der moralischen Regeln, die nicht vermittelt, gelernt und befolgt werden könnten, wenn nicht im Menschen die entscheidende Triebkraft ihrer Anerkennung läge. Die anthropologische Betrachtung und die Bewusstmachung, was der Mensch ist, geht damit der Ethik voraus.
Thomas identifiziert als Grundlagen des natürlichen Sittengesetz zentrale Neigungen der natura humana, die Neigungen zum Guten, zum Lebenserhalt, zur Sexualität, zur Wahrheit und zum Leben in Gemeinschaft. Hier zeigt sich, was das Glück des Menschen inhaltlich ausfüllt. Grundsätzlich kann damit für die christliche Ethik eine Rückbesinnung auf die aristotelisch-thomistische Tradition des Strebens nach Glück und dem Guten und eine Abkehr von pietistischer Gebotstreue angeregt werden.
Dies bedeutet aber keine Naturalisierung der Ethik oder Aufhebung der Moraltheorie durch den Fehlschluss vom Sein auf das Sollen, sondern die Notwendigkeit einer Klärung des Menschenbildes vor einem Diskurs über Werte und Sittlichkeit, ein Bewusstwerden, dass die Verinnerlichung des äußeren Gesetzes nur möglich ist, wenn das Gesetz wiederum Ausdruck der inneren Anlagen ist, d. h. letztlich die Erkenntnis, dass die Beziehung von Pflicht und Glücksstreben von letzterem ausgehen muss und auch ausgehen kann, da das Verlangen nach dem Guten und der Wahrheit jedem Menschen zu eigen ist, so wie das Streben nach Glück.
Damit fällt das Streben nach dem Glück, dem Guten und der Wahrheit in einem harmonischen Dreiklang zusammen, Gesetzestreue geschieht folglich aus innerem Antrieb, weil man das in der Norm geforderte Handeln schon aus eigener Einsicht für erstrebenswert hält. Das Sollen erweist sich nicht als Gegensatz, sondern als stimmiger Ausdruck des Wollens, zumindest soweit der Wille nicht auf Triebe, spontane Wünsche und Neigungen beschränkt bleibt, sondern diese Gefühle reflektiert und zu weitsichtigen, gereiften Entscheidungen fähig ist. Harry Frankfurt prägte zur Differenzierung der beiden Willensarten den Begriff der „Volation erster und zweiter Ordnung“, der den Wunsch nach unmittelbarer Triebbefriedigung von der kritisch-reflexiven Auseinandersetzung mit den Folgen der Wunschrealisation unterscheidet. Wer etwa eine Diät macht, kann trotz des großen Wunsches, das Körpergewicht zu reduzieren, den spontanen Wunsch haben, ein Stück Sahnetorte zu essen.
Dieses wäre eine Volation erster Ordnung, jenes eine Volation zweiter Ordnung. Insoweit erzeugt das pflichtbewusste Regelfolgen die tiefe Freude, die das Glück des Menschen ausmacht und damit seinem natürlichen Glückstreben gerecht wird. Erst die Befolgung des Gesetzes (Sollen) löst damit die Hoffnung auf das eigene Glück (Streben) ein. Glück wird somit beschreibbar als „Übereinstimmung von indikativischer und imperativer Bestimmtheit des Selbst“, wie es Johannes Drescher ausdrückt.
Interessanterweise wird dieses Menschenbild in Thomas’ natura humana heute in diesem Sinne von Befunden der Psychologie und Neurobiologie gestützt. Während das Konzept der kognitiven Dissonanz des Psychologen Leon Festinger ein Gefühl der Freudlosigkeit als Folge moralischen Fehlverhaltens beschreibt, was darauf verweist, dass wir von Natur aus im Einklang mit unseren Wertüberzeugungen zu handeln prädestiniert sind und jede Abweichung zunächst uns selbst stört, bemerkte der Soziobiologe Eckart Voland in einem Streitgespräch mit dem Theologen Eberhard Schockendorff: „Auch ohne die Bergpredigt oder Kant gelesen zu haben, können Menschen unter Einsatz enormer persönlicher Kosten anderen das Leben retten. Es gibt Impulse in uns, die uns zu einem Verhalten zwingen“.
Die Rehabilitierung des Glücks in der Moraltheorie gehört zu den wichtigsten, aber auch zu den schwierigsten Aufgaben der philosophischen Ethik. Wichtig, weil es ohne Glück nicht geht, schwierig, weil es leicht zu Missverständnissen kommt, wenn im Züge der allgemeinen Ökonomisierung des Lebens nicht hinreichend genau zwischen lucky und happy, zwischen fortuna und felicitas unterschieden wird.
Dann droht das persönliche Glücksstreben allgemeine Gebote der Sittlichkeit zu unterlaufen. Der Weg zum Glück in der Ethik führt also über Festinger und Frankfurt zu Thomas von Aquin, zum Eintrag des Glücks in die natürliche Moralität des Menschen. Sein Ansatz lässt sich durchaus säkularisieren: Wer die Glückseligkeit nicht in Gott zu erkennen vermag, die oder der muss eben etwas anderes als das höchste Gut anstreben, um glücklich zu werden. Voraussetzung: Es muss sich wirklich um ein „Gut“ handeln. Sonst klappt das nicht, mit dem Glück in der Ethik.
#glück#ethik#dr. bordat#moral#kant#thomas von aquin#harry frankfurt#wille#handlungsfreiheit#moderne gesellschaft#aktuell
1 note
·
View note
Text


aquinboy! | chainboy!
aquinboy; a term for being an aquatic-in-nature (AQUIN) boy!
chainboy; a term for being a chaos-in-nature (CHAIN) boy!

for; cam!
etymology; aquin/chain, boy
tagging; @radiomogai
17 notes
·
View notes
Text
guys ask me about Z or the Aquin species in general I wanna worldbuild

6 notes
·
View notes
