#Ansteckung
Explore tagged Tumblr posts
Text

Coole,lustige Motive für Schutzmasken
Die Gefahr ist noch nicht vorbei!
Qualität zu erschwinglichen Preisen
Wole-Design.redbubble.com
0 notes
Text
Kreuzfahrtfieber oder Klo-Alarm? Warum 2025 das Norovirus auf hoher See explodiert
Die Koffer sind gepackt, die Sonne lacht, das Meer glitzert verheißungsvoll – doch halt! Was, wenn unter der schillernden Oberfläche deines Luxusdampfers ein unsichtbarer Feind lauert, der nur darauf wartet, deine Traumreise in ein wahres Magen-Darm-Inferno zu verwandeln? Seit den ersten Tagen des Jahres 2025 herrscht auf den glamourösesten Kreuzfahrtschiffen der Welt ein mysteriöses und…
#Kreuzfahrt Gesundheit 2025#Kreuzfahrt Norovirus Risiko#Kreuzfahrt Sicherheit#Kreuzfahrt Viren 2025#Norovirus Ansteckung#Norovirus Ausbrüche Kreuzfahrt#Norovirus Behandlung#Norovirus Hygiene Tipps#Norovirus Infektion#Norovirus Kreuzfahrtschiffe 2025#Norovirus Pandemie#Norovirus Prävention#Norovirus Symptome#Norovirus Urlaub#Norovirus Virus Ausbruch
0 notes
Text
Muse Challenge: Mittelalter
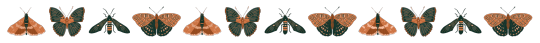
Welche Rolle hätte dein Charakter in der Gesellschaft im Mittelalter eingenommen?
Pestdoktor (Für diese Challenge nehmen wir einfach mal an, dass Frauen im Mittelalter für mehr als nur zum Kinder gebären existiert haben.)

Rolle:
Als Pestdoktor gibt sie sich mit den Menschen ab, die niemand mehr um sich wissen will, da sie eine Krankheit tragen, die jeder fürchtet. Typischerweise behandelt sie sowohl reiche, als auch arme Bürger mit Mittelchen und Tinkturen, die mehr Placebo sind, als dass sie wirklich helfen, da man sich damals noch nicht sicher ist, wie die Krankheit übertragen wird und behandelt werden kann. Nicht nur mit den Kranken kommt sie in Berührung, denn auch damals schon führt Belle ebenfalls Autopsien und versucht mit ihrer Arbeit die Krankheit besser zu verstehen und ihre Ausbreitung einzudämmen.
Aussehen:
Typischerweise trägt sie Handschuhe sowie einen langen, gewachsten, dunklen Stoffmantel, der sie vollends einhüllt und trägt auf ihrem Gesicht eine Maske, die Mund und Nase mit einem langen Schnabel verdeckt und vor einer Ansteckung schützen soll. 2 Öffnungen aus Glas an den Augen sollen den Blick nach außen ermöglichen.
Wohnort:
Belle hat keinen festen Wohnort. In Ausübung ihrer Arbeit zieht sie von Stadt zu Stadt und versucht, irgendwo außerhalb unterzukommen, um von so wenigen Menschen umgeben zu sein wie möglich. Sie legt dabei keinen Wert auf großen Komfort, ihr reicht ein Dach über ihrem Kopf, sodass sie vor dem Wetter geschützt ist und eine ungestörte Prise Schlaf erhaschen kann.

Tagged: @mirrorbreak
Tagging: @wangka-yee @nonchalantcharisma @inthe-shadoows @sturmherzpeitsche
8 notes
·
View notes
Text
Individuelles Kariesrisiko
Das individuelle Kariesrisiko ist von verschiedenen Faktoren abhängig: Infektion mit Karies verursachenden Bakterien Diese Ansteckung erfolgt im Baby- oder Kleinkindalter durch die nächsten Bezugspersonen. Je früher diese Infektion erfolgt, desto nachhaltiger besiedeln die Karies verursachenden Bakterien die Zähne. Sie lassen sich nie mehr völlig ausmerzen, sondern nur noch in ihrer Menge reduzieren. Häufige Aufnahme von Zucker und kurzkettigen Kohlenhydraten, die schon im Mund zu Zucker abgebaut werden. Unabhängig davon, ob Zucker in naturbelassener oder industriell hergestellter Form konsumiert wird, bauen die Karies verursachenden Bakterien diese Zucker zu Säuren ab, die eine Demineralisation der Zahnoberfläche bewirken. Je häufiger die Zuckeraufnahme erfolgt und je länger der Zucker im Mund verbleibt (wie bei Bonbons oder Dauerlutschern) oder je intensiver der Zucker auf den Zähnen klebt (wie bei Schokoriegeln oder Bananen) umso verheerender ist die Säurewirkung auf die Zahnoberfläche. Die Zusammensetzung der bakteriellen Plaque steht in direktem Zusammenhang mit den Zuckerkonsumgewohnheiten. Menge der Plaque Die Menge der bakteriellen Plaque steht in direkter Beziehung zur Kariesaktivität. Je schlechter und seltener die Zähne gereinigt werden, desto mehr bakterieller Zahnbelag bleibt auf den Zähnen liegen und die darin enthaltenen Bakterien produzieren aus dem Nahrungszucker umso mehr zahnauflösende Säure. Die Zahnbeläge können angefärbt werden, um dem Patienten zu zeigen, wo besser geputzt werden muss. Ungünstige Zahnstellungen behindern die Plaqueentfernung Die Zahnreinigung ist für den Patienten nicht in allen Bereichen seines Gebisses gleich gut möglich. Die Zahnzwischenräume oder die Vertiefungen in der Kaufläche sind besonders gefährdet, nicht ausreichend gereinigt zu werden. Zahnfehlstellungen, Zahnkippungen durch unversorgte Zahnlücken oder überstehende Ränder von Füllungen oder Kronen erhöhen das Kariesrisiko ebenfalls. Unzureichende Fluoridzufuhr Fluoride fördern die Remineralisation entkalkter Zahnbezirke. Fluoride stehen in unterschiedlicher Menge im Trinkwasser und einigen Nahrungsmitteln zur Verfügung. Besonders intensiv ist die Fluoridwirkung durch die Anwendung fluoridhalter Zahnpasten. Haben die Zähne zu wenig Fluoridkontakt, erhöht sich das Risiko, an Karies zu erkranken. Zu wenig Speichel Im Speichel sind alle Mineralien gelöst, die zur Remineralisation des Zahnes beitragen. Ist die Speichelmenge reduziert, tritt unangenehme Mundtrockenheit auf und dadurch erhöht sich auch das Risiko einer Karieserkrankung. Die Speichelmenge kann reduziert sein durch Medikamenteneinnahme wie Chemotherapeutika oder Blutdrucksenker, Strahlentherapie oder durch unzureichende Flüssigkeitszufuhr in der heißen Jahreszeit.
4 notes
·
View notes
Text
Depressiver Partner zieht mich runter – Ursachen & Tipps
Wenn ein Partner gegen Depressionen kämpft, ist auch der andere, gesunde Partner in einen Kampf verstrickt, der ihn bis an die eigenen Grenzen treibt. Die Krankheit mitsamt ihren Folgen besitzt eine mächtige Sogwirkung, die auf das unmittelbare Umfeld übergreift.
Was Depressionen in einer Partnerschaft bedeuten
Es beginnt meistens ganz subtil.
Irgendwie verändert sich die Stimmungslage und eine emotionale Distanz wächst heran, die beidseitig spürbar ist. Ganz selbstverständlich nehmen gesunde Partner eine unterstützende Rolle ein, doch geraten dabei allzu oft ans Limit ihrer emotionalen und körperlichen Kräfte.
Die Forschung hat bestätigt, dass das Zusammenleben mit einem depressiven Menschen einen erheblichen Einfluss auf das eigene Wohlbefinden hat. Und das so massiv, dass schätzungsweise 40 % der Angehörigen krank werden. Überhaupt ist das Risiko für Familienmitglieder und Partner von Depressiven, psychisch krank zu werden, deutlich erhöht. (Vgl. Depressionen: Angehörige – Das unsichtbare Leid der Familie)
Doch es ist nicht nur das psychische Wohlbefinden, das auf dem Spiel steht. Oft verändert sich die gesamte Struktur einer Beziehung. Angefangen bei der Aufteilung von Haushaltsaufgaben über die finanzielle Situation bis zu gemeinsamen sozialen Erlebnissen – die Depression drängt sich in jeden Winkel der Partnerschaft.
Die finanzielle Last ist ebenfalls nicht zu unterschätzen. Und dann sind da noch die dauerhaften, tiefgreifenden Ängste: vor der Zukunft, vor finanzieller Unsicherheit und nicht zuletzt davor, ob die Beziehung den Belastungen standhält.
Das alles ist alarmierend und sollte eigentlich dazu führen, dass beide Partner bzw. die enge Familie in den Fokus von Präventions- und Unterstützungsangebote rücken. Tut es aber nicht …
Ursachen: So wirken sich Depressionen auf Beziehungen aus
Emotionale Ansteckung
Menschen haben die Fähigkeit, Emotionen unbewusst zu übertragen und zu teilen – ein Prozess, der als emotionale Ansteckung bekannt und gut erforscht ist. In einer Beziehung, in der ein Partner an einer Depression leidet, sind die stimmlichen, körperlichen und ausdrucksbezogenen Signale extrem negativ geprägt.
Der nicht-depressive Partner nimmt diese Signale wahr und reagiert unbewusst darauf, d.h. die depressive Stimmungslage beeinflusst auch ihn. Wenn der depressive Partner ständig abweisend, aggressiv oder uninteressiert reagiert, löst das natürlich Irritation / Angst, Verärgerung, Frust und Traurigkeit bei gesunden Bezugspersonen aus. Vgl. Depression bei Männern: Wut auf Partner
Veränderte Alltagsdynamik
Ein depressiver Partner erlebt häufig Phasen von Antriebslosigkeit und Interessenverlust (Anhedonie). Die Last an Pflichten und Verantwortungen des Alltags – wie Haushalt, Kindererziehung oder organisatorische Aufgaben – lasten vermehrt auf den Schultern der gesunden Partner.
Wer so viel Stress hat, neigt auch eher zu negativen Gefühlen. Studien belegen, dass ein hohes Stresslevel die Empathie gegenüber anderen Personen schmälert. So können irgendwann selbst die stärksten Menschen nicht mehr einfühlsam auf den kranken Partner eingehen und neigen zur Aggression.
Soziale Isolation
Die quälenden Depressionssymptome mitsamt Schuldgefühlen führen oft zu einem sozialen Rückzug der Betroffenen – gleichzeitig distanzieren sich viele Freunde und Angehörige von selbst, meist aus Unsicherheit und Hilflosigkeit. Die gesunden Partner und Familienmitglieder geraten dadurch ebenfalls in eine soziale Isolation.
Einerseits können sie oft aufgrund ihrer Unterstützungsfunktion weniger Zeit für soziale Beziehungen aufbringen. Andererseits berichten viele Partner, dass ihre eigenen Freunde und Familien automatisch auf Abstand gehen. Auch das ist der krisenhaften Situation geschuldet und allzu menschlich. Um sich vor emotionaler Ansteckung zu schützen, meiden die meisten Menschen den Kontakt.
Wegfall essenzieller Ressourcen
Eine gesunde, funktionierende Beziehung balanciert idealerweise zwischen Geben und Nehmen. Doch diese Gegenseitigkeit ist durch Depressionen aufgehoben. Gesunden Partnern und Partnerinnen fehlt es an emotionaler Unterstützung, Liebe, Fürsorge, Bestätigung u. v. m. Auf Dauer führt dieser Zustand zu emotionaler Erschöpfung, weil sie selbst viel Energie aufwenden, um den kranken Partner zu unterstützen (vgl. auch Erschöpfungsdepression).
Kommunikationsbarrieren
Depressive Menschen haben oft Schwierigkeiten, ihre Erfahrungen zu artikulieren oder ihre Gefühle auszudrücken. Offene Gespräche gibt es kaum noch. Das führt logischerweise zu Missverständnissen und Frustration. Die emotionale Belastung entlädt sich in Konflikten und weiteren Problemen zwischen den Partnern, was die Negativspirale nur weiter verstärkt.
Zukunftsängste und Sorgen
Die Ungewissheit, die eine Depression mit sich bringt, schürt Ängste und Sorgen um die Zukunft und die Beziehung selbst. Das betrifft beide.
Wenn beide Partner unter solch extremer Anstrengung stehen, – und das dauerhaft – ist auch ihr Stresslevel ständig auf Hochtouren, was wiederum negative Gedanken und Gefühle auslöst.
Partner ist depressiv und ich kann nicht mehr … was hilft?
Eine Depression zu erleben, ist eine enorme Herausforderung – nicht nur für die betroffene Person, sondern auch für ihre Partner. Es gibt keine Patentrezepte, nur mögliche Strategien, die helfen können, die Belastung zu teilen, ohne darunter zusammenzubrechen.
Erkenntnis & Akzeptanz der Situation
Erkenne die Krankheit an: Mach dir klar, dass die Depressionen ernsthafte Erkrankungen sind und kein Zeichen von Schwäche, einfacher Unsicherheit, Faulheit etc.
Akzeptiere deine Gefühle: Es ist normal und verständlich, wenn du dich überfordert oder wütend fühlst. Wirklich jedem in deiner Situation geht es so. Das ist absolut menschlich. Also erlaube dir, diese Emotionen, ohne Schuldgefühle zu haben.
Unterstützung finden
Erkunde Ressourcen: Sei proaktiv und suche nach Unterstützung, z. B. im Freundeskreis, in deiner Familie etc.
Finde Angebote für dich: Mach von Angeboten für Angehörige Gebrauch, z. B. Angehörigentherapie, spezielle Gruppen oder Beratung.
Abgrenzung und Selbstfürsorge
Setze gesunde Grenzen: Priorität hat, dass du nicht selbst ausbrennst. Darum ist es extrem wichtig für dich, herauszufinden, wie und wo du Grenzen setzt.
Achte auf Selbstfürsorge: Sorge für ausreichend Schlaf, ernähre dich gesund, bewege dich regelmäßig und nimm dir Zeit für dich allein und deine Hobbys.
Umgang im Alltag
Nimm kleine Zeichen wahr: Achte auf kleine positive Veränderungen und bestärke deinen Partner.
Setze realistische Ziele: Hab Geduld und setze kleine, erreichbare Ziele für die gemeinsame Zukunft.
Notfallplan: Erstelle gemeinsam mit deinem Partner einen Notfallplan, falls sich eure Situation verschlechtern sollte.
Fazit: Depressiver Partner zieht mich runter
Es ist nicht die Schuld des depressiven Partners, dass diese Dynamik innerhalb der Beziehung entsteht. Wer unter Depressionen leidet, kann nicht anders und braucht Hilfe. Gleichzeitig dürfen nicht die außerordentlichen Belastungen der Bezugspersonen aus dem Blick geraten. Für beide Partner ist es wesentlich, dass sie Hilfe und Unterstützung erhalten, um damit umzugehen und Wege zu finden, wie sie ihre psychische Gesundheit dauerhaft schützen bzw. stärken können.
#depressiver partner#depression partner#depressive partner#partnerschaft#beziehung depression#gefühlsansteckung#soziale emotionen#kommunikation#atmosphären#angehörige#tipps#familie#psychosoziale faktoren
3 notes
·
View notes
Text

Letter
In dem legendären Buch Phantom Avantgarde schreibt Roberto Ohrt von einer Ansteckung. In Nachtlokalen, den Orten, für die nach Warburg jr. Nationalbibliotheken kein Ersatz sind, hatten Jean-Isidore Isou und Gabriel Pomerand eine lettristische Bewegung angestossen, einen rauschhaften Aufruhr in Kellern. Dort habe sich die Sprache an ihren Tönen angesteckt. Die Menschen, so Ohrt, hätten ihre Heimlichkeiten ausgeplaudert. Mal wieder wurde Sprechen ein eigenes Sekret. Damit seien "die überraschend präzisen Situationen einer peinlichen Verwechselung entstanden".
Auf solche peinlichen Verwechslungen, ihre überraschend präzisen Situationen und damit noch auf dasjenige, was unterhalb der Schwelle des Rechts liegt und dennoch, widerständig und insistierend, Recht reproduziert, werden wir im Mai öfters zu sprechen kommen, aber erst im Mai.
2 notes
·
View notes
Text
Tipperer …

… du bist längst nicht allein!
Schrammel merkte kürzlich an, dass es mit der Treffsicherheit seiner steifen Finger auf der Smartphone-Tastatur nicht zum Besten steht. So weit, so nichts Besonderes. Was den Kollegen aber weit mehr nervt, ist die dabei scheinbar stetig nach unten zeigende Lernkurve – und das im 14. Jahr seines Gebrauchs der digitalen Wunderkästchen! Faulheit durch Auto-Korrektur? Alters- und/ oder stressbedingte Fahrigkeit? Ansteckung durch den Laisser-faire-Virus? Sparen des Korrekturlesens als Normalzustand? Erste Lacher pber Schrammel wichen der Erleichterung und Tespekt, dass es endlich msl jemand zugegeben hat. Denn er ist nicht allein. Weswegen die Dezernats-Besatzung das Problem kurzerhand zum offiziellen Alltagsphänomen erklärte – darauf erstmal einen Dujardin!
.
2 notes
·
View notes
Text
Ungeschützte Räume
Manova: »Die Jahre der Coronapolitik waren geprägt von verschiedenen, bewusst geschürten Ängsten in der Gesellschaft. Während die Einen eine Ansteckung mit COVID-19 befürchteten, gerieten Andere aufgrund finanzieller Schwierigkeiten in Bedrängnis. Auch die Übergriffigkeit des Staates in dieser Zeit blieb nicht folgenlos. Der geschützte Raum des Privaten, über den man selbst entscheiden, den man souverän gestalten kann, ist abhandengekommen. Die Belastung, jeden Moment damit rechnen zu müssen, dass eine neue Maßnahme gravierend in den eigenen Alltag einschneidet, macht ein Gefühl von Entspannung nahezu unmöglich. Die Autorin schildert unter anderem ihre eigenen seelischen Verwerfungen während der Pandemie und beschreibt, wie sie sich aus dieser Krise herausarbeitete. Ein Beitrag zum „Politik und Psyche“-Spezial. http://dlvr.it/TLB2f4 «
0 notes
Link
0 notes
Text
Michael Cunningham: Ein Tag im April

Der US-amerikanische Schriftsteller und Pulitzerpreisträger Michael Cunningham (Jahrgang 1952) hat einen neuen Roman geschrieben. Der Luchterhand Literaturverlag gab am 1. Mai 2025 die deutsche Ausgabe unter dem Titel „Ein Tag im April“ heraus. Die Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch übernahm Eva Bonné. Eine Generation der Unschlüssigen und Unzufriedenen Der Roman heißt im Original „Day“ und spielt am jeweils 5. April der Jahre 2019, 2020 und 2021. Am 5. April 2019 (morgens) leben Isabel Walker, Dan Byrne, Robbie Walker und die Kinder Nathan und Violet in einem Haus in Brooklyn, NYC. Isabel arbeitet für ein Hochglanzmagazin und ist dort für die Fotostrecken verantwortlich. Dan, Isabels Ehemann, betreut Haushalt und Kinder. Er träumt von einem Comeback als Rocksänger. Robbie, Isabels homosexueller Bruder, ist Lehrer und wohnt im Dachgeschoss. Robbie ist im Internet mit seinem Liebhaber Wolfe unterwegs. Mit geklauten und bearbeiteten Fotos generiert er Follower für Wolfes fiktives Leben. Isabel unterstützt ihn dabei kreativ. Nathan und Violet, zehn und fünf Jahre alt, teilen sich ein Zimmer. Violet ist träumerisch, versponnen, glaubt, dass sie eine übersinnliche Gabe besitzt. Nathan ist ein unsicherer Junge an der Schwelle zur Pubertät. Beide lieben ihren Onkel Robbie. In die Ehe von Isabel und Dan hat sich der Alltag geschlichen. Beide sind Anfang vierzig und passiv unzufrieden. Beide träumen von einem anderen Leben. Robbie soll aus der Dachkammer ausziehen, damit Nathan ein eigenes Zimmer bekommt. Dans Bruder Garth Byrne, ein erfolgloser bildender Künstler, hat einen Sohn mit Chess Mullins, einer Professorin für Literatur. Chess möchte ihren Sohn Odin allein erziehen und Garth weiß nicht, wie er die Vaterrolle ausüben soll. Dann kommt Corona, am 5. April 2020 (nachmittags) sind alle in ihren Wohnungen eingesperrt. Isabel und Dan leben weiter unglücklich nebeneinander her. Die Kinder entwickeln Ansteckungs- und Todesängste. Die sozialen Kontakte kommen zum Erliegen. Robbie befindet sich auf Island in einer Blockhütte, postet Storys auf Instagram über Wolfe und schreibt Briefe an die Walkers. Chess erlaubt Garth Odin am Fenster zu sehen. Am Abend des 5. April 2021 ist die Pandemie fast überwunden. Aber einer hat sie nicht überlebt. Die Familie muss sich einer neuen Wirklichkeit stellen. „Ein Tag im April“ von Michael Cunningham ist kein Pandemie-Roman, aber auch keine faszinierende Familiengeschichte der Gegenwart Michael Cunninghams „Ein Tag im April“ ist ein Porträt über die heute Mitte dreißig bis Mitte vierzig Jährigen. Aber was soll das für eine Generation sein, wenn man Cunninghams Beschreibungen liest? Alle stecken vermeintlich im falschen Leben fest. Alle möchten eigentlich etwas anderes. Am besten aber erfolgreich, berühmt und reich sein. Doch anstatt das eigene Leben in die Hand zu nehmen, flüchten sie in Träume, laufen ihren Wünschen hinterher und machen ihre Partner bzw. Partnerinnen dafür verantwortlich. Mit Kindern leben und Geld verdienen müssen, ist doch nicht so cool, wie gedacht: „Er hat seine Band aufgelöst und nie wieder einen Song geschrieben … Er hat sich bemüht, ein umgänglicher, genügsamer Mensch zu sein, der Säuglingsnahrung anrührt, erst für Nathan und dann für Violet; der die Kinder wickelt und die Wäsche macht; der die müde, ausgelaugte Isabel abends mit Essen empfängt …“ (S. 131) Das Bild, das Cunningham von seinen Protagonisten zeichnet, ist kein hoffnungsvolles und bestärkt vielleicht auch das ein oder andere Vorurteil gegenüber dieser Generation von Frauen und Männern. Beim Lesen des Romans entstand bei mir eher Mitleid und Distanz mit diesen lebens- und realitätsfernen, zutiefst unentschlossenen Figuren. Und auch der Paukenschlag im dritten und letzten Kapitel des Buches verfehlt seine Wirkung und verpufft, weil die Figuren weiter selbstmitleidig um sich selbst kreisen. Cunninghams Sprache und Stil dagegen sind überzeugend. Die Romanidee aber trägt nicht. „Ein Tag im April“ von Michael Cunningham ist kein Pandemie-Roman, aber auch keine faszinierende Familiengeschichte der Gegenwart. Schade! Michael Cunningham: Ein Tag im April. Aus dem amerikanischen Englisch von Eva Bonné. Luchterhand Literaturverlag, 1. Mai 2025. 352 Seiten, Hardcover, 24,- Euro. Diese Rezension wurde verfasst von Sabine Sürder. Read the full article
0 notes
Text

Dr. Michael Barczok ist Facharzt für Lungenkrankheiten. Wir haben nachgefragt, wie er die aktuelle Situation bewertet, worauf wir uns noch einstellen müssen und was beim Basteln von Mundschützen wichtig ist: Wie bewerten Sie als Pneumologe die aktuelle Situation? Besteht aus Ihrer Sicht Hoffnung, dass die Lage sich bald bessert? Wenn man unkontrolliert zu schnell aufmacht, droht eine schwierige Rebound-Welle. Man wird sehen müssen, wie die Öffnungsmaßnahmen in China oder nun auch in Österreich letztendlich funktionieren. Sicher ist aus meiner Sicht, dass vor einer Massenimpfung, die wohl frühestens Mitte nächsten Jahres erfolgen wird, kein vollständiger Schutz möglich sein wird und Einschränkungen für die Bevölkerung weiterbestehen werden. Spannend finde ich, dass in Österreich als erstes kleine Geschäfte, wohl auch Büchereien etc. öffnen dürfen, während Kinder und Schüler noch unter Hausarrest stehen. Wie hat sich Ihr eigenes Leben verändert durch den Virus und die Schutzmaßnahmen? Wie sieht Ihr Alltag derzeit aus? Obwohl ich Risiko-Person bin (66 Jahre, diverse chronische Erkrankungen) mache ich weiterhin Dienst in unserer Praxis allerdings mit FF P3 Maske. Ich kümmere mich in erster Linie um unsere Patienten mit schweren Atemwegserkrankungen und biete eine Onlinesprechstunde an, während die jüngeren Kollegen sich verstärkt um Corona-Verdachtsfälle oder Corona-Patienten kümmern, die wir dann auch in häuslichem Arrest per Onlinesprechstunde täglich visitieren. Maßnahmen, die noch vor wenigen Wochen völlig undenkbar waren! Das bedeutet einen irren Schub für innovative Entwicklungen in der Medizin. Wie bewerten Sie die Schutzmaßnahmen und das Krisenmanagement in Deutschland? Nachdem alle völlig unvorbereitet waren, ist die Lage anhaltend schwierig, das kann man aber eigentlich niemandem vorwerfen. Wenn überhaupt, hätte der Staat zentral eine Bevorratung für Millionen Menschen und Monate hinweg machen können und müssen. Wir werden für die Zukunft daraus lernen, da bin ich mir sicher. Ich finde, dass wir alles in allem sowohl in der ambulanten Medizin, in der stationären Medizin als auch im staatlichen Krisenmanagement ganz überwiegend einen guten Job machen. Was jetzt bald kommen muss, ist allerdings der wirklich zuverlässige und problemlose Schutz aller Beschäftigten im Medizin- und Pflegebereich und die Ausstattung der übrigen Bevölkerung mit einfachen Masken, die dann nicht vor Ansteckung schützen müssen, sondern verhindern sollen, dass unerkannte Virus-Träger erneute Hotspots aufbauen können. Was können Sie uns auf den Weg geben, was sind wirklich nützliche Tricks, über das Händewaschen und Niesen in die Armbeuge hinaus? Gehen Sie Joggen, Radfahren oder Spazieren. Nutzen Sie das schöne Wetter, bewegen Sie sich an der frischen Luft – solange Sie allein sind, ist das ja in allen Bundesländern noch erlaubt. Essen Sie gesund – Vitamine sind gut für das Immunsystem. Hören Sie auf zu rauchen! Und lassen Sie sich gegen Grippe und Pneumokokken impfen, wenn es noch möglich ist, insbesondere, falls Sie Teil einer Risikogruppe sind. Mancherorts herrscht mittlerweile eine Mundschutzpflicht und viele Menschen fangen jetzt an zu basteln – schließlich sind Schutzmasken rar. Was sollten wir beachten, wenn wir uns selbst einen Mundschutz nähen? Nicht viel, der Schutz ist ohnehin seuchenhygienisch unwirksam, wenn es darum geht, sich vor Viren zu schützen. Es geht eigentlich nur darum, dass man bei Husten oder Niesen nicht einfach wild in den Raum hinein sprüht, sondern die Sprühtröpfchen von irgendetwas zurückgehalten werden, sei es eine einfache chirurgische Maske oder auch ein nettes Tuch. Der oberste Gesundheitsarzt des amerikanischen Zivilschutzes hat im Fernsehen gezeigt, wie man sich selbst aus einem Stück Stoff eine Maske mit einem Hefter und 2 Gummis basteln kann. Was vermuten Sie: Werden Schutzmasken auch nach Corona im Straßenbild erhalten bleiben? Wäre das sinnvoll? Nun, in Amerika oder Asien war das ja schon immer weit verbreitet, dort allerdings sinnlos, da es gegen Luftverschmutzung nicht hilft. Schon immer sinnvoll gewesen wäre es für die Millionen von Pollenallergikern in Deutschland, da auch einfache Mundschutze super gegen Pollen helfen. Wenn es gelingt, Masken modisch schön aufzubereiten, wird man sich daran im Straßenbild gewöhnen dürfen. Wie verläuft Covid-19 eigentlich? Warum merken Viele so lange oder gar nicht, dass sie infiziert sind? Mein Buch „Luft nach oben“ erscheint dieser Tage als eBook mit einem ganzen Extra-Kapitel nur zu Corona: Darin ist ausführlich erklärt, dass Corona-Infektionen in mehreren Stufen auftreten können. Bei 80 % kommt es nur zu einem eher geringfügigen, manchmal nicht bemerkten Infekt der oberen Atemwege. Bei einem Teil kommt es aus Gründen, die wir letztendlich noch nicht vollständig verstehen, dazu, dass die Viren den Weg in die Tiefe finden. Eine Rolle scheint dabei zu spielen, wenn die Entsorgungsfunktion der Bronchien nicht richtig funktioniert (chronische Atemwegserkrankungen, insbesondere COPD, vor allem wenn man weiter raucht). Nur bei einem relativ kleinen Teil kommt es dann wirklich zu den gefürchteten Pneumonien, die auch tödlich enden können. Auch das verstehen wir noch nicht so ganz, insgesamt ist die Zahl der Todesfälle bezogen auf die Zahl der Infizierten (die aber schwer festzustellen ist, vermutlich 5-10 mal höher liegt als die aktuell mitgeteilten Zahlen) gar nicht so dramatisch und auch bei Grippeinfektionen möglich, wobei zu beachten ist, dass hier gegen ja geimpft werden kann und deshalb der Virus bei weitem nicht so viel Opfer findet wie jetzt der Corona-Virus. Welche Lehren sollten wir im Sinne unserer Gesundheit aus der aktuellen Zeit ziehen? Zunächst einmal etwas mehr Demut, ähnliche Pandemien hat es schon immer gegeben und wird es auch weiterhin geben. An der spanischen Grippe sind vor etwa 100 Jahren Millionen von Menschen gestorben. Auch Bakterien könnten ähnliche Probleme aufwerfen, wenn wir es nicht schaffen, das Problem der Resistenzen in den Griff zu kriegen. Und schließlich mehren sich völlig zu Recht die Stimmen, die sagen, dass weitere Entgleisungen des Weltklimas vergleichbare Versorgungskrisen hervorrufen könnten. Auch im medizinischen Bereich droht das, da immer mehr Erreger, die bisher nur in tropischen Ländern eine Rolle gespielt haben und gegen die unsere Bevölkerung keine Abwehrstoffe besitzt, plötzlich auch in unseren Breiten auftauchen (zum Beispiel das Nil-Fieber). Wir sollten also alle Steuergrößen im Auge behalten und uns im Übrigen für großflächige Katastrophen in Zukunft besser rüsten. Auf der anderen Seite ist es unglaublich, wie schnell und elastisch unser System plötzlich reagieren konnte, die Bürokratie, sei es im Finanzbereich, sei es aber auch im medizinischen Bereich, wurde plötzlich komplett überrannt, Dinge, die nie möglich waren, sind plötzlich möglich. Auch daraus werden wir sicher für die Zukunft lernen können und zwar positiv. „Luft nach oben“ von Dr. Michael Barczok Wussten Sie, dass wir regelmäßig einen Heißluftballon voller Luft ein- und ausatmen? Ob wir Marathon laufen oder schlafen, unsere Lunge versorgt uns permanent mit der optimalen Menge an Sauerstoff. Wir spüren unser Atemorgan bloß, wenn etwas nicht stimmt. Was passiert, wenn wir husten, kurzatmig sind oder schnarchen? Was steckt hinter Allergie, Asthma und COPD? Was können wir gegen all die Atembeschwerden tun? Wie fit ist eigentlich die eigene Lunge? Darüber hinaus stellt sich Barczok den Fragen der aktuellen Debatte: Wie sinnvoll sind Grenzwerte für Dieselabgase und Fahrverbote? Wie gefährlich ist die Feinstaubbelastung in unserer Atemluft? Alle Antworten und die besten Tipps für eine lebenslang gesunde Lunge finden sich in diesem Buch. Read the full article
0 notes
Text
WHO-Insider warnt: WHO und Gates vor der Planung der „Katastrophalen Ansteckung“ bei Kindern (Video)
WHO-Insider warnt: WHO und Gates vor der Planung der „Katastrophalen Ansteckung“ bei Kindern (Video)
0 notes
Text

WENN DER HUND PLÖTZLICH HUSTET
– Lungenmilben als eine mögliche Ursache
Husten beim Hund? Dahinter kann mehr stecken als nur eine Reizung. Lungenmilben sind kleine Parasiten, die sich in der Lunge ansiedeln – vor allem bei Hunden, die draußen viel schnüffeln oder Gras fressen.
Symptome: Trockener oder hartnäckiger Husten, Hecheln, Atemgeräusche, Erschöpfung. Seltener: Fieber oder Gewichtsverlust.
Ansteckung: Über infizierte Schnecken – beim Lecken von Gras oder Pfützen.
Diagnose: Der Tierarzt untersucht z. B. den Kot (Baermann-Methode) – denn die Larven werden ausgeschieden. Bei Bedarf helfen auch Röntgen oder eine Spülung der Atemwege, um Klarheit zu schaffen.
Behandlung: Es gibt wirksame Medikamente – aber nur bei gezielter Anwendung nach Diagnose.
Wichtig:
Tipps von Bekannten oder Internetforen helfen nicht weiter. Nur eine klare Untersuchung beim Tierarzt bringt Sicherheit.
Quelle:
https://www.tiermedizinportal.de/krankheiten/hund/lungenwurmer-und-lungenmilben-beim-hund/214790
©️®️CWG, 02.04.2025
Eigens recherchierter Text mit ChatGPT formatiert – mit Copy- und Lizenzrechten und vollständiger Quellenangabe gern zum Teilen im Original genehmigt.
#hundeinfo #lungenmilben #hundegesundheit #hustenbeimhund #tierarztwissen #florianatopfblume #zwergpudelzwiegespraeche #haustiergesundheit
#zwergpudelzwiegespraeche#zwergpudelliebe#zwergpudelnordhessen#zwergpudelgermany#cwg64d#oculiauris#cwghighsensitive#zwergpudeldeutschland#zwergpudel#zwergpudeleuropa#hundegesundheit#lungenmilbe#haustiergesundheit#hustenbeimhund
1 note
·
View note
Text
Mitgefühlsmüdigkeit – Macht uns zu viel Empathie krank?
Mitgefühlsmüdigkeit betrifft vor allem Menschen, die in sozialen Berufen arbeiten oder Angehörige pflegen. Wer täglich mit dem Leid anderer Menschen zu tun hat, dem geht das irgendwann an die Substanz. Werden die Belastungen zu groß, verändert sich in der Folge das Verhalten gegenüber Patienten negativ.
Was ist Compassion Fatigue?
Ein einheitliches Konzept der Mitgefühlsmüdigkeit gibt es nicht. Im Grunde beschreibt die Compassion Fatigue einen Zustand der starken emotionalen und physischen Erschöpfung (Burn-out), der bei regelmäßiger Konfrontation mit traumatischen Erlebnissen anderer (traumatischer Stress) eintritt (1).
Einige Experten sehen die Mitgefühlserschöpfung als Berufsrisiko (Nebenwirkung) in helfenden Berufen an (Notfallhilfe, Pflege, Therapie, Sozialarbeit, Polizei, Feuerwehr).
D. h. bei einer Compassion Fatigue haben Betroffene Probleme, das notwendige Maß an Mitgefühl und Empathie für Patienten aufzubringen. Stattdessen machen sich Frust, Abwertung, Gereiztheit und Ungeduld breit.
Bei Rohwetter (3) findet sich eine pointierte, introspektive Beschreibung des Phänomens:
„Mitgefühlsmüdigkeit ist das Erlöschen des Antriebs zu helfen, zu unterstützen oder gar zu lindern. Wir können das Leiden unserer Klientel nicht mehr nachfühlen, sondern beginnen, es innerlich abzuwerten im Sinne von: »So schlimm ist es doch gar nicht, guck doch mal, wie gut du es hast« oder auch streng und hart: »Das ist Bequemlichkeit, sie müsste einfach nur …« Gefühle wie Ungeduld, Langeweile, Stress und Überforderung werden spürbar.“
Vgl. auch Depression Angehörige – Das unsichtbare Leid der Familie
Symptome der Mitgefühlserschöpfung
Überforderung und Hilflosigkeit, wenn andere von ihrem Leid erzählen
Wut, Traurigkeit und Ängstlichkeit gegenüber Patienten oder als allgemeine depressive Verstimmung
Spürbar weniger Empathie und Stresstoleranz
Intrusionen (Bilder, Erinnerungen, Gedanken)
Selbstvorwürfe, Selbstbeschuldigungen
Konzentrations- und Entscheidungsschwierigkeiten
Körperliche Stress-Symptome (Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Schlafprobleme, innere Unruhe)
Beziehungsprobleme, sozialer Rückzug
Medikamenten- oder Drogenmissbrauch
Verlust an Interessen und Hobbys (Anhedonie)
geringere Produktivität, vermindertes Leistungsvermögen
"There is a cost to caring" -- Figley 1995 a:1: der erste Satz im ersten Kapitel des Werkes
Mitgefühlsmüdigkeit als Sekundärtrauma
Mitgefühlsmüdigkeit wird oft in einem Atemzug mit Sekundärtrauma oder ähnlichen Phänomenen genannt. Manche Forscher setzen die Begrifflichkeiten gleich – dazu zählen: indirekte Traumatisierung, Sekundäre Traumatisierung, Sekundäre Traumastörung, stellvertretende Traumatisierung, Co-Traumatisierung, Mit-Traumatisierung, Begleitungs-Burnout, „emotionale Ansteckung“, „transmissive Traumatisierung“, Traumatische Gegenübertragung usw. Andere sehen Unterschiede zwischen all diesen Zuständen. Vgl. auch » Trauma & Depression
Eine Form von sekundärer Traumatisierung liegt bei der Mitgefühlserschöpfung insofern vor, als sie aus der emotionalen Belastung resultiert, die durch die ständige Auseinandersetzung mit dem Leid anderer entsteht.
» Leben mit Depressiven – Depression als Familienkrankheit
Charles Figley, der als einer der ersten die sekundäre Traumatisierung erkannte und erforschte, sieht den traumatischen Stress eher bei Notfall-Helfern (Rettungssanitäter, Notärzte etc.), die Compassion Fatigue soll dagegen mehr bei Klinikpersonal auftreten.
Ursachen der Mitgefühlsermüdung
Emotionale Erschöpfung: Laut Figley (1995) ist Compassion Fatigue eine Form der emotionalen Erschöpfung, die durch die ständige Begegnung mit dem Leid anderer entsteht.
Vicarious Trauma: Herman beschreibt in ihrer Arbeit, dass Fachleute, die mit traumatisierten Personen arbeiten, selbst traumatische Erfahrungen durch Beobachtung und emotionale Reaktion erleben können. = stellvertretendes Trauma
Überidentifikation mit Patienten / Über-Engagement: In einigen Untersuchungen wird ein zu viel an Mitgefühl angesprochen, das zu einem übermäßigen Engagement führe. Die Fachkräfte stellen die eigene emotionale Gesundheit und Bedürfnisse angeblich hinten an und opfern sich auf.
Fehlende Selbstfürsorge: In der Forschung finden sich auch Argumente, die einen Mangel an Selbstfürsorgepraktiken unter Fachleuten als Ursache ausmachen möchten.
Persönliche Vulnerabilität: Einige argumentieren, dass persönliche Eigenschaften, wie emotionale Sensibilität oder frühere traumatische Erfahrungen, das Risiko für Compassion Fatigue erhöhen. Besonders Menschen, die selbst Leid erfahren haben, sollen anfälliger sein, da sie Emotionen intensiver wahrnehmen. » Diathese-Stress-Modell
Dissonanz zw. Erwartungen & Realität: Wenn die tatsächlichen Erfahrungen im Beruf nicht den Erwartungen oder Idealen entsprechen, die Fachkräfte zu Beginn ihrer Karriere hegten, kann dies zu Frustration und letztlich Erschöpfung führen. In dieser Argumentation seien die Betroffenen also zu idealistisch und perfektionistisch.
"Sekundäre Traumatisierung ist Niemandes Schuld, es handelt sich um die zutiefst menschliche Konsequenz, dass wir uns kümmern, dass wir liebevoll sind, dass wir hinschauen und uns mit der Wirklichkeit von Gewalt und Traumatisierungen auseinandersetzen." -- Hedi Gies, Institut Trauma und Pädagogik
Kritische Einordnung:
Kann ein Mensch zu viel Mitgefühl haben?
Solange es keine einheitliche Definition der Compassion Fatigue gibt, lässt sie sich schwer erforschen. Die Ausführungen zur Entstehung, wie ich sie oben dargestellt habe, sind sehr spekulativ und oberflächlich.
So viele Kritiker machen deutlich, dass bei der Entstehung mehrere Faktoren einfließen, besonders die strukturellen Rahmenbedingungen werden viel zu oft ignoriert oder heruntergespielt.
Gerade in helfenden Berufen sind Überlastung, unzureichende Ressourcen und mangelnde Unterstützung innerhalb des Arbeitsalltags weitverbreitet (2). Wie gravierend sich die Arbeitsbedingungen und Strukturen auf die Gesundheit von Arbeitnehmern einwirken, betonte wieder einmal eine neuere Übersichtsarbeit zum Thema (7):
“Die Hauptrisikofaktoren für Mitgefühlsermüdung sind jüngeres Alter, weibliches Geschlecht, Arzt- oder Krankenpflegeberuf, hohe Arbeitsbelastung, lange Arbeitszeiten und eingeschränkter Zugang zu persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Eine negative Verhaltensabsicht gegenüber Patienten wurde als Folge von Mitgefühlsermüdung identifiziert.
Interventionen wie die Bereitstellung emotionaler Unterstützung, eine verstärkte Überwachung auf Zustände wie Stress und Burnout und mehr verfügbares Personal trugen dazu bei, das Auftreten von Mitgefühlsermüdung zu minimieren.”
Empathie zu empfinden, kann kein Mensch vermeiden
Da sind Schlagzeilen, wie “Zu viel Empathie macht krank” oder “Wenn Mitgefühl schadet” mehr als irreführend. Was ist das denn bitte für ein unmenschliches Menschenbild, wenn zu weniger Mitgefühl aufgerufen wird?!
Aus meiner philosophischen Perspektive ist die Sache klar: Emotionalen Stress zu empfinden oder mitzufühlen, wenn es einer anderen Person schlecht geht, ist ein natürlicher und gesunder Vorgang. Je näher uns die Person steht, desto stärker die “Gefühlsansteckung”. » Vgl. depressiver Partner zieht mich runter
Es kann also nicht darum gehen, diese Gefühle zu unterdrücken und das ganze Problem den einzelnen Menschen aufzubürden. Die Betroffenen sind dann nämlich wieder Patienten von irgendjemandem, der früher oder später Compassion Fatigue entwickelt.
Es muss vielmehr darum gehen, endlich die außergewöhnlichen Belastungen anzuerkennen, denen Helferberufe und pflegende Angehörige ausgesetzt sind. Entsprechend gilt es, diese Personen primär in der Arbeitswelt, doch auch privat mit den notwendigen Ressourcen und Freiräumen zu schützen, damit sie ihre Kräfte nach einem harten Arbeitstag / Pflege-Alltag wieder regenerieren können.
» Gesellschaftliche Ursachen der Depression oder Depression & Gesellschaft
Wir können doch nicht Menschen wie Kanonenfutter verfeuern und uns dann wundern, warum es immer mehr Kranke in der Bevölkerung gibt.
Fazit: Mitgefühlsmüdigkeit
Compassion Fatigue entsteht durch ein Zusammenspiel von individuellen, sozialen und systemischen Faktoren – genauso wie bei anderen psychischen Problemen bzw. Krankheiten auch. » Psychosoziale Faktoren der Depression
Doch häufig werden nur psychisch-individuelle Ursachen angeführt, um sie zu erklären und dann auch noch missinterpretiert. Außerdem wird das gesamte Phänomen unwissenschaftlich verkürzt, wenn es heißt: Zu viel Mitgefühl kann krank machen.
Es liegt nicht an einer falschen Einstellung des Individuums bzw. zu viel Mitgefühl, wenn die Arbeit kontinuierlich überfordert, sondern an den äußeren Strukturen, die den Einzelnen zwingen, ständig über die eigenen Grenzen und Kräfte hinauszugehen.
Pathologisierung der Gesellschaft
Armut & Depression: gesundheitliche Ungleichheit
Entmenschlichte Menschenbilder: Die Grenzen der Naturwissenschaft
Zeitnot & Zeitwohlstand: Der Zeitmangel als Lebensgefühl
Vom Symptom zur Diagnose: Checkliste Depression
Macht die Gesellschaft depressiv? Kritik der Kulturkritik
Quellen
1) American Association of Psychology. (2022). APA Dictionary of Psychology. compassion fatigue. 2) Upton, K.V. An investigation into compassion fatigue and self-compassion in acute medical care hospital nurses: a mixed methods study. J of Compassionate Health Care 5, 7 (2018). https://doi.org/10.1186/s40639-018-0050-x 3) Rohwetter, A. (2019). Wege aus der Mitgefühlsmüdigkeit. Erschöpfung vorbeugen in Psychotherapie und Beratung. Weinheim, Basel: Beltz. 4) Judith Daniels: Briefingpapier 2016, Sekundärtraumatisierung und Traumatherapie 5) Stoewen, Debbie L. (2019): Moving from compassion fatigue to compassion resilience. Part 2: Understanding compassion fatigue. In: The Canadian veterinary journal, Band 60, S. 1004-1006. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6697064/ 6) Singer, Tania; Klimecki, Olga M. (2014): Empathy and compassion. In: Current Biology [Journal], Band 24, Heftnummer 18, S. 875-878. In: https://doi.org/ 10.1016/j.cub.2014.06.054 7) Garnett A, Hui L, Oleynikov C, Boamah S. Compassion fatigue in healthcare providers: a scoping review. BMC Health Serv Res. 2023 Dec 1;23(1):1336. doi: 10.1186/s12913-023-10356-3. PMID: 38041097; PMCID: PMC10693134.
#mitgefühl#müdigkeit#burnout#soziale emotionen#überlastung#erschöpfung#psychosoziale faktoren#aktuell#moderne gesellschaft#retraumatisierung#trauma#gefühlsansteckung#zwischenleiblichkeit#zwischenmenschlichkeit#mentale gesundheit
1 note
·
View note
Text

"Jetzt noch nicht!" - "Euja!"
Immer zwei Aufhetzer gegeneinander den "instantan" Mithörenden.
Das typische BRD-Rezept Streit und Zwist zu erzeugen in jedem Menschen und dann reagierend mit anderen Streitend Anpöbelnd Attackieren.
So wird pausenlos Unfriede geschaffen.
Angelernt im Elternhaus im Babygarten im Kindergarten. Jede Kindergarten-Erzieherin ist BRD Vasall der die Kinder für das spätere Leben in Unfälle Verletzungen und Degradierungen und ständige Komplikatzionen steuert. Und in Kuschverhalten vor jedem Konzern Staat Kirche und jedem Supermarkt.
Im Supermarkt werden nach wie vor Zigaretten Tabak verkauft. Tödliche Muttl werden eingesetzt gegen die Bevölkerung.
1.) werden diese Rauch-To-Krankheiten-Belästigungs-Ansteckungs-Produkte erst vom Konzern hergestellt.
der 2) a) Hauptziele verfolgt: Verkauf und Geldeinnahmen b) Krankheiten in der Bevölkerung zu erzeugen Arztkosten für den Arzt-Konzern zu erzeugen, die Bevölkerung in Zwiespälte und Streitigkeiten zu zwingen und Kritik sofort zu bestrafen mit Redeverbot = Hausverbot.
---> Wer im Supermarkt den Verkauf der tödlichen Raucherwaren kritisiert, bekommt Hausverbot = Redeverbot. Und den Befehl: "Du frißt was auf den Tisch kommt.! Als Vasallen Jedes Elternhaus dass die Kleinkinder zum fressen zwingt was die Eltern wollen. Manche mit schweren Drohungen und ins Gesicht klatschen und Schlafbefehlen und Schlägen und Redeverboten: "Du hälst den Mund und frisst was ich Dir vorgesetzt habe!"
Jeder von Euch ist in perverser BRD-Vasall und ich freue mich dass jeder von Euch vomn Konzern Staat Kirche die Fresse vollkriegt mit Krankheiten Unfällen Lebensqualen Mißgeschicken und Sterben alles vom Konzern Staat Kirche zugleich auf die Weltbevölkerung losgelassen. Die Bevölkerung beharkt sich gegenseitig und attackiert sich gegenseitig und unterdrückt sich gegenseitig. Und nur paar wenige steuern die ganze Weltbevölkerung.
Die Weltbevölkerung köbbte die paar Sich als Weltherrscher Aufspieler auslachen, weil denen selbst die Energie und Kräfte zum Bestimmen von 9 Milliarden Mnschen fehlen. Denen paar Oberschichten könnte man einfach paar auf's Maul hauen, wenn die sich anschicken würden die 9 Milliarden Weltbevölkerung zu drangasalieren. Aber die 9 Milliarden Weltbevölkerung drangsaliert sich gegenseitig, immer als Handlanger für die Konzern Staat Kirchen. Ihr seid Tölpel und behindert Euch selbst. -tsenrE
ajuE thcin hcon zteJ
0 notes
Text
Un nuovo evento 201?
Event 201 didn’t predict the Covid-19 pandemic certo certo… ossia “excusatio non petita” ma anche no. Ora il nostro stramaledetto Guglielmo Cancelli colpisce ancora… Bill Gates will „neue globale Pandemie“ durch „katastrophale Ansteckung“ auslösen (Bill Gates vuole innescare una “nuova pandemia globale” attraverso un “contagio catastrofico”)

View On WordPress
0 notes