#lydia nahm
Explore tagged Tumblr posts
Text







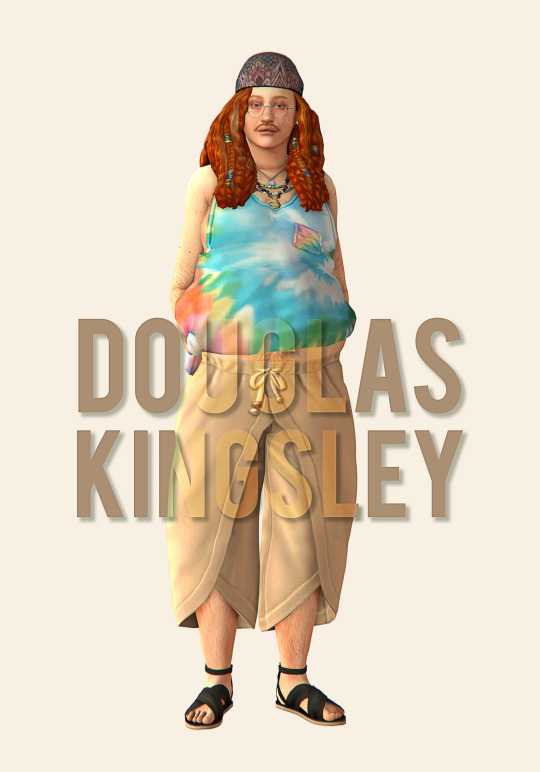
family portraits No.2
the bros. when your roommates turn into your unconventional cool family
cc creators 🧡
@nucrests @jius-sims @aharris00britney @serenity-cc @sheabuttyr @johnnysimmer @simstrouble @darte77
#greetings#ive been in cas#hehehe#working on my milestone of revamping all my ocs#but yeah. its great#the sims 4#ts4#my sims#sims 4 cas#ts4 ocs#meet the bros#tucker ohio#daniel ortega#douglas kingsley#lydia nahm#dana richards#actually dana and tucker are half siblings#and ms. tryna from my kashisun nose presets post is their mom#i just decided that last one. i love it#alex burgess#daniel bryan burgess#those two are siblings too. if it ist obvious#matias boletti#simblr#showusyoursims#wcif friendly
19 notes
·
View notes
Text
1_Der Mitternachtssnack

Alles was Bertram wollte, war zurück in sein Häuschen zu gehen. Nach Hause. Er hatte sich so lange dagegen gewehrt einen Fuß in diese Anstalt zu setzen. Doch als Ignaz vor einem halben Jahr gestorben war, hatte Nick sich schon bald in den Kopf gesetzt, dass Bertram allein in dem Haus nicht mehr zurecht kommen würde. Was wusste der denn schon! ‚Wir hätten dem Burschen nicht immer seinen eigenen Kopf lassen dürfen.‘ grummelte Bertram in sich hinein. In dem Moment fiel ihm auf, dass er schon wieder mit sich selbst redete und er verstummte abrupt und sah sich um. Naja hier störte das keinen.
Bertram seufzte. Eigentlich war er ja gar nicht sauer auf seinen Sohn. Er wusste ja, dass Nick recht hatte. Das Häuschen, das schon eher ein Haus war, machte viel Arbeit und es war schrecklich leer ohne seinen Ignaz, der stundenlang Posaune übte.
Gerade mal eine knappe Woche war er nun hier und sein Zimmer war groß und einigermaßen gemütlich. Aber es war nun einmal nicht zu Hause. Er konnte seine Zimmernachbarn hören, Lutz auf der rechten Seite und Frederik auf der linken Seite. Und sogar Lydia aus dem Zimmer gegenüber konnte er manchmal telefonieren hören. Immerhin waren alle nett.
Das einzige, was wirklich toll war, war das Essen. Wenn Nick ihn fragte, wie er sich einleben würde (und das tat er jeden Tag, weil er entweder anrief oder vorbeikam) erzählte Bertram als erstes, was es an dem Tag zum Essen gegeben hatte.
Aller Anfang ist schwer
Für heute Abend hatte er sich zum Halma spielen mit Albin aus dem Erdgeschoss verabredet. Da Albin mit dem Rollstuhl lieber nicht in den Fahrstuhl wollte, würden sie sich im Gesellschaftsraum treffen. Zugegebenermaßen war der Gesellschaftsraum ziemlich heimelig und schön. Neben der Bibliothek, war das der Ort an dem sich Bertram die meiste Zeit aufhielt. Auch, wenn er es Nick gegenüber nicht zugeben wollte: seit Ignaz gestorben war, fühlte er sich unendlich einsam und auch all die Besuche von Nick oder dessen Frau Ronja oder sogar seiner allerliebsten (da einzigen) Enkelin Irma konnten die Stille füllen, die ihm die Luft nahm, sobald er allein in seinem Zimmer war.
Bisher hatte er jeden Abend in einem der gemeinschaftlichen Räume der „Seniorenresidenz Goldener Bär“ verbracht und schon einige Bekanntschaften geschlossen. Mit Albin hatte er sogar schon an seinem ersten Tag eine große Gemeinsamkeit entdeckt: Sie waren beide immer die ersten im Speisesalon.
Sie hatten sich daher für ihre heutige Spielrunde sicherheitshalber für den „Mitternachtssnack“ um neun Uhr am Abend eingetragen. Schon das allein, munterte Bertram etwas auf.
Lasset die Spiele beginnen
Da Albin und Bertram beide schon kurz vor dem Gong für das Abendessen vor dem Salon standen, waren sie als eine der ersten mit dem Abendessen fertig. Mit vollen Bäuchen stahlen sie sich daher noch vor dem Ende der Abendessenszeit in den Gesellschaftsraum, um endlich auch einmal an den wohligen Plätzen am Kamin sitzen zu können. Die bisherigen Abende hatte sich keiner von ihnen rechtzeitig vom Abendessen loseisen können, sodass die Sessel am knisternden Feuer schon immer belegt gewesen waren. Aber heute würden sie es sich so richtig gut gehen lassen. Während Albin die mitgebrachten Snacks aus seiner Tasche am Rollstuhl räumte (die die Zeit bis zum „Mitternachtssnack“ überbrücke sollten), holte Bertram das Halma Spiel aus dem riesigen, wunderschön verzierten alten Holzschrank und trug es zum Platz am Feuer, wo er es aufbaute.
Sie spielten Partie um Partie und schmiedeten Pläne, wie sie die Küchenchefin davon überzeugen könnten, ihre Leibgerichte in den Geschmackskanon der Residenz aufzunehmen. Keiner der beiden hatte das Bedürfnis über mehr als Belangloses zu plaudern, obwohl sie bisher außer ihren Vornamen und Essensgewohnheiten nichts voneinander wussten. Trotzdem verflog die Zeit bis zum Snack.
Snacktime
Mit dem Stand Halma 4:3 für Bertram und Dame 3:2 für Albin öffneten sich schließlich die Türen und die Abendschicht kam mit dem Wagen, auf dem sie die letzte Mahlzeit des Tages herein bugsierten. Das Beste an dieser Mahlzeit war ganz bestimmt, dass man vorher nicht wusste, was es geben würde, dachte Bertram bei sich. Eine Überraschung also. Und auch, wenn er sonst Überraschungen nicht so gerne mochte, war diese hier eine, an die er sich würde gewöhnen können. Da das Personal um diese Uhrzeit nicht mehr so voll besetzt war, übernahmen alle die noch da waren, egal ob Pflegekräfte, Küchenleute oder Sicherheitsdienst, diese Aufgabe, wenn sie gerade Zeit hatten. Denn, wie Bertram im Laufe der Woche erfahren hatte, der Mitternachtssnack war kein „offizielles“ Angebot.
Je nachdem, ob die Küche an dem Tag noch Überbleibsel los werden wollte oder angebrochene Lebensmittel aufbrauchen musste oder auch, ob an diesem Abend die Pflegekräfte zu viel zu tun hatten, wurde am Abend noch eine Kleinigkeit gezaubert. Bertram hatte sich schon ein wenig gewundert. Denn das wusste doch jeder, dass essen so spät auf die Nacht nicht gesund war.
Eine Köchin namens Agathe
Albin hatte ihm jedoch erklärt, dass sie diese Aufmerksamkeit der Küchenchefin zu verdanken hatte, die fand, dass die Alten es ja wohl schwer genug hatten, hier im Heim zu sitzen. Als Albin ihm erzählte wie der ganze Salon während einer Mittagszeit den Streit zwischen Küchenchefin und Heimleitung mithörte (die eine wollte ihre Idee den Bewohner:innen vorstellen und die andere sah sich in der Verantwortung für die Gesundheit der „Residierenden“), musste er immer noch schmunzeln.
„Die zwei sind richtig aneinander geraten und wir haben alles mitgekriegt. Die Leitung ist aber auch eine Spielverderberin. Agathe hat ihr richtig die Meinung gegeigt.“
Agathe war die Küchenchefin und eine große und breitschultrige Frau Mitte 50, mit riesigen Händen, der man ansah, dass sie selbst genoß, was sie kochte. Die Alten liebten sie ausnahmslos. Nun, da der Wagen hereinfuhr, wurde Bertram auch klar warum. Ja, das Essen bisher war wirklich gut gewesen, aber das was hier ankam war nicht für den Magen, das war fürs Herz. Zwei große, glasige Hefezöpfe mit kristallenem Zucker, dazu Butter, Marmelade und mehrere Thermoskannen mit heißer Schokolade.
Albin war schon losgerollt, als Bertram sich beeilte aufzustehen.
Der Abend endete, indem alle die zum Snack geblieben waren, mitsamt den Angestellten, die vielleicht einen Moment Zeit hatten, um durchzuschnaufen am großen, runden Tisch in der Raummitte zusammen kamen, aßen, tranken und sich unterhielten.
Als Bertram später in seinem Bett lag klangen all die neuen Eindrücke nach. Die Gesichter der anderen, ihre Worte, Albins freundliche Art, das Gebäck, die Schokolade und die Gemeinschaft, die an diesem Abend entstanden war. Zum ersten Mal seit langer Zeit spürte er keine Einsamkeit bevor er einschlief.
7 notes
·
View notes
Text

Ich hoffe, es wird euch nicht langweilig. Aber zur Zeit habe ich doch meine Freude daran mit Lydia und Anna zu arbeiten. Wollen wir hoffen, dass es noch lange anhält. Vielen Dank, wie immer, an @blitzgeschichten für den herrlichen Prompt! Auch, wenn sie meistens mehr Inspiration als Thema sind. ;)
In deiner Schuld (582 Worte)
Das Mädchen - Anna, sie heißt Anna - wirkte unsagbar zierlich in dem großen Bett. Ihr dumpfes, rotes Haar war ein fast schon unnatürlicher Kontrast zu ihrer bleichen Haut und den weißen Kissen. Dunkle, fast schon schwarze, Ringe lagen unter ihren Augen und ihre Lippen hatten jegliche Farbe verloren.
Sie wirkte gespenstisch und zerbrechlich.
Sie wirkte tot. Lydia fuhr sich mit der Hand über ihre brennenden Augen.
Anna war nicht tot. Ihr langsamer, gleichmäßiger Herzschlag klang wie Kirchenglocken in Lydia’s Ohren. Jedes Klopfen fuhr ihr in die Knochen; ließ das Blut in ihren Adern singen. Es war ein unwirkliches Gefühl. So fremd und doch irgendwie vertraut; als ob sie schon einmal in dieser Situation gewesen war. Aber sie konnte sich an keinen Moment wie diesen erinnern, so hart und lange sie auch nachdachte. Das einzige, was sie herauf beschwor, waren stechende Kopfschmerzen. “Wer bist du wirklich, Anna?” fragte Lydia in die Stille des Raumes hinein und verzog das Gesicht. Ihre Stimme war brüchig. Ihre Kehle fühlte sich trocken an. Sie lehnte sich zur Seite und hangelte nach der Wasserflasche, die neben ihrem Sessel stand. Dabei fiel ihr Blick auf die kleine Uhr an der Wand. 02:37 Lydia seufzte und blickte wieder auf Anna’s regungslose Form. Das Mädchen war ein Rätsel. Ein kompliziertes, gefährliches Rätsel. Lydia war sich nicht mehr so sicher, dass sie die Antwort darauf wirklich wissen wollte. Ihre Finger schlossen sich um den schlanken Hals der Flasche, als ein kaum merkliches Geräusch auf dem Flur durch Anna’s Herzschlag brach. Adrenalin fluttete sekundenschnell Lydia’s Körper und verdrängte ihre Müdigkeit. Sie schloss die Augen und konzentrierte sich auf ihr Gehör. Das leise Rascheln von Stoff. Gedämpfte Schritte auf dem Teppich. Stimmen, zu leise, um sie zu verstehen, aber definitiv mehr als eine. “Verdammt. Wie haben sie uns gefunden?” Lydia ließ die Flasche los. Ihr Körper quitierte ihr rasches Aufstehen mit einem Moment des Schwindels. Dann war sie an der Tür und lauschte. Sie konnte drei Männer ausmachen, die miteinander diskutierten. “Bist du sicher, dass sie hier sind?” “Auf jeden Fall. Torres hat sie hier hinein verschwinden sehen!” “Und woher wissen wir, dass der Plan geklappt hat?” Lydia wartete nicht auf die Antwort. Stattdessen drehte sie sich um und nahm das Zimmer genauer in Augenschein. Sie brauchte etwas, um die Männer aufzuhalten. In einen Kampf gegen drei konnte sie sich in ihrer derzeitigen Verfassung nicht verwickeln lassen. Außerdem musste sie jetzt auch noch Anna in ihrer Planung mit beachten. Warum hatte Anna ihr auch das Leben retten müssen? Ihre Flucht könnte so einfach sein. Sie könnte aus dem Fenster klettern und verschwinden. Eine einzelne Person konnte ganz einfach im Getummel der Stadt untergehen. Verloren gehen. “Verflucht! Wer bist du, Anna?” Lydia starrte die Fenster an, ein Ohr auf die Schritte im Flur gerichtet. Sie musste einen Plan fassen. Und zwar schnell. “Lydia? Was ist passiert?” Anna’s leise Stimme kam unerwartet und einen Moment lang konnte Lydia sie nur entgeistert anstarren. Sie hatte sich aufgesetzt und blickte Lydia mit verwirrter Miene an. “Lydia?” Lydia schüttelte den Kopf und fasste einen Entschluss. Sie konnte später noch darüber nachdenken, was sich das Schicksal gedacht haben musste, als es ihr Anna in den Weg gestellt hatte. “Keine Zeit zum reden,” Lydia schlich zum Bett. “Glaubst du, dass du dich an mir festhalten kannst?” “Was? Warum?” Anna starrte sie an. Ihr Blick war verklärt und Lydia wusste, dass sie mehr Ruhe brauchte. Aber ihre Zeit war abgelaufen. “Weil ich in deiner Schuld stehe und diese jetzt begleichen werde.”
5 notes
·
View notes
Text
Feind in der Fremde
von Dramafanforever / Drama fan
(Link zu Kapitel 1)
Kapitel 2
Harry war gerade dabei, die Auslage mit belegten Baguettes und Bagels zu bestücken, als seine Geschäftsführerin Jill das Café betraf. „Hi!“, grüßte die Squib mit ihrer üblichen Fröhlichkeit. „Morgen“, gab Harry unenthusiastisch zurück. „Ist was?“ Jill blieb an der Theke stehen und schaute Harry fragend an. Sie arbeitete seit der Eröffnung des Cafés von eineinhalb Jahren für Harry und bemerkte sofort, wenn Harry schlecht drauf war. „Der neue Mieter ist in Lydias Wohnung eingezogen“, erklärte Harry und zog die Mundwinkel nach unten. „Echt? Die ist doch noch gar nicht ausgeräumt.“ „Die wollten die Wohnung doch sowieso möbliert vermieten und mit ‚Ausstattung‘.“ Harry verstand Jills erstaunten Tonfall nicht. „Ja, aber warst du mal oben? Da ist alles noch drin. Ich meine wirklich ‚alles‘. Der Kühlschrank und die Mülleimer wurden geleert, aber ansonsten…“ Jill ging nach hinten, um ihren Mantel und die Tasche abzulegen. Harry nahm das Tablett mit den Croissants und arrangierte sie in der Ablage so, dass allein ihre Fülle einem das Wasser im Munde zusammenlaufen ließ. Als Jill zurückkam, nahm er das Gespräch wieder auf: „War Samstag denn nicht der Verwandte von Lydia da, um die Wohnung auszumisten?“ Harry hatte das Wochenende bei Andromeda verbracht, um auf Teddy aufzupacken, und daher nicht mitbekommen, was in der Nachbarwohnung geschehen war. Jill kontrollierte die Kaffeemaschine und ging danach zum Selbstbedienungskühlschrank, um zu schauen, ob Flaschen nachgefüllt werden mussten. „Ja, der ist auch gekommen, ein Mr Erkle. Unsympathischer Typ. Ich habe ihn wie verabredet reingelassen. Er hat sofort angefangen, die Schränke zu durchwühlen und alles einzustecken, was wertvoll war. Ich bin nicht oben geblieben, aber als er herunterkam, hat er noch einen Kaffee bestellt und sich die ganze Zeit über den Zustand der Wohnung ausgelassen. Er meinte, er würde ‚die Alte‘ gar nicht kennen und daher auch ganz bestimmt nicht ihren ganzen armseligen Plunder entsorgen. Seine Worte, nicht meine. Sie hätte ihm nicht einen Penny hinterlassen und daher gäbe es für ihn auch keinen Grund, sich um ihre Sachen zu kümmern.“ „Heißt das, Lydias ganze Sachen sind noch oben in der Wohnung?“ „Jupp. Alles noch da, nur der Schmuck fehlt und ein paar Goldmünzen. Die hat mir dieser Erkle gezeigt als er seinen Kaffee getrunken hat. Als er weg war, bin hochgegangen und habe nachgeschaut, ob er sonst noch irgendwas gemacht hat.“ Wie Harry war auch Jill zu Lydias Lebzeiten ein paarmal in der Wohnung gewesen, um ihr z.B. die Post hochzubringen oder ihr die schweren Einkaufstaschen hochzutragen. Sie hatten ihr auch beim Wechsel von Glühbirnen geholfen oder wenn es sonst Probleme gab, mit denen die alte Dame nicht alleine fertig wurde. „In den Schränken hängen noch ihre Kleider, die Regale sind voll von Büchern und überall stehen ihre privaten Fotos rum. Sogar der Putzschrank ist noch bestückt und in der Vorratskammer stapeln sich Dosen und Einmachgläser. Sogar ihr Shampoo und Duschzeug sind noch da, und ihre Zahnbürste. Das muss jetzt wohl alles der neue Mieter entsorgen. Stell’ ich mir für den ein Bisschen ekelig vor.“ Harry wusste nicht, was er davon halten sollte. Auf der einen Seite fühlte er Schadenfreude, dass Malfoy in einer Wohnung leben musste, die so von einer Muggel durchtränkt war. Er konnte sich gut vorstellen, welche Qualen das dem überheblichen Bastard bereiten musste. Andererseits tat es ihn um die persönlichen Dinge von Mrs Pentriss leid. Die Vorstellung, mit welchem Abscheu Malfoy ihre Fotoalben und Briefe entsorgen würden, behagte ihm gar nicht.
Laut überlegte er: „Vielleicht sollte ich Lydias Privatsachen rausholen, bevor Malfoy sie in die Hände kriegt. Oder ich spreche noch mal mit dem Ministerium. Aber die werden wahrscheinlich keinen Finger rühren – wie üblich. Erst recht nicht, wenn der neue Mieter jetzt schon drin ist.“ „Malfoy? Ist das der neue Mieter? Der Name kommt mir bekannt vor.“ „Hm? Ja. Draco Malfoy. Er war in meinen Jahrgang in Hogwarts. Ich kann ihn nicht ausstehen. Die Malfoys waren eine Todesserfamilie. Dracos Vater war Voldemorts rechte Hand, bis er in Ungnade fiel. Malfoy Manor war gegen Ende des Krieges Voldemorts Hauptsitz. Die Malfoys haben noch in der Schlacht von Hogwarts versucht, die Seiten zu wechseln, bzw. sich abzusetzen. Das hat ihnen aber auch nicht mehr geholfen. Sie sind alle gefangen genommen und verurteilt worden. Lucius hat den Kuss bekommen. Narcissa, seine Frau, wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt, ist aber letztes Jahr verstorben, und Draco sollte für 5 Jahre nach Azkaban. Er darf aber die letzten zwei Jahre in der Muggelwelt absitzen – ohne Zauberstab. Das nennen sie Bewährungsstrafe.“ „Also ist Draco derjenige, der oben eingezogen ist? Ein Todesser?“, japste Jill. „Das geht gar nicht.“ „Tja. Bedank dich beim Ministerium. Fast könnte man meinen, sie wollen uns damit absichtlich eins auswischen. Aber keine Sorge, wenn Malfoy Ärger macht, werden wir ihn schon irgendwie wieder loswerden und wenn er zurück nach Azkaban kommt.“ „Wie kommt das Ministerium auf die Idee, einen Todesser in ein Haus zu stecken, in dem Squibs und Muggelstämmige ein- und ausgehen. Wir sind ja unseres Lebens nicht mehr sicher.“ Harry hätte Jills Bemerkung fast überhört, weil er in Gedanken bereits alle Leute im Ministerium durchging, die er ansprechen könnte, um Malfoy aus dem Haus zu bekommen. Etwas in ihrer Stimme ließ ihn dann aber doch aufhorchen. Offenbar hatte er es mit seinem Malfoy-Bashing etwas übertrieben. Immerhin hatte er bei dessen Gerichtsverhandlung für ihn ausgesagt, auch wenn er ihn nicht leiden konnte. „Äh, er trägt zwar das Mal, aber ein richtiger Todesser war er nie. Er sollte Dumbeldore umbringen, hatte dann aber doch zu große Skrupel, das durchzuziehen. Vielleicht drückt er euch Sprüche, aber Angst müsst ihr nicht vor ihm haben. Alles, was er im Auftrag Voldemorts getan hat, geschah, um sein eigenes Leben oder das Leben seiner Eltern zu retten. Er hielt Muggels allerdings immer für Abschaum und hat Hermine immer als „Schlammblut“ bezeichnet. Außerdem hat er sich regelmäßig über Rons Familie lustig gemacht, weil sie nicht so reich waren seine. Er ist wirklich ein richtiges Arschloch, feige, hinterlistig und eingebildet.“ „Ein typischer Slytherin also.“ Harry bemerkte, dass er sich wieder in Rage geredet hatte und vielleicht etwas über das Ziel hinausgeschossen war. Er sollte bestehende Vorurteile nicht noch unterstützen, schließlich arbeitete er mit seiner Begegnungsstätte daran, Vorurteile und Ängste abzubauen. Wenn er alten Klischees noch mehr Nahrung gab, würde sich nie etwas ändern.
„Nein, nicht alle Slytherins sind so. Malfoy ist einfach ein besonders schlimmer… Mensch.“ „Hoffentlich kommt er nicht auf die Idee, sich ins Café zu setzen. Ich möchte so einen Kerl auf keinen Fall bedienen.“ „Wenn er erfährt, dass das mein Café ist, wird er sich hier nicht blicken lassen. Er hasst mich. Und wenn doch – wie gesagt – wenn er euch einen blöden Spruch drückt, kümmere ich mich darum.“ Jill nickte. Sie konnten ihr Gespräch nicht weiterführen, weil die ersten Kunden ins Café kamen. Harry bereitete zwei „Französische Frühstücke“ zu und hatte den ganzen Morgen viel zu tun, weil sich Eric, die Küchenkraft, krankgemeldet hatte. Harry hatte keine feste Aufgabe im Café. Jill war die Geschäftsführerin und er selbst einfach nur Mädchen für alles. Das Café warf gerade genug ab, um den anderen Mitarbeitern ordentliche Löhne zahlen zu können und die Kosten zu decken. Harry war auf das Geld nicht angewiesen, weil in seinem Verlies in Gringotts genug Gold lag, um ihm bis ins hohe Alter ein sorgenfreies Leben zu ermöglichen. Während Harry in der Küche arbeitete, ging ihm Malfoy nicht aus dem Kopf. Vor allem störte ihn, dass das ganze Privateigentum von Mrs Pentriss nun Malfoy zum Opfer fiel. Das hatte die alte Dame nicht verdient. Er beschloss, später mal im Ministerium nachzuhorchen, was man da machen konnte. Am Nachmittag flohte er Mrs Broomleg, seine Ansprechpartnerin für Muggelimmobilien, an.
„Mr Potter, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Geht es schon wieder um die Bewilligung von noch mehr Extensions-Zaubern? Ich denke, Ihr Café ist schon an der Grenze des Möglichen.“ Harry hatte die hinteren Räume des Cafés mehrfach magisch vergrößern lassen, damit genug Platz für die Gruppenstunden und Seminare vorhanden war. „Nein, es geht um den neuen Mieter, Draco Malfoy.“ „Aha, was ist mit dem? Macht er Ärger? Er ist doch erst heute Morgen eingezogen.“ Mrs Broomleg klang reichlich genervt. „Noch macht er keinen Ärger. Ich wollte nur wissen, wann die Wohnung ausgeräumt wird. Es befinden sich noch die ganzen Sachen von Mrs Pentriss darin, auch ihre privaten Unterlagen.“ „Wieso? Hat sich Mr Malfyo etwa beschwert?“ „Nein. Ich…“ „Das wäre ja auch noch schöner. Der kann froh sein, dass der in so einer schönen Wohnung leben darf und nicht mehr in einer Zelle in Azkaban hocken muss. Also wenn sich der junge Mann auch nur mit einer Silbe beschwert…“ Offenbar konnten sich auch andere Leute in Rage reden. „Nein, Malfoy hat nichts gesagt. Ich finde es einfach nicht in Ordnung, dass Mrs Pentriss‘ Sachen nicht vor seinem Einzug weggeräumt wurden. Sie sind Privateigentum. Ich finde … naja … Wer weiß, was Malfoy damit macht.“ „Was soll er schon damit machen? Das sind doch nur Muggelsachen. Außerdem kann ja nicht mehr viel da sein. Ich hatte mit Mrs Pentriss Verwandten abgemacht, dass er die Wohnung ausräumt. Ich schaue mal nach.“ Bevor Harry eingreifen konnte, verschwand die Sachbearbeiterin, um in ihren Terminkalender zu gucken. Als ihr Kopf ein paar Augenblicke später wieder in den Flammen auftauchte, meinte sie: „Also, ein Mr Erkle müsste eigentlich am Samstagmorgen vorbeigegekommen sein. Sie sollten ihm doch die Tür aufschließen, Mr Potter.“ „Er war auch da, aber er hat nur die Wertsachen mitgenommen und alles andere dagelassen.“ „Hm. Naja, da kann ich leider nichts machen. Jetzt ist Mr Malfoy in der Wohnung und er hat sicher genug Zeit, die Sachen von der Muggeldame zu entsorgen. Vielleicht ist er sogar froh, dass die Wohnung so gut ausgestattet ist. Soweit ich weiß, hat er keinen Zauberstab mehr. Das stimmt doch oder haben Sie ihn mit einem Zauberstab gesehen? Das müssten Sie sofort melden.“ „Ich habe keinen Zauberstab gesehen. Mir geht es auch nicht um irgendwelche Kleidungsstücke und Putzmittel, sondern um Briefe und Fotoalben und andere persönliche Dinge. Die müssen doch irgendwie vor Malfoy geschützt werden.“ „Frau Pentriss ist tot und was sollte Herr Malfoy mit ihren privaten Unterlagen anfangen? Sie war doch nur eine Muggel. Wer interessiert sich schon für die Tagebücher irgendwelcher Muggel? Lassen Sie es mal gut sein, Mr Potter. Da kann sich ruhig der Malfoy drum kümmern.“ Sie wollte sich gerade abwenden, da meinte sie noch: „Ach, Mister Potter. Den Schlüssel zu Mrs Pentriss Wohnung müssen Sie Herrn Malfoy übergeben. Schönen Tag dann noch.“ Harry starrte in die nun verlassenen, grünen Flammen und wusste, dass er hier nicht weiterkommen würde. Die Vorurteile gegenüber Muggel waren durch den Krieg nicht weniger geworden. Auch wenn nur wenige Hexen und Zauberer echte Todesser gewesen waren, so war ihr Gedankengut doch in der gesamten Zauberwelt verbreitet. Trotzdem wollte Harry nicht so schnell aufgeben und fragte sich per Flohnetzwerk so lange im Ministerium durch, bis er bei Dracos Bewerbungshelfer, einem Mister Fletcher landete. Der sah allerdings auch kein Problem darin, Mrs Pentriss persönliche Sachen in Malfoys Obhut zu lassen. „Ich komme erst Ende des Monats vorbei, wenn Draco sicher wieder beruhigt hat“, schloss er das Gespräch. „Draco war ziemlich sauer, dass er seine Bewährungsstrafe unter Muggeln ableisten muss. Hatte wohl gedacht, wir würden ihn sofort wieder auf die Zaubererwelt loslassen.“ Fletcher lachte, als ob das Ganze ein Witz wäre. „Gut, dass Sie mit ihm in einem Haus wohnen. Dann können Sie ja ein Auge auf ihn werfen.“ „Das ist ja wohl nicht meine Aufgabe“, erwiderte Harry ungehalten. „Aber Sie sind doch bestens dafür geeignet, Mr Potter. Sie betreiben da doch so ein Café, wo sich Muggel und Zauberer treffen und austauschen können. Das ist doch perfekt.“ „Ja, aber ich bin sicher nicht Malfoys Kindermädchen und wenn Sie befürchten, er würde Ärger machen, sollten Sie ihn besser irgendwo unterbringen, wo Sie auf ihn aufpassen können.“ „Ich habe keine Angst, dass er Ärger macht. Er ist schließlich nicht ohne Grund auf Bewährung freigekommen. Draco hat sich in Azkaban vorbildlich verhalten. Er hat sogar seinen UTZ-Abschluss nachgeholt und ein Fernstudium für Zaubertränke begonnen. Azkaban ist nicht mehr wie früher, vor dem Krieg. Die Häftlinge bekommen eine Perspektive!“, verkündete Fletscher stolz, als wäre es sein Verdienst und nicht der von Hexen und Zauberern wie Hermine, die sich unermüdlich für Reformen in der Zaubererwelt einsetzten. „Draco plant, nach Ablauf der Bewährungszeit nach New York zu ziehen und zu studieren. Er hat Ziele im Leben, ist ehrgeizig. Das kennt man von den jungen Leuten heutzutage ja sonst nicht mehr. Stei dem Krieg scheinen alle vergnügungssüchtig geworden zu sein, lassen sich treiben. Wie die Muggel. Draco ist da anders. Der wird sich seine Zukunft nicht durch schlechtes Betragen zerstören.“ „Warum muss denn dann jemand ein Auge auf ihn haben, wenn er so ein Vorbild ist?“, fragte Harry giftig. „Um ihm zu helfen, natürlich. Für Draco ist das Leben in der Muggelwelt doch völlig fremd. Da kommen Sie mit Ihrem Muggel-Verbrüderungs-Café doch gerade recht. Sie sind sozusagen prädestiniert, ihm die Muggelwelt näher zu bringen, Mr Potter.“ „Warum sollte ich das tun? Das letzte Mal, als ich Malfoy begegnet bin, wollte er mich mit seinen beiden Freunden an Voldemort ausliefern.“ „Das ist lange her. Wir dürfen nicht nachtragend sein.“ „Ne, klar. War ja auch nur eine Kleinigkeit. Hat sich sicher auch total verändert, der Draco“, meinte Harry ironisch und wusste gleichzeitig, dass Fletcher seinen Sarkasmus nicht verstehen würde. „Genauso ist es. Wir verstehen uns“, flötete dieser auch sogleich und versuchte Harry loszuwerden: „Na, dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß mit Ihrem neuen Nachbarn.“ Harry hatte nicht vor, den Zauberer so schnell davonkommen zu lassen: „Hören Sie, Mr Fletcher, Sie sind doch Malfoys Bewerbungshelfer. Ich denke eigentlich, dass Sie prädestiniert dazu sind, ihm das Leben in der Muggelwelt zu erklären.“ Fletcher hustete und meinte dann: „Ich helfe Draco gerne bei allen Belangen, die die Welt der Zauberer angehen, zum Beispiel, was sein Fernstudium angeht, aber mit der Muggelwelt kenne ich mich nicht aus. Das kann ich nicht leisten und das kann das Ministerium auch nicht von mir verlangen. Es gibt schließlich Grenzen. Wie gesagt, das ist eine Aufgabe für Menschen wie Sie, Mr Potter. Also, ich hab‘ noch zu tun.“ Fletcher hatte die Verbindung so schnell unterbrochen, dass Harry nicht mehr widersprechen konnte. Das hieß aber nicht, dass er auch nur für eine Sekunde in Erwägung zog, Malfoy seine Hilfe anzubieten. Das nächste, was er zu tun gedachte, war allerdings, ihm den Schlüssel wiederzugeben und dabei zu versuchen, Mrs Pentriss persönliche Saschen aus der Wohnung zu holen. Entschlossen ging Harry in den ersten Stock und klingelte. Normalerweise konnte man das schrille Summen der Türglocke im Flur hören, aber alles blieb still. Harry drückte noch einmal auf die Klingel, aber wieder war nichts zu hören. Also klopfte er energisch gegen Malfoys Wohnungstür. Leise Schritte näherten sich, aber es dauerte eine Weile, bis sich die Tür einen schmalen Spalt breit öffnete und das blasse Gesicht von Draco Malfoy erschien. Überraschung huschte über Malfoys Gesicht, wich jedoch schnell dem üblichen gelangweilt-überheblichen Ausdruck, der Harry aus Hogwarts so vertraut war und ihn direkt in eine Angriffshaltung versetzte. Er gab sich jedoch Mühe, seine Antipathie nicht allzu deutlich zu zeigen. Schließlich wollte er Malfoy dazu kriegen, ihm Mrs Pentriss Sachen auszuhändigen. „Hallo Malfoy. Willkommen in der Parkway 55.“ „Was willst du, Potter?“ Harry ignorierte den unfreundlichen Ton. „Wir sind Nachbarn. Ich wollte nur mal ‚Hallo‘ sagen.“ Malfoy zog die Augenbraunen hoch und sah noch hochmütiger aus als sonst. „Nachbarn? Dann war es also doch kein Zufall, dass ich dich da unten in diesem Café gesehen habe.“ „Nein“, erklärte Harry, „ich arbeite da.“ „Dann bist du jetzt also Kellner.“ Es war keine Frage, sondern eine Feststellung und drückte die ganze Verachtung aus, die ein Reinblut für derartige Tätigkeiten übrighatte. „Hast du also etwas gefunden, das deinem Talent entspricht. Wer nichts wird, wird Wirt, nehme ich an.“ „Schöne Alliteration“, gab Harry zurück. Draco schnaufte, seine Lippen verzogen sich für einen Wimpernschlag nach oben. War er amüsiert? „Ist doch etwas Bildung hängen geblieben? Dann wundert es mich, dass das Ministerium keine bessere Verwendung für den Retter der Zaubererwelt gefunden hat als ihn kellnern zu lassen. Außerdem ist das doch ein Muggel-Café, oder nicht?“ „Ja, was dagegen? Das Café gehört übriges mir“, verkündete Harry, natürlich nicht, um klarzustellen, dass er mehr war als eine einfache ‚Servicekraft‘, sondern um Malfoy davon abzuhalten, sich in das Café zu setzen, falls dieser nicht schon genug davon abgeschreckt war, dass dort Muggel ein- und ausgingen. „Sieh an. Aber nur, weil du ein Café im dem Haus betreibst, in dem ich wohne, sind wir noch keine Nachbarn.“ „Da irrst du dich, Malfoy. Ich wohne auch ganz in Nähe.“ Harry freute sich schon darauf, die Bombe platzen zu lassen. Sollte sich Draco über die erzwungene Hausgemeinschaft doch genauso ärgern, wie Harry es tat. „Gleich hier, um genau zu sein.“ Er deutete auf die Tür von der Nachbarwohnung und ergötzte sich an dem Schock, den sich überdeutlich auf Malfoys Gesicht zeigte. Leider hatte der sich schnell wieder im Griff und tat so, als ob ihn das alles nicht sonderlich interessierte: „Tatsächlich? Und ich dachte schon, der Tag könnte nicht mehr besser werden. Wenn mir also etwas Milch fehlt, klopf ich bei dir an. So machen das doch Leute, die in einem Mietshaus wohnen, nicht wahr?“ „Ja, man hilft sich gegenseitig. Aber zu manchen Leuten hält man besser Abstand.“ Malfoy sah Harry kalt an und nickte zustimmend: „Natürlich. Wenn wir das dann geklärt haben, bedanke ich mich für die freundliche Begrüßung und möchte dich nicht weiter aufhalten.“ Das war dann wohl die dritte Person am heutigen Tag, die Harry schnell loswerden wollte. Harry stand aber nicht ohne Grund vor Malfoys Tür. „Äh, ich hätte da noch was.“ „Ein Willkommensgeschenk? Vielleicht einen Kuchen? Das wäre aber nicht nötig gewesen“, antwortete Malfoy sarkastisch. „Als neuer Nachbar wäre das auch eigentlich deine Aufgabe“, konterte Harry. „Wenn ich herausgefunden habe, wie der Herd funktioniert, mache ich mich gleich an die Arbeit.“ „Oh, das ist nett. Ich kann dir zeigen, wie das mit dem Herd geht. Ich muss sowieso mal in die Wohnung.“ „Nein danke, das finde ich wohl selbst heraus. Aber ich lade dich selbstverständlich zur Einweihungsfeier ein und gebe dir eine Führung.“ „Das ist nicht nötig, ich kenne die Wohnung. Ich habe mich mit Lydia, deiner Vormieterin, sehr gut verstanden. Daher würde ich jetzt auch gerne ihren persönlichen Kram aus der Wohnung holen. Das Ministerium hat wohl vergessen aufzuräumen, bevor sie dich da reingesetzt haben.“ „Persönlicher Kram?“ „Briefe, Fotos, Ordner und Ähnliches. Du kannst damit nichts anfangen.“ Draco sah Harry abschätzig an. Kurz schien er zu überlegen, wie er auf Harrys Aufforderung reagieren sollte. Dann verzog er den Mund zu einem gekünstelten Lächeln und Harry wusste, dass Malfoy ihn nicht hineinzulassen würde, einfach nur, um ihm eins auszuwischen. „Nun, ich werde die Schränke durchgehen und ihre Sachen zusammenpacken. Wenn ich fertig bin, kann ich sie dir vor die Tür stellen.“ „Es wäre doch einfacher, wenn ich sie mir eben selber holen würde“, versuchte Harry seinen ehemaligen Mitschüler zu überzeugen. „Aber das dauert doch recht lange und ich habe heute leider keine Zeit für sowas. Das tut mir wirklich leid, Potter, aber ich verspreche dir, ich kümmere mich in den nächsten Tagen darum.“ „Ich möchte aber nicht, dass etwas Vertrauliches in falsche Hände gerät.“ Malfoy verlor sein süffisantes Grinsen nicht, als er antwortete: „Da hast du wirklich Glück, denn in meinen Händen sind vertrauliche Unterlagen ganz wunderbar aufgehoben. Sonst noch was?“ „Warum musst du dich jetzt querstellen, Malfoy?“, fragte Harry ungehalten. „Du kennst die alte Dame doch gar nicht.“ „Nein, aber durch ihre ganzen Besitztümer fühlt sie sich schon ganz vertraut an. Guten Tag, Potter.“ Draco wollte die Tür zudrücken, aber Harry stellte schnell seinen Fuß dazwischen. „Sei kein Arsch, Malfoy, ich möchte die Sachen einfach …“ „…in Sicherheit bringen? Du kannst mich mal, Potter. Wenn ich Zeit und Lust habe, such ich den Kram zusammen, aber reinlassen werde ich dich mit Sicherheit nicht. Nimm jetzt deinen Fuß weg, sonst kannst du gleich mit einer Quetschung nach Sankt Mungo apparieren. „Malfoy…“, drohte Harry. Mit einer schnellen Bewegung riss Malfoy die Tür auf, um sie heftig zuzuknallen. Harry konnte gerade noch rechtzeitig seinen Fuß wegziehen. „Scheiße, Malfoy. Du hast dich kein Stück verändert“, schrie Harry aufgebracht durch die Tür. „Fick dich, Potter“, kam sogleich die Antwort. „Wer sich nicht verändert hat, bist du! Und jetzt verzieh dich.“ Wütend schlug Harry mit der Faust gegen Malfoys Haustür. „Arschloch!“ Dann drehte er sich um und lief die Treppe hinunter. Dieser Drecksack, dieser Pisser. Wäre er doch in Azkaban verrottet! Als Harry im Café ankam, bemerkte er, dass er Malfoys Wohnungsschlüssel noch immer in den Händen hielt. Tagebuch – 1. Oktober 2001 Ich bin raus aus Azkaban. Die Auroren haben mich in der Muggelwelt abgeladen wie Unrat. In Askaban war ich ein Gefangener, jetzt bin ich ein Ausgestoßener. Ich klage nicht, ich verdiene es. Die Wohnung ist klein und muffig. Ich fühle mich wie gelähmt. Alles ist fremd. Der Geruch von altem Mensch dünstet aus den Tapeten, aus den Vorhängen und Polstern. Alles ist altmodisch und verstaubt. Ich lebe in den Hinterlassenschaften einer Muggel wie Unkraut an einem Ort, an dem es nichts zu zerstören gibt. Ich spüre meine Magie stärker als je zuvor. Sie strahlt hell vor dem toten Hintergrund der Muggelwelt. Sie drängt nach draußen, aber das Zaubern ist mir verboten. So bleibt sie eine Wunde, an der ich nicht kratzen darf. Etwas, das mich daran erinnert, was mal war und worauf ich reduziert wurde. Mir ist kalt. Es gibt keinen Kamin und ich weiß nicht, wie Muggel Wärme in ihren Häusern erzeugen. Ich weiß aber, was elektrisches Licht ist – und Strom. Muggelkunde in Askaban, Unterrichtseinheit Nummer 4. Daher weiß ich auch, dass in dieser Wohnung kein Strom fließt. Ich müsste Fletcher um Hilfe bitten, aber ich kann das Ministerium ohne Magie, ohne Eule und Flohnetzwerk nicht erreichen. Ich frage mich erneut, warum mein Betreuer heute Morgen nicht mitgekommen ist, aber eigentlich kenne ich die Antwort. Und dann kommt Potter. Schlägt wie ein Troll gegen die Wohnungstür und verlangt Einlass. Der Junge-der-überlebte wohnt im gleichen Haus, direkt nebenan, und betreibt ein Café im Erdgeschoss. Ich bin nicht überrascht. Potter besaß schon immer die Gabe, genau dann zu erscheinen, wenn es mir am schlechtesten ging – oder ich mich am unrühmlichsten verhalten habe. Ich denke an den Verbotenen Wald, an die verwaiste Jungentoilette, den Astronomieturm und an das Manor. Es ist nicht schwer, sich daran zu erinnern, jeder Augenblick steht mir klar vor Augen. Aber ich darf diese Erinnerungen nicht hochkommenlassen, denn das bringt nur noch Weitere an die Oberfläche. Greybacks schmutzige Hände auf meiner Haut, Mutters leises Wimmern, Vaters verzweifelte Tränen, Bathilda Bagshots flehendes Bitten, Rowles und Dolohows Schreie. Die Liste ist unendlich. Ich schreibe sie im Kopf, Tag und Nacht. Nichts ist mir geblieben. Familie, Freunde, Geld, Magie, Achtung, alles dahin. Sogar die Selbstachtung, aber nicht mein Stolz. Potter soll nie erfahren, wie tief ich gesunken bin. Er soll das Loch nicht sehen, in dem ich leben muss. Eher gehe ich in der Muggelwelt zugrunde, als dass ich ihn über mich lachen lasse.
7 notes
·
View notes
Text
Hippokratischer Eid - Menschenwürde!!! So nicht!!!
Meldung: Es gibt da eine Arztpraxis: Monvia Hochdorf, Brauiplatz 4, 6280 Hochdorf: Die behandeln dort Patienten wie den letzten Dreck!!! Vor allem gibt es da einen Arzt, der die Würde von Patienten massiv untergräbt: Esmaeil Hadavi, siehe dazu diesen Link: https://www.monvia.ch/standorte/hochdorf/. Ein Freund hatte bei ihm einen Termin. Dieser Herr kam schon mal eine halbe Stunde zu spät, hatte nicht den Mumm sich zu entschuldigen, was ihm schon mal ganz schlecht zu Gesicht stand und meinen Freund sehr störte! Dann hörte er ihm nie zu, sah ihm nicht einmal ins Gesicht, starrte immer nur auf den Computer, das sind alles auch Begebenheiten, die bei ihm ganz schlecht rüberkommen. Irgendwann nach einer gewissen Zeit sagte er ihm er sollte hochdeutsch sprechen, wahrscheinlich bekam er 90% von dem, was er ihm sagte, gar nicht mit, ein ganz gewichtiger Störfaktor! Dann nahm er sich die Dreistigkeit raus ihm zu sagen der Zucker wäre falsch eingestellt und stellte seine ganze Lebensweise in Frage!!! Er kam schon seit ca. 2 Jahren in diese Praxis, hatte dabei mit schon verschiedenen Ärzten zu tun, die Diesen so einstellten und ihm jedesmal beschieden, dass er gut eingestellt wäre. Abgesehen von Phasen, in denen der Langzeitzucker etwas erhöht war, war er immer gut eingestellt. Bei den letzten zwei Malen bei Frau Doktor Karbassi, war er immer gut eingestellt, so beschied sie es ihm. Dann kam dieser Arzt und behauptete, dass er falsch eingestellt wäre, woher nimmt er diese Dreistigkeit??? Ausserdem kann man von einem Lanzeitzuckerwert von 8.2 mmol/l, wenn der Idealwert bei 7.5 mmol/l oder tiefer ist, nicht davon sprechen, dass der Zucker falsch eingestellt ist. Ausserdem machte er eine Diät, die finanzierte sich leider aber nicht über die KK. Er hatte seit kurzem einen Job, betreute die Corona-Hotline bei Medgate, so konnte er es sich leisten, hatte auch schon Produkte in Deutschland bestellt, machte Herrn Doktor Hadavi darauf aufmerksam, Dieser hörte aber auch nicht zu, erwähnte, er konnte nicht verstehen warum die KK keine Diäten finanziert. Er ernährte sich auch sonst verantwortungsvoll, die Zuckerwerte können auch zu hoch sein, weil z.B. es psychosomatische Gründe oder ein Einschlafproblem dafür gibt, hatte er bei früherer Gelegenheit mit anderen Ärzten schon thematisiert, die pflichteten ihm bei. Herr Doktor Hadavi interessierte das alles nicht. Genauso interesselos und unbeachtet, wie er ihn empfing, liess er ihn auch stehen! Seine Anliegen wurden komplett überhört, das betrachtete er zurecht als eine Arroganz und Selbstgefälligkeit, die gerade ein Arzt sich überhaupt nicht erlauben kann! Das schlug sich auch darin nieder, dass er ihm, obwohl er ihm klar mitteilte, dass er nicht einschlafen konnte und ein Schlafmittel benötigte, Dieses ihm erst verweigerte. Dann auf Drängen seinerseits gab er es ihm mit, zeigt auch fehlendes Sensorium gegenüber einem Patienten. Er fühlte sich am Schluss zwischen Stuhl und Bank abgefertigt, sowie im McDonalds’, in keinster Weise ernstgenommen, obwohl er mit einem Problem kam, dass man ernstnehmen musste, definitiv! Wegen nichts kam er nicht! Danach wurde noch ein PCR-Test veranlasst, eine gewisse Frau Lydia Grüter nahm ihn vor, sie verlangte, dass er sich flach hinlegen müsste, obwohl das wegen dem Schwindel nicht geht, er musste vehement darauf einwirken, dass man im Sitzen den Test vornahm, was ja dann wunderbar klappte. So ein Test wurde übrigens etwa 3 Wochen vorher schon in einer Filiale in Inwil vorgenommen, damals musste er sich auch hinlegen, ihm wurde schwindlig und schlecht, musste erbrechen. Danach konnte man den Test im Sitzen genauso problemlos erledigen. Das müsste ja aus seinen Patientenakten hervorgehen. Das hätte auch Herr Hadavi sehen müssen und dass dieser Test negativ war. Er erklärte ihm auch klipp und klar, dass dieser Hustenreiz schon vor Ausbruch von Corona bestand, aber das interessierte ihn genausowenig wie alles andere, was er sagte. Ein absolutes Armutszeugnis für einen Arzt! Ärzte legen ja den Hippokratischen Eid ab und sind sonst an gewisse Standesregeln gebunden. Dieser erwähnte Arzt verstiess praktisch gegen alles, was der Hippokratische Eid und die Standesregeln umfasst und dazu auch noch gegen die Menschenwürde, guten Ruf des Patienten und sein Recht auf unabhängige, fachliche Beurteilung, die wohlwollend ausfallen muss!🧟🕵👁🗣👮👹👽
0 notes
Text
The Regrettes melden sich auf "I Love Us" mit neuem Sound zurück

The Regrettes haben den neuen Track „I Love Us” veröffentlicht, zugleich der Beginn eines aufregenden neuen Kapitels für die Power-Pop-Formation aus L.A. Der Synthie-geprägte Track markiert den bisher größten musikalischen Entwicklungssprung der Band um Frontfrau Lydia Night und gibt mit seiner frischen klanglichen Neuausrichtung einen ersten Ausblick auf das, was vom kommenden Album zu erwarten ist, an dem The Regrettes derzeit arbeiten. „I Love Us“ feierte just sein Debüt in der letzten Staffel der Hit-Serie 13 Reasons Why, die jetzt bei Netflix verfügbar ist. Die Veröffentlichung des Tracks wird von einem hinreißenden Animationsvideo begleitet. Frontfrau Lydia Night erklärt: „’I Love Us’ verkörpert für mich große Veränderung und Wachstum für The Regrettes. Dieser Song zeigt die Art von Risiken und Genresprünge, die ich mit unserem dritten Album zu unternehmen hoffe. Als ich den Song schrieb, entschied ich offiziell, mich von jeglichen vorgefassten Ideen freizumachen, wie ein von mir geschriebener Song zu klingen hat. Ich nahm mir vor, endlich nicht mehr zu versuchen, in einer bestimmten Schublade zu verharren oder mich an ein bequemes Genre zu halten und mir einfach zu gestatten, Spaß zu haben und mich nicht damit zu stressen, ‚cool’ oder ‚Rock’ genug zu sein, haha. Read the full article
0 notes
Text
Verluste und Nebenwirkungen
Man sagt, es seien manchmal die kleinen Dinge im Leben, die unscheinbaren, unbemerkten Kleinigkeiten, die retroperspektiv die größte Liebe offenbaren, die man je erfuhr. Manchmal war es der Mut etwas auszusprechen, manchmal eine Handlung. Manchmal musste man nur den Blickwinkel ändern, aus einer distanzierten Perspektive alles neu betrachten.
Gedankenverloren starrte Lydia die Fotografie an, auf der, neben einer deutlich jüngeren Version ihrer selbst, ein von unzähligen Jahrzehnten gezeichneter Mann das Resultat der Erdbeerernte dem Fotografen präsentierte. Es war damals eine gute Ernte gewesen. Sie erinnerte sich an den Duft, der die Luft durchzog, und das Summen der Bienen, an den Stolz, der sie erfüllte, als sie ihren Eltern freudestrahlend einen Korb überreichte. Jeden Sommer hatte sie ihrem Großvater bei der Ernte geholfen und ihrer Großmutter beim Einkochen assistiert. Wehmut verstimmte Lydias Freude über die erinnerte Vergangenheit. Ihre Lippen formten sich zu einer weißen Linie und mit einer hastigen Bewegung legte sie die Fotografie zurück in den kleinen Schuhkarton, in dem weitere für die voranschreitende Zeit alte konservierte Erinnerungen ruhten. »Ich hätte dich nicht bitten sollen, mir zu helfen«, erklang Claires betrübte Stimme leise. »Nein, nein«, wisperte Lydia, schloss den kleinen Karton und stellte ihn zur Seite. »Es … irgendjemand muss dir helfen … allein … das … zu viel.« Die Worte fanden nur mühsam über ihre Lippen, und so manches wurde von der bedrückenden Stimmung verschluckt. Ein Lächeln versuchte sich auf Lydias Lippen zu formen, doch es wirkte eher seltsam verzerrt; jede Faser ihres Körpers schien sich dagegen zu wehren. Bleiern hing die darauffolgende Stille zwischen ihnen. Das Chaos, das, nachdem es begonnen hatte ihre Innersten zu verwüsten, das gesamte Haus nach und nach zu beherrschen begann, verbesserte die Stimmung nicht im Geringsten. Schweigend hatten sie unbewusst einen Pakt beschlossen, vereinbart nicht darüber zu reden, wusste eine jede von ihnen doch, dass Worte keine Besserung darstellten – nicht in solchen Zeiten. Claires Blick schweifte über die leeren Wände, die kahl und trostlos ohne die vielen Fotografien wirkten, die einst dort ihren Platz gefunden hatten. »Du weißt, es bedeutet mir …« — »… sehr viel, ich weiß«, beendete Lydia ihren begonnen Satz. Stumm fügte sie in Gedanken noch ‚ich bin für dich da, so wie du für mich da warst‘ hinzu. »Jake wird morgen auch kommen, oder?«, fragte Claire vorsichtig. Ehe sie die letzte Silbe ausgesprochen hatte, erklang ein scharfes »nein«. Lydia bereute im Nachhinein die harte vorschnelle Antwort und versuchte die Situation mit »Er hat viel zu tun. Die Arbeit … « zu beschwichtigen, wusste jedoch, wie wenig es nützte. Sie bedauerte mehr als jeder andere den Umstand, dass Jake ihr gerade in dieser Situation nicht beistand. »Er könnte doch wenigstens morgen eine Ausnahme machen! Wo doch morgen die … « Claire sprach die Worte nicht aus; vielleicht weil ihre Zunge nicht in der Lage war das bedrückende Wort auszusprechen oder sie in genau diesem Augenblick von viel zu vielen Emotionen überwältigt wurde. Mit »er hat einfach viel zu tun« versuchte Lydia das unangenehme Thema murmelnd zu beenden und warf einen Blick auf die tickende Uhr. 18:37 Uhr. »Verzeih, aber … ich sollte los.« Vorsichtig legte Claire die Arme um Lydia. Sie wirkte so zerbrechlich in letzter Zeit, dachte Lydia, als sie die sanften Gesichtszüge der Frau, die mit der Zeit einige Falten erhalten hatten, musterte. Kummer zeichnete sich in den Tiefen ihrer Augen ab. Schweigend umarmten sie sich.
Die Wohnung lag in Dunkelheit gehüllt da. Es überraschte Lydia seit einiger Zeit nicht mehr, dass, wenn sie nach Hause zurückkehrte, niemand auf sie wartete. Diese Zeit war vergangen. Und bald schon, so befürchtete sie, würden die Kartons, die sich im Flur stapelten, nicht mit dem alten Kram, sondern mit Jakes Eigentum gefüllt sein. Klirrend ließ sie die Schlüssel auf die Kommode fallen, schritt in die Küche, um sich eine Tasse von dem bereits seit Stunden abgekühlten Tee zu nehmen und pflanzte sich samt Decke auf die Couch. Während im Fernsehen eine alte Romanze lief, nippte Lydia an dem kalten Tee, verzog missmutig über seinen Zustand die Mimik und trank ihn nach und nach aus. Von der Handlung des Films nahm die junge Frau wenig wahr, war es doch auch nicht sonderlich wichtig, schließlich basierten alle Romanzen auf demselben Konzept – und am Ende lebten sie glücklich und zufrieden bis in alle Ewigkeit. Alles war gut. Aber das Leben war keine Romanze, es war keine hübsche Geschichte. Der Blick auf die roten Ziffern der Digitaluhr verdeutlichten Lydia, dass jegliches Warten, wie so oft, umsonst sein würde. Er würde nicht nach Hause kommen – nicht mehr heute. Anfangs betrübte es sie, doch mittlerweile empfand sie, ausgenommen dem ab und an aufkeimenden Zorn, nichts. Vor geraumer Zeit hatte ihr Innerstes unbemerkt damit begonnen eine schützende Mauer um sich zu bauen, keine starken Gefühlsregungen mehr durchdringen zu lassen. Vielleicht war es auch einfach nur ihr Weg mit all den Dingen klar zu kommen. Allmählich übermannte die Frau eine unangenehme, schwere Müdigkeit, und so schlief sie auf der Couch ein.
Das Leben, so sagte man, ging weiter. Jeden Tag stieg die Sonne empor, um sich am Abend wieder hinab zu begeben. Egal was auf dieser Welt passierte. Tag ein, Tag aus.
Stetig fielen die Tropfen hinab auf die schwarzen Schirme, prasselten leise auf die gespannten Stoffe und ließen jegliche Konturen der Umgebung in einem schemenhaften Nebel verschwinden. Langsam marschierte die schwarze Gesellschaft über die nassen Kieselwege, die mit Bäumen und Gruften gesäumten Alleen entlang. Der Zug versammelte sich schließlich. Worte durchdrangen gedämpft den Wolkenbruch. Nach und nach trat einer nach dem anderen aus der Traube hervor, blickte hinab, murmelte ein paar Worte und warf Erde nieder. Jeder sprach sein Beileid aus, und Claire stand da, versuchte Contenance zu wahren, während sie innerlich starb. Lydia verspürte das Bedürfnis, die Frau in den Arm zu nehmen, kam diesem jedoch nicht nach, stattdessen stand sie regungslos da. Ihr Blick schweifte von der Gemeinschaft in die verregnete Umgebung. In der Ferne nahm die junge Frau zwei dunkle Gestalten wahr, die langsam auf die Gesellschaft zukamen. Während niemand anderes diese wahrzunehmen schien, entschuldigte sich Lydia knapp, trennte sich von der Gemeinschaft und kam jenen Personen entgegen. Ihre Intuition hatte sich nicht geirrt; Benjamin Satchmore und Gabriel Buccho bahnten sich durch den Regen einen Weg zu ihr. »Mein Beileid, Lyd«, begann Ben, als die beiden schließlich vor ihr zum Stehen kamen. »Das mit deinem Dad …« Bevor Ben jedoch fortfahren konnte, verzog sich schmerzlich seine Mimik und er schluckte lieber die Worte hinab. Es war nicht der Augenblick für große Reden. »Wir haben was ganz Heißes«, säuselte Buccho. »Was Heißes?«, misstrauisch beäugte die junge Frau die beiden vor ihr stehenden Männer. »Gab[riel] konnte einen Vogel finden, der will ein Treffen. Könnte singen …«, die letzten Worte waren so leise gemurmelt, dass sie fast schon im Regen untergingen. Lydias Blick glitt von Benjamin zu Gabriel und wieder zurück. Für einen Augenblick glaubte sie, die beiden nahmen sie auf den Arm, doch ihre ernsten Blicke sprachen Bände. Sie meinten es ernst. Todernst. Geistesabwesend nickte sie den beiden zu. »Wann?« – »In einer Stunde.« Das war die Chance, auf die die drei Journalisten schon lange gewartet hatten; ein Treffen mit einem Maulwurf. Die grellrot leuchtenden Ziffern der Digitaluhr hatten sich in die Netzhaut gebrannt. Seit einer geraumen Zeit starrte die junge Frau abwesend die Zahlen an, so als könnte sie dadurch die Entwicklung der noch geschehenen Ereignisse vereiteln, da jene kleinen Striche es aufgrund des Blickes nicht wagten sich zu wandeln und die Zeit folglich nicht fortschreiten konnte. Vielleicht innervierte sie auch die Hoffnung auf Erhaltung von Antworten auf unausgesprochenen Fragen oder die bloße Tatsache, dass der jungen Frau, nachdem sie bereits den gesamten vergangenen Tag, der sich schon lange der Nacht hingegeben hat, ohne Pause auf die Word-Datei gestarrt und sich gescheite Texte aus den Finger zu saugen suchte, keine glorreiche Idee mehr in den Sinn kam. Das Interview mit dem Polizeipräsidenten war verschriftlich, doch fehlte es an dem gewissen Etwas, diesem Zusatz, der es einhüllte und somit aus dem faden Text einen beachtenswerten formte. Lydia hing in den vergangenen Tagen gehäuft ihren Gedanken nach, verschwand regelrecht in ferne Orte. Benjamin Satchmore, ein Arbeitskollege und Freund, blickte sie jeden Morgen, wenn die junge Frau zur Arbeit erschien, mit einer großen Sorge an, wusste er doch um die Situation. Zwar hatte er keinen Moment ungeschehen gelassen, sie auf andere Gedanken zu bringen oder ihr ein wenig der Arbeit – soweit es ihm möglich war – abzunehmen, doch er wusste, dass es nichts half. Das Leben war gnadenlos, ebenso wie das Geschäft. Ihr Chef, Sean Miller, bat die junge Frau in den letzten Tagen mehr als einmal zum Gespräch. Sie wusste, dass Miller von ihr enttäuscht war, schien sie in letzter Zeit doch all das verloren zu haben, was er immer an ihr zu schätzen wusste. Seine Unzufriedenheit färbte ihr Gemüt und sorgte dafür, dass sie sich nicht nur mit den privaten Sorgen, sondern auch mit den beruflichen konfrontiert sah. Ihr war durchaus bewusst, dass der Journalismus ein hartes Pflaster war. Wer überleben oder gar schwarze Zahlen in diesem Geschäft schreiben wollte, musste provozieren, zerreißen, auffallen. Menschen interessierten sich nicht mehr für die gerettete Katze von Nachbar John Smith, nein, sie wollten Skandale, Schlagzeilen. Objektives informieren war nicht einmal mehr ansatzweise in Betracht zu ziehen. Spekulationen waren an der Tagesordnung. Genaue Recherchen brauchten ihre Zeit, Zeit, die in dieser Branche viel Geld wert war und somit so rar wie Wasser in der Atacamawüste, in der, so sagt man, seit Jahrhunderten kein Tropfen Regen gefallen war. Lydia hatte einmal daran geglaubt. Sie hatte an den, in ihren Augen, ‚guten, richtigen‘ Journalismus geglaubt. Derjenige, der so objektiv wie möglich versucht die Menschen zu informieren ohne die Masse zu beeinflussen. Sie hatte daran geglaubt, etwas Gutes tun zu können; diese Welt auf ihre Weise verbessern zu können. Doch in genau diesem Augenblick, in dem sie die grellleuchtenden Ziffern anstarrt, hat sie diesen Glauben verloren. Jeden Tag kam sie in dieses Büro, setzte sich auf ihren Platz, stellte den frischaufgebrühten Pfefferminztee zur Rechten und das Notizbuch zur Linken. Jeden Tag fuhren ihre Finger über die Tasten, geschwind als ergieße sich ihr Innerstes in den Texten, als gäbe es da etwas, was hinausfließt, in die Artikel hinein. Mit Elan und Tatendrang war sie zu Presseterminen geeilt, hatte Interviews geführt und sich erfüllt gefühlt. Aber nun war alles verflogen. Es war als seien die bunten Farben entwichen und nur noch eine fade Leere hinterlassen, die sie im spärlich beleuchteten Büro umgab. Bereits vor Stunden waren die letzten Kollegen gegangen, nur sie ist geblieben; der Artikel wartete schließlich noch.
Leise und gleichmäßig erklang das Piepsen. Es war viel zu früh am Morgen, vielleicht zwei oder drei Uhr. Statt nach Hause zurückzukehren, hatte es die junge Frau in den weißen, sterilen Raum gezogen. Ihre Hand umschloss die viel zu kalt wirkende Hand ihres Vaters, strich sanft über den Handrücken, während Worte aus ihrem Mund quollen. Lydia wusste nicht, ob jene den im Koma liegenden Mann erreichten, doch hielt diese Unsicherheit sie nicht auf. Jede Nacht, seitdem er in diesem Raum lag, besuchte sie ihn, berichtete ihn von den Geschehnissen, den Erlebnisse des Tages. Nach anfänglichen Problemen, duldete das Krankenhauspersonal mittlerweile diese Besuche zu so ungewöhnlicher Zeit. Es war vor allem Claires Engagement geschuldet, dass niemanden die junge Frau verscheuchte. Seit vielen Jahren arbeitete sie bereits im Krankenhaus; eben dort begegneten sich vor vielen Jahren die Krankenschwester und Lydias Vater das erste Mal. Lydia war damals ungünstig gestürzt, hatte sich den Kopf aufgeschlagen und kam nicht ums Krankenhaus herum. Claire hatte Dienst, das Mädchen verarztet und gleichzeitig Bekanntschaft mit dessen Vater gemacht, der sie später zu Dates einlud bis Claire letztendlich ein Teil der Familie wurde. Auch wenn Claire die Mutterrolle nicht auszufüllen vermochte, versuchte sie Lydia eine gute Freundin zu sein, und eben diese wurde sie auch. Anfänglich hatte das Mädchen die Frau argwöhnisch beäugt, doch mit der Zeit begann sie zu verstehen, dass Claire ihrem Vater gut tat. Letztendlich war sie froh, dass sie einander gefunden hatten, umso schlimmer empfand die junge Frau das Geschehene und die infolgedessen eingetretene Situation. Zwar hatte man ihr versichert, es gäbe eine Chance, ihr Vater würde wieder erwachen, doch war diese so gering, dass es unmöglich war. Die Ärzte wussten es. Sie wusste es. Zu oft hatte sie sich schon mit schlimmen Unfällen und ihren Folgen auseinandersetzen müssen. Bevor sie spröde Politiker interviewen durfte, war es genau ihr Bereich: Unfälle, Straftaten … all das Übel der Stadt. Nachdem jedoch heraus kam, dass Lydia auf eigene Faust recherchierte und von dem ‚normalen‘ Weg abwich, musste Miller sich fügen und sie in einen anderen Bereich versetzen. Und nun befasste sie sich mit dem für sie wohl langweiligsten Bereich, den es auf dieser Welt zu geben schien: Politik. Unzählige Richtlinien, die offiziell gar nicht existierten, machten ihr das Leben schwer. Es durfte nur auf diese und jene Weise berichtet werden, aber auch nur über dieses und jenes. Tja, so war das Leben. Irgendwann übermannte die Müdigkeit die junge Frau und sie schlief neben ihrem Vater ein. Jeden Morgen schaute Claire vor der Arbeit vorbei. Meist ließ sie die Schlafende in Ruhe, legte ihr eine Decke über die Schultern und stellte einen warmen Kaffee hin. Doch an diesem Morgen, es war bereits acht Uhr durch, wurde Lydia geweckt, denn die Arbeit rief.
Es war einer dieser Tage, an dem sich Lydia lieber auf eine einsame Insel zurückgezogen hätte als den Alltag zu ertragen. Bitter war ihr jedoch bewusst, dass es weder einen Ort gab, an dem sie sich verstecken konnte, noch einen Sinn ergab, sich überhaupt zu verstecken. Sich vor dem Leben zu verstecken, alles zu verdrängen, machte es nur noch schlimmer, ergo zwang sie sich mechanisch zu funktionieren. Einfach funktionieren. Nachdem sie den halben Tag damit verbracht hatte, im Rathaus zu sitzen und den Politikern, die nicht einmal mehr ihren eigenen Worten Glauben schenkten, bei ihren endlosen, ins Nichts führenden Diskussionen zuzuhören, saß sie nun vor dem PC und versuchte, jene Zusammenkunft zusammenzufassen und über die wichtigsten Debattenpunkte und ihre damit einhergehenden Folgen für die Bevölkerung zu schreiben. Ebenda, Lydia war einem Wortschwall verfallen, ihre Finger rasten über die Tastatur und das wilde Klicken erklang, betrat ein Mann mittleren Alters das Großraumbüro, schritt bedächtig durch die Gänge hin zu Millers Büro. Mit einem leisen Klicken fiel die Tür ins Schloss. Leises Getuschel entflammte an den Arbeitsplätzen. Eine Augenbraue in die Höhe gezogen wandte sich Lydia neugierig vom Bildschirm und blickte, als hätte sie gewusst, dass er dort stand, Ben an. Er hatte die Hand zum Gruß gehoben, lächelte verschmitzt. „Hey, hey. Fleißig?“ Die junge Frau legte ein Alltagslächeln auf die Lippen, das sie schon so oft geübt hatte, dass sie hoffte, niemand würde es als gekünstelt empfinden. Einfach ein wenig die Mundwinkel hochschieben, nicht zu sehr, sonst glich es dem verrückten Joker. Etwas den Kopf schief legen, dann würde Ben schon nicht merken, wie übel es wirklich um sie stand. „Immer doch“, erwiderte sie ein wenig zu beflügelt. Satchmores Augen wandelten sich für einen kurzen Augenblick zu zwei kleine misstrauische Schlitze, denen etwas Vorwurfsvolles inne wohnte, doch je kehrte die Freundlichkeit zurück. Die Grübchen wurden tiefer und Ben begann, wie so oft, vom Erlebten des Tages zu sprechen – wie scheußlich eingebildet der Pitcher der Chicago Cubs sei, den er erst vor wenigen Stunden zum Finale der National League interviewt hatte; wie unterschätzt manch einer der Cubs sei – allen voran natürlich sein alter Schulfreund Steve Mewrence. Lydia besaß kein großes Wissen über Baseball, weshalb sie die Zuhörerposition gern einnahm, auch weil sie so allgemein nicht sonderlich viel sagen musste. Ben wollte zu einer kleinen Anekdote über seinen alten Schulfreund Mewrence einleiten, als das Kaffeekränzen von Miller unterbrochen wurde. Mit einem etwas genervten Seufzer, schließlich wurden Lightwood und Satchmore nicht zum sich unterhalten bezahlt, und einer ausladenden Geste begann Miller seine scheinbar seit einigen Minuten eingeübte kleine Rede: „Lightwood, Satchmore“, begann er, wedelte in Richtung des Unbekannten, der Miller gefolgt war, „das ist Gabriele Buccho. Sie Drei werden zusammenarbeiten.“ Instinktiv blickten Ben und die jungen Frau einander fragend an, dann den Fremden. Mittleres Alter, etwas zu wohl genährt, rundes Gesicht, glupschäugig. Seine Bräune war unnatürlich fleckig, vielleicht hatte er versucht seine eigentlich vorhandene Blässe durch Selbstbräuner zu verdecken, was, wie zu erkennen, eher stümperhaft gelang. Der Anzug, den Buccho trug, war mindestens zwei Größen zu groß oder der Mann, der in ihm steckte, einfach zu klein und zu breit. „Finden Sie etwas Gutes. Etwas Atemberaubendes. Eine Story, die das Potential hat, alle bisher dagewesenen zu übertrumpfen.“ Mister Miller war ein eigentümlicher Mann, der hart für seine Durchsetzungskraft kämpfte, obgleich sie ihm so fern lag wie einem Reiskorn Steine zu bewegen. Er konnte sehr wütend werden, wahrlich, und auch sehr einschüchternd, doch gab es da immer etwas, das einem bewusst machte, er könne doch nicht so schlimm sein. Irgendetwas an ihm nahm einem die Angst, die er versuchte, in einen zu pflanzen, sollten seinen Worten nicht Folge geleistet werden. Bald schon sollte den beiden Freunden, Lightwood und Satchmore, gewahr werden, dass die Sensationsgeilheit ihres Chefs von ihrem neuen Kumpanen Buccho um Welten übertroffen wurde. Aber davon war bei ihrer ersten Begegnung nicht einmal zu erahnen. Nein, der kleine Mann stand mit einem unscheinbaren, freundlichen Lächeln auf den Lippen da, beäugt seine neuen Kollegen und schien in seinem Kopf schon jeden erdenklichen Plan zu schmieden, um DIE Story zu bekommen, die ihn reich machte.
Und eben dieser Mann namens Gabriele Buccho, der liebend gern über ‚la bella vita‘ zu quasseln pflegte – es stellte sich heraus, er kam ursprünglich aus Mailand, lebte für einige Jahre in Venedig und war schließlich im Jugendalter ins schöne Amerika ausgewandert, um etwas aus sich zu machen; Mama und Papa stolz zu machen -, hielt Lydia jetzt, zwei Wochen nach ihrem ersten Zusammentreffen, die Tür auf. Mit einem Seufzer stieg sie aus dem schwarzen SUV; etwas Unauffälligeres, so hatte Satchmore versichert, hatten sie auf die Schnelle nicht auftreiben können.Die Steine knirschten unter ihren Schuhen, als sie über den Kies schritten. »Ihr wisst, was wir abgesprochen haben«, wisperte Buccho leise. Satchmore atmete hörbar aus. Ihm schien die ganze Sache ebenso ungeheuerlich wie Lightwood, die mittlerweile hinter den beiden Männern schritt. Sie waren hier. Ein Umkehren kam nicht mehr in Frage, zu sehr hingen sie an ihrem Job. Findet eine wahnsinnige Titelstory, hat Miller gesagt und leise hinzugefügt, sollten sie sie nicht finden, so brauchten sie nicht mehr zurückzukommen. Überraschenderweise besaß Gab anscheinend die Ruhe selbst, während Satchmore sichtlich angespannt war. Immer wieder hatte er auf der Fahrt mit den Fingern nervös geknackt, derweil Buccho den fantastischen Plan, den sich sein Köpfchen zusammengereimt hatte, erläuterte. Denn, so stellte sich heraus, sie würden sich nicht direkt mit einem Vögelchen treffen. Die Sache war komplizierter. Immens komplizierter. Einige hundert Meter von einem See entfernt blieb die kleine Gruppe stehen. Während sich Ben unruhig umblickte, deutete Gabriele auf das Ufer jenes Gewässers. »Du wirst ihn finden.« Doch Lydia packte Unbehagen. Würde sie den Mittelsmann wirklich finden? Zwar war der Park gut besucht; Familien und Paare tummelten sich unter Regenschirmen; Hunde spielten hie und da auf den Wiesen; doch niemand schien die gesuchte Person zu sein. Ein beunruhigter Blick streifte den kleinen Mann, doch er ließ keine Zweifel aufkommen, nein, er wirkte, als würde alles klappen. Er war derjenige, der sich so sicher mit der Sache war, hatte er schließlich alles bis hierhin eingefädelt. »Ok«, presste die junge Frau zwischen den Lippen hervor und machte sich auf den Weg zum Ufer. Ruhig lag die Flüssigkeit im Bett, beherbergte Schilfpflanzen und Seerosen, die leuchtend ihre Blütenkelche dem Regen entgegenstreckten. Mittlerweile hatte sich der Regen zu einem andauernden Nieselregeln entwickelt. Fröstelnd zog Lydia den Parker enger um ihren Körper. Sie kam sich wie ein triefnasser Hund vor, den man irgendwo abgesetzt und warten ließ, weil man ihn schon vor Stunden vergessen hatte. Aus den Augenwinkeln nahm sie ein Bündel wahr. Es lag auf der Bank. Bei näherer Betrachtung stellte es sich jedoch als einen Menschen heraus, der dort schlief. Ein Obdachloser, der sich unter Stoffen vergraben, vor dem Regen schützte. Aus unerfindlichen Gründen zog es die junge Frau zu jenem. Mit bedachten Schritten näherte sie sich der Bank. Ruckartig setzte sich der verwahrloste Mann auf. Seine Augen blickten verschlafen auf den See. Der Bart war, ebenso wie die Haare, vollkommen verknotet. Schlussfolgernd muss dieser Mann schon länger obdachlos gewesen sein. Als seine verträumten Augen auf die junge Frau fielen, formte sich ein Lächeln auf seiner Mimik. Misstrauisch blieb Lydia auf Abstand. Wild begann der Obdachlose in seinen Stoffbündeln zu wühlen. Schließlich zog er einen dicken, braunen Umschlag zu Tage. Wortlos hielt er ihr jenen hin, deutete ihr, sie solle ihn nehmen. Zögerlich griff die junge Frau nach dem Umschlag. Der Drang wegzulaufen packte sie. Doch dann fiel ihr der Umschlag, den Buccho ihr übergeben hatte, ein, den sie dem Mann zum Tausch reichte. Begierig griff er danach, öffnete jenen mit leuchtenden Augen. Unzählige Rubelscheine kamen zum Vorschein. Zufrieden verstaute der Mann sein Tauschgut und legte sich wieder hin, als sei nichts geschehen. Lydia blickte einen Moment verwirrt auf den Mann, fasste sich jedoch wieder, schob ihren neuerworbenen Umschlag in die Parker-Tasche und machte sich auf den Rückweg. Schweigend schlossen Gabriele und Ben auf.
Erst als sie im schwarzen SUV saßen, verlangte der kleine glubschäugige Buccho nach dem Umschlag. Ebenso begierig wie der Obdachlose griff er nach jenem, riss ihn mit den Fingern auf. Zum Vorschein kamen Papiere. Pässe, Flugtickets, Hotelreservierungen. Ein Zischen drang von Satchmores Platz. Breitgrinsend begutachtete Buccho seinen Gewinn. »Das ist unser Weg.« Euphorisch wedelte er mit den Papieren, derweil die junge Frau nur ungläubig schaute. »Woher hast du den Kram, Gab?« Sorge lag in Benjamins Stimme. »War nicht ganz einfach, sì, ganz und gar nicht, aber so kommen wir an unser Ziel«, giggelte Buccho. »Woher?«, zischte Satchmore mit zusammengekniffenen Augen. »Ganz ruhig«, beschwichtigend hob der immer noch giggelnde Mann die Hände, »Ein Freund eines Freundes hat einen Bekannten, der jemand kennt, der hat das übernommen.« — »Für’s Protokoll: Wenn wir alle drauf gehen … es ist seine Schuld!« Ben hatte sich an Lydia gewandt und deutete auf Gabriele. Die junge Frau hatte ruhig auf der Rückbank gesessen und die beiden beäugt. Uneins, ob diese ganze Aktion wirklich den Preis wert war, schwieg sie zu dem Ganzen. Sie konnte Ben verstehen, dass er sich sorgte, aber gleichzeitig hatte Buccho recht: so würden sie an ihr Ziel kommen, und das blieb eine Wahnsinnsstory, die man nun einmal nicht auf dem Bürgersteig der Stadt finden konnte. »Und jetzt?«, fragte schließlich Lydia, als die beiden Männer ihre Diskussion beendet hatten. »Jetzt«, begann Gabriele und konnte sein Grinsen nicht verstecken. »Packen wir unsere Koffer und fliegen morgen früh nach Detroit.« »Was zum Henker sollen wir in Detroit?« Ben begann wieder mit seiner Fragerei, doch Gabriele ignorierte den ihn inzwischen nervenden Satchmore. »Don Montenardo wurde ermordet. Ohne Capo gleicht die dort ansässige Mafia einem Haufen Anarchie. Nun kämpfen sie wieder um die Herrschaft mit allen und sich selbst.« Die junge Frau nickte und murmelte: »Erst gestern las ich einen Artikel. Die Situation wird immer heißer. Die Zeitungen sind nur noch von Mordnachrichten gepflastert.« »Und genau deshalb«, fuhr Buccho zufrieden fort, »deshalb machen wir mit. Wir lassen alles auffliegen.« — »Du willst dich reinschleichen? IN DIE MAFIA?! Hast du sie noch alle?«, Satchmore entglitt der Gesichtsausdruck, als er die volle Bedeutung Bucchos Worte begriff. Gelassen zuckte der ältere Mann die Schultern: »Bei dem Chaos schaut niemand so genau hin … da kann schon mal ein Verwandter von dem man nur vage eine Ahnung hat zu Hilfe eilen.« »Und der Hacken?« Lydias Frage riss die beiden Männer aus ihrem Blickduell. »Der … Hacken …« Gabrieles Blick glitt aus dem Fenster. »Ja, der verfickte Hacken«, murrte Benjamin. Er wusste, dass Lydia ein gutes Gespür für hinter dem Berg gehaltenes hatte. »Sprich oder ich …« Benjamin ballte die Faust und wedelte bedrohlich damit vor dem unbeeindruckten Gabriele. »Wir müssen nur einem Freund ein paar Berichte zukommen lassen.« Langsam zog die Frau auf dem Rücksitz eine Augenbraue hoch. »Einem Freund?« Nun doch etwas verlegen werdend kicherte Buccho und zupfte am Umschlag. »Popow.« Satchmores Kopf schlug auf das gelederte Lenkrad, derweil die Frau auf dem Rücksitz zurücksackte, die Augen schloss und sich auf die Wange biss. »Eine andere Möglichkeit blieb nicht«, wisperte Buccho kleinlaut. »Sie wissen, wie man so etwas macht… Menschen einschleusen …« — »Nicht genug, dass wir uns in die italienische Mafia reinschleichen, mal abgesehen von den Folgen, wenn wir auffliegen … nein! Du musst uns auch noch an die russische Mafia verkaufen.« — »Also verkaufen ist nun wirklich das falsche Wort …«, begann Buccho, wurde aber je durch Bens wütenden Blick unterbrochen. Der ältere Mann schluckte. Vielleicht hatte er bis dato die Konsequenzen verdrängt oder wirklich kein Gewissen. Was es auch immer war, sie konnten die Situation nicht ändern. »Berichte also?«, fragte Lydia leise von der Rückbank. »Ja, sie sind an der Situation interessiert, weil …« — »… weil die italienische Mafia sich gerade zerfleischt und sie aufgrund dessen womöglich dort endlich die Herrschaft erringen können, die sie in Chicago nie bekamen«, beendete die junge Frau den Satz des Mannes, der daraufhin nickte. »Und da hast du denen einfach so uns …«, Ben war so wütend und eingeschüchtert von der Situation, dass er nicht einmal mehr die richtigen Worte fand, um auszudrücken, was er sagen wollte. »Nein, ich bin doch nicht dumm!«, platzte es aus Gabriele. »Ich habe dafür gesorgt, dass sie nur andere Identitäten kennen.« — »Also schleichen wir uns in die eine Mafia rein, während wir bereits in der Anderen eingeschlichen haben … was?« — »So ist es. Ferne Verwandte, die sich dafür bereit erklärt haben, Informanten zu spielen und sich bei denen reinschleichen.« Satchmore raufte sich die Haare, während Lydia die ganze Situation zu verstehen versuchte. »Gott, ich hoffe, du weißt, was wir da tun«, brummte Satchmore. Die junge Frau schnaubte: »Wenigstens sind’s nicht die Chicago Outfits.« Buccho schmunzelte, Satchmore bekam nur ein gequältes Lächeln zustande. Kleiner Trost. »Wir können nicht mehr zurück. Wir sind so gut wie tot«, jammerte Ben wie ein kleiner Junge. Er hatte den Drang Buccho zu schlagen. Verdammt, brachte er doch alle in so große Gefahr; nicht nur sie, sondern auch ihre Familien, Freunde, Verwandten. Es gab unzählige Horrorgeschichten über Menschen, die es sich mit der Mafia verspielt hatten. Aber, so wusste Ben, Lydia hatte Recht. Detroit war weit weg. Die Chance unglimpflich davon zu kommen größer als in Chicago, wo sie lebten. Vielleicht hatten sie auch den kürzesten Stab gezogen und die Gruppierungen von Detroit und Chicagos standen sich näher als befürchtet. Dieses ganze Netz, kein Mensch wusste, wie umfangreich es war. Niemand wusste, wer mit wem gegen wem. Aber bald würden die drei kleinen Fische in den Ozean des Verbrechens hinabtauchen und einen Blick darauf erhaschen, flogen sie nicht frühzeitig auf. Womöglich sollten sie sich schon einmal ein Grab aussuchen. »Also, morgen früh geht der Flug«, sprach Gabriele seelenruhig. »Wir treffen uns zum Abend dann mit einem Mann namens Apollo Cecco. Ein uns ‚Anverwandter‘. Soweit der Plan.«
Stück für Stück schob sich die Sonne am Horizont empor. Die vergangene Nacht war von Hektik und Stress geprägt; Koffer wurden gepackt und den Verwandten mit einer fungierten „Geschäftsreise“ die Sorgen genommen. Während Lydia ihre Nase in ein Italienisch-Wörterbuch steckte, summte Gab seelenruhig vor sich hin. Ben schien alle worst case-Szenarien im Kopf durchzugehen und hoffte klamm heimlich für einige Zeit, dass Flugzeug würde bedauerlicherweise sein Ziel nicht erreichen; selbst der Gedanke an einen möglichen Absturz stimmte ihn ruhiger als der ihm servierte Kirschkuchen, der eigentlich seine Leibspeise war.
Fortsetzung folgt. Niemals. — Л.
#owntext#text#writer#german#german writer#writer on tumblr#thriller#eigenes#journalist#trauer#schmerz#liebe#freunde#spannung#Beginn#written for a friend#story#old#verlust#risiko#furcht#einsamkeit
3 notes
·
View notes
Text
16. September 2015
Das analoge Büro
Wenn mir langweilig ist, gucke ich manchmal im Netz Videos über Kinder, die daran scheitern, ein Wählscheibentelefon oder eine Schreibmaschine zu bedienen. Die kennen das überhaupt nicht mehr! Dabei fiel mir letztens auf, dass ich selbst ein Kind des Computerzeitalters bin. Zumindest arbeitstechnisch. Bei meinem ersten Bürojob stand schon ein 286er PC auf meinem Schreibtisch. Schwarzer Bildschirmhintergrund, orangene Schrift. Ich hab tatsächlich noch ein Foto von 1994 gefunden.
Wie hat man eigentlich vorher gearbeitet – ohne Computer, Drucker, Telefonkonferenzen und vor allem ohne E-Mail? Wir im Osten hatten ja nicht mal Kopierer. (Aus gutem Grund, wie unsere Regierung fand.) Ich beschloss, meinen 75-jährigen Vater zu fragen. Er war früher im DDR-Außenministerium, in einer Botschaft und später in einer staatlichen Gesellschaft tätig. Im Interview bezieht er sich vor allem auf die Büroarbeit in den 70er Jahren.
Ziemlich schnell nahm das Interview eine überraschende Wendung, denn es entwickelte sich zu einer Lobeshymne auf eine vom Aussterben bedrohte Berufsgruppe.
Also Papa, wie lief das denn damals so ohne Computer?
Am meisten konnten einem die Sekretärinnen leidtun. Die mussten ja manchmal denselben Text zehnmal abtippen. Kaum hatten sie ihn fertig, schrieb jemand Anmerkungen rein oder strich etwas raus, und wenn es ein wichtiges Schreiben war, konnte man das ja nicht so weiterschicken. Also wurde es neu abgeschrieben.
Auch bei einem Schreibfehler musste in der Regel die ganze Seite noch mal abgetippt werden. Die Rechtschreibung und gewisse Normen, wie ein Schreiben aussehen musste, wurden damals fanatisch beachtet. Über jeden Fehler oder einen falschen Absatz oder Zeilenabstand wurde die Nase gerümpft. Das fiel auf den Absender zurück. Tipp-Ex ging vielleicht für interne Schreiben, aber ansonsten hieß es: noch mal abtippen.
Als ich Jahrzehnte später das erste Mal selbst am Computer saß, war das ungewohnt. Aber dann stellte ich fest, dass man Tippfehler sofort korrigieren kann. Was für eine Wohltat!
Es gab damals auch keine Kopierer, sondern nur Blaupapier und später dünnes Durchschlagpapier. Wichtigen Adressaten konnte man aber kein labberiges Durchschlagpapier schicken. Da wurde dann wieder der komplette Text mehrmals abgetippt. Wenn das ein Brief war von ein, zwei Seiten – ok. Aber es gab ja teilweise Reden und Vorträge von 30, 40 Seiten.
Vielleicht mal so zum Tagesablauf. Bei mir ist es immer so: Ich komme ins Büro, schalte den Computer ein und checke meine E-Mails. Also, die neuen, denn die ersten Mails des Tages lese ich meistens gleich nach – äh, eigentlich vor dem Aufstehen. Wie fing dein Tag damals an?
Als erstes habe ich mich an den Schreibtisch gesetzt und in die Zeitungen geguckt.
Zeitungen! Ach ja!
Also wenigstens zehn Minuten quergelesen, die Überschriften und den einen oder anderen Artikel. Man musste ja informiert sein. Dann begann die Arbeit, indem man Telefonate geführt hat zu anstehenden Vorhaben oder Problemen. Oder ich habe etwas ausgearbeitet, eine Vorlage zum Beispiel oder eine Analyse zu einer bestimmten Situation. Es wurde ja erst mal alles mit der Hand geschrieben. Als dann die Diktiergeräte aufkamen, konnte man auch auf Band diktieren.
Die Sekretärinnen hatten immer sehr viel zu tun. Sie waren meistens für 5-6 Mitarbeiter zuständig. Es wurde ja sehr viel geschrieben. Alles musste schriftlich festgehalten werden.
Die meisten Mitarbeiter in der Behörde konnten nicht mit der Schreibmaschine umgehen. Dann standen wir manchmal Schlange im Sekretariat. Und wenn der Chef etwas hatte, ging das natürlich vor und wurde zuerst abgetippt. Da musste man warten.
Dann gab es immer mindestens eine Kopie für die Ablage. Auch dafür war die Sekretärin verantwortlich. Sie kannte das Ablagesystem, sortierte, beschriftete und verwaltete alles. Alle Schreiben wurden in Akten verwahrt, nach soundso viel Jahren gingen sie in eine Art Zwischenablage, nach Ablauf einer bestimmten Frist dann endgültig ins Archiv. Wenn dann irgendeine Frage oder ein Problem auftauchte, wusste die Sekretärin: „Ach, das war vor 2 Jahren und das Protokoll liegt da und da.“
Das klingt alles sehr ordentlich. Heute auf dem Computer muss man ja nicht mal eine Ordnerstruktur haben. Man könnte theoretisch alles auf einem Haufen speichern und dann über die Suche des Computers finden. (Also, als Mac User.) Das heißt ja, die Sekretärin war sozusagen Ordnerstruktur und Suchmaschine in einem?
Ja, es war damals lebenswichtig, eine Ordnung zu haben. Die Sekretärin nahm dadurch eine Schlüsselstellung ein. Alles, was in der Institution passierte, ging über ihren Tisch. Wirklich alles. Sie kannte den gesamten Schriftverkehr, wusste, wo was abgelegt war, verwaltete die Adressbücher und Terminkalender. Sie war die bestinformierte Person im Haus. Übrigens – nur mal am Rande – war das einer der Gründe, warum während des Kalten Krieges die Sekretärinnen oft von den Geheimdiensten anvisiert wurden. Sie wussten eben alles – viel mehr als der einzelne Mitarbeiter.
Das war doch aber generell ein Risikofaktor. Was passierte, wenn die Sekretärin krank war oder kündigte?
Wenn sie krank war, lief nichts mehr. Gar nichts. Vielleicht gab es einen pfiffigen Mitarbeiter, der es selbst versucht hat an der Schreibmaschine. Aber wenn der einmal daneben gehauen hat, musste er eben wieder von vorn anfangen. Die Masse konnte das nicht.
Jemand, der Schreibmaschine schreiben konnte, hatte also einen wichtigen und wertvollen Beruf. An einen Computer kannst du heute jeden dransetzen, der kein Vollidiot ist. Die Sekretärinnen konnten enorm schnell schreiben und blind. Das mussten sie auch, denn wenn sie eine gewisse Geschwindigkeit nicht schafften, stapelte sich alles bei ihnen. Die Stars unter ihnen konnten sich neben dem Tippen sogar noch unterhalten.
Außerdem beherrschten sie Stenografie – eine Kurzschrift, mit der sie Sitzungen und Konferenzen protokollieren konnten. Das gibt es heute kaum noch, außer im Bundestag oder bei Gericht.
Eine gute Sekretärin war damals Gold wert. Sie wurde behandelt wie ein rohes Ei und man passte auf, dass sie nicht wegging.
Das war auch ein ganz harter Job, weil sich immer alles auf sie konzentrierte. Sie war dadurch nicht nur psychisch, sondern auch physisch stark belastet. Die Schreibmaschinentastatur war ja früher viel schwerer anzuschlagen als heute ein Computer. Durch das viele Tippen hatten sie oft Beschwerden. Sehnenscheidenentzündungen waren eine Art Berufskrankheit. Wenn man das 35, 40 Jahre lang gemacht hat…
Heute hat jeder seinen Computer und schreibt selbst, auch der Chef. Das konnte damals keiner der Mitarbeiter. Es war nicht üblich und teilweise unter ihrer Würde. Insofern war man total abhängig von der Sekretärin. Das Wohl und Gedeihen einer Firma hing von der Sekretärin ab. Sie war Herrin über alle Termine, hat das Kalendarium geführt und auch die Leute erinnert: „Sie haben heute um 14 Uhr den Termin bei XY.“
Sie war also auch die Kalender-Software.
Ja. Und die Telefonzentrale. Denn auch die Telefonate liefen über die Sekretärin. Sie wusste, wer wann am besten über welche Nummer zu erreichen war. Sie hatte das Telefonbuch. Man konnte nicht einfach mal schnell irgendwo anrufen. Die Telefonnetze waren veraltet und überlastet. Es war sehr schwer durchzukommen und man musste x-mal von vorne wählen, damals ja noch mit der Wählscheibe. Ohne Wiederholungstaste oder Speicher. Außerdem hatten viele Leute zu Hause kein Telefon und haben also auch ihre Privatgespräche vom Büro aus geführt. Und wenn besetzt war, war besetzt.
Stimmt, es gab ja keine Anklopfen-Funktion. Und man konnte ja auch nicht sehen, wer angerufen hatte. Von Anrufbeantwortern ganz zu schweigen …
Die Sekretärin hat manchmal unheimlich viel Zeit gebraucht, um eine Telefonverbindung herzustellen. Gerade auch ins Ausland. Oft war schon nach der Landesvorwahl besetzt, dann fing man wieder von vorne an. Und wenn du Pech hattest, waren da plötzlich noch zwei andere in der Telefonleitung, die dazwischen gequatscht haben.
Haha, das kenne ich auch noch! War sehr lustig manchmal.
Aber im Ernst: Aus heutiger Sicht klingt Eure Arbeitsweise ein bisschen nach einer Horrorvision. Wie diese bürokratische Riesenmaschine bei George Orwell …
Das Schlimmste war, dass eben alles über Schriftverkehr oder Telefon abgewickelt werden musste. Beides war langsam und belastend. Man schickte zum Beispiel jemandem per Post ein Konzept. Meistens war ein Brief 2-3 Tage unterwegs. Dann hast du ewig versucht, denjenigen ans Telefon zu kriegen: „Ist mein Brief schon angekommen?“ „Nein, aber ich guck mal in der Poststelle.“ So lief das nur.
Diese Verlangsamung der Arbeitsprozesse hat uns ganz schön genervt. Das war alles total ineffektiv! Wir kannten es nicht anders, aber es war uns trotzdem bewusst. Den Durchbruch brachten erst die Büroelektronik und natürlich das Internet. Heute drückst du auf den Knopf und schickst binnen Sekunden eine Mail nach Saudi Arabien oder Australien. Vielleicht bekommst du sogar in ein paar Minuten schon die Antwort!
Also war das Arbeiten damals schwerer?
Ich würde schon sagen, man war körperlich belasteter. Heute kannst Du zu Hause im Sessel fläzen und Mails auf dem Smartphone checken. Damals war viel mehr physische Präsenz gefragt. Es gab nicht diesen lässigen Arbeitsstil wie heute. Und der Arbeitsaufwand war so enorm, etwas fertigzustellen – das hat viel Kraft gekostet. Heute arbeitet man mit mehr Leichtigkeit und Effektivität.
Dein Wort in Gottes Ohr. Danke, Papa, für das interessante Gespräch.
(Lydia, zuerst veröffentlicht unter bueronymus.wordpress.com/2015/09/16/das-analoge-buero/, dort auch mit Fotos)
#Lydia#Bueronymus#Arbeitswelt#Schreibmaschine#Post#Sekretärin#Telefon#Auslandsgespräch#Stenografie#Adressbuch#Terminkalender#Ablagesystem#Zeitung#Blaupapier#Durchschlagpapier#Tipp-Ex#submission#Diktiergerät
9 notes
·
View notes
Photo





Eger Panorama der Innenstadt und Marktplatz Original Egerländer Musikanten In der traditionellen Volksmusik-Szene gilt Ernst Mosch als König der Blasmusik. Mosch war zwar nicht der erste, der die Egerländer Musik in der Welt berühmt machte. Eger ist eine in der Karlsbader Region liegende Stadt im äußersten Westen Tschechiens. Die Stadt liegt am Fluss Eger im nördlich und südwestlich an Deutschland grenzenden Egerland, dessen historisches Zentrum die Stadt bildet, etwa 42 km westsüdwestlich von Karlsbad. Am 3. März 1919, einen Tag bevor am 4. März 1919 anlässlich der in Österreich stattfindenden Wahlen gegen die Zugehörigkeit zur Tschechoslowakei demonstriert wurde, kam es in Eger zu einem Volksaufstand und einer Schießerei mit zwei Toten. Am 1. Oktober 1933 gründete Konrad Henlein in Eger die Sudetendeutsche Heimatfront mit dem Ziel der „Zusammenfassung aller Deutschen“ in der Tschechoslowakischen Republik, die Partei musste sich 1935 in Sudentendeutsche Partei umbenennen und wurde bei den Parlamentswahlen im gleichen Jahr zur stärksten Gruppierung im Grenzgebiet. Durch das am 30. September 1938 unterzeichnete Münchner Abkommen wurde Eger mit dem Sudetenland dem Deutschen Reich zugesprochen und einen Tag nach der Unterzeichnung am 1. Oktober 1938 von deutschen Truppen besetzt. Am 3. Oktober besuchte Adolf Hitler die nunmehr deutsche Stadt und wurde dort von der Bevölkerung begeistert empfangen. Ernst Mosch (* 7. November 1925 in Zwodau, Tschechoslowakei; † 15. Mai 1999 in Germaringen) war ein deutscher Musiker, Komponist, Arrangeur und Dirigent. Er war Gründer und musikalischer Leiter der Original Egerländer Musikanten. In der traditionellen Volksmusik-Szene gilt er als König der Blasmusik. Mosch war zwar nicht der erste, der die Egerländer Musik in der Welt berühmt machte, er ist jedoch wohl der Erfolgreichste. Am 15. Mai 1999 starb Ernst Mosch in Germaringen. Er hatte über 1000 Konzerte gespielt, in 42 Ländern mehr als 40 Millionen Tonträger verkauft und sechs Goldene und Platin-Schallplatten gewonnen. Ernst Mosch war es immer verwehrt, in seiner Heimat, dem Egerland, mit den Egerländer Musikanten zu musizieren. Erst im Jahre 2010 gab das Orchester (nun unter der Leitung von Ernst Hutter) in Eger (tschechisch Cheb) sein erstes Konzert. „Seine größten Erfolge“ Moschs Schallplatte„Seine größten Erfolge“ zum 25-jährigen Bestehen hielt sich drei Monate auf Platz 1 der deutschen Charts. Er schob sich damit u. a. vor Phil Collins, Queen, ABBA, Iron Maiden, AC/DC und Pink Floyd. Das Jubiläum wurde am 2. Juni außerdem mit einer Floßfahrt auf der Isar gefeiert. Seit seiner Zeit als Musiker bei Erwin Lehn hatte Mosch keine Posaune mehr gespielt. Hier machte er zur Freude der Fans und seiner Musiker eine Ausnahme und jazzte „Oh when the saints go marching in“. Auf Vorschlag des Baden-Württembergischen Ministerpräsidenten Lothar Späth bekam Ernst Mosch für seine Verdienste um die Volksmusik das Verdienstkreuz am Bande verliehen. Am 5. September 1981 wurde Mosch die Hermann-Löns-Medaille in Gold verliehen, die als höchste Auszeichnung für die Verdienste um die Volksmusik gilt. Ende September desselben Jahres begann die große Jubiläums-Tournee durch ganz Deutschland. Im Alter von acht Jahren spielte Ernst in dem damals bekannten Falkenauer Jugendblasorchester der privaten Jugendmusikschule von Hans Dotzauer Flügelhorn. Bei seiner Rückkehr nach Falkenau lernte er die "landverschickte", aus Herne stammende Lydia kennen, die er 1945 zur Frau nahm. Aus der Ehe entstammen die Töchter Karin, Ellen und Brigitte. Infolge der Vertreibung der Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg floh Mosch im gleichen Jahr nach Bayern und verdiente sein Geld in amerikanischen Clubs mit Jazz. 1946 spielte er Posaune in der Band von Peter Hiller und Tenorhorn in der Original Kapelle Egerland unter Leitung von Rudi Kugler. Kurz darauf gründete Mosch zusammen mit Fred Bertelmann und Horst Reipsch eine eigene Kapelle, die sie REMO-Band nannten. 1951 suchte Erwin Lehn einen 1. Posaunisten, und Mosch erhielt die Stelle nach erfolgreichem Vorspiel. Mit dem Orchester Erwin Lehn spielt Mosch pro Jahr 10 feste Veranstaltungen für den Süddeutschen Rundfunk sowie zusätzliche Konzerte in ganz Europa (darunter: Monte Carlo, Brüssel, Venedig, Amsterdam und Paris). Erwin Lehn (* 8. Juni 1919 in Grünstadt, Pfalz; † 20. März 2010 in Stuttgart) war ein deutscher Musiker und Orchesterleiter. Am 1. April 1951 gründete er das Südfunk-Tanzorchester des Süddeutschen Rundfunks (SDR) in Stuttgart, das er bis 1992 leitete. Es entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit von einer Rundfunk-Kapelle zu einer modernen swingenden Big Band: Erwin Lehn und sein Südfunk-Tanzorchester. Neben der Band von Kurt Edelhagen beim Südwestfunk wurde das Südfunk-Tanzorchester in den folgenden Jahren zu einer der führenden Swing-Big-Bands in der Bundesrepublik Deutschland. Zahlreiche Gastauftritte bekannter Jazzmusiker der 1950er und 1960er Jahre zeugen von der Anerkennung, die der Orchesterleiter in der Fachwelt genoss. Einige seiner Mitglieder gründeten später eigene Orchester, u. a. Horst Jankowski, Peter Herbolzheimer, Klaus Weiss und Ernst Mosch. Auf dem Bundespresseball 1955 in Bad Neuenahr spielte das Tanzorchester Erwin Lehn. Da diese Bälle extrem lange dauerten, entlasteten sich die Musiker gegenseitig, indem sie abwechselnd in kleineren Besetzungen, unter anderem auch einer Blaskapelle, spielten. Die Blaskapellenbesetzung wurde dann von Ernst Mosch geleitet, der zu dieser Zeit stellvertretender Orchesterchef war. In dieser Besetzung waren schon seine späteren Weggefährten Franz Bummerl und Gerald Weinkopf vertreten. Die Blasmusik-Besetzung war ein großer Erfolg auf dem Ball, da sie eine Abwechslung zum normalen Programm darstellte. Ernst Mosch organisierte daraufhin ein Orchester mit fester Blasmusikbesetzung. 1956 nahmen die 12 Blasmusiker 5 Titel beim Südfunk in Stuttgart auf, welche am 21. April 1956 ausgestrahlt wurden. Dazu gehörten unter anderem die Fuchsgraben-Polka und der Walzer Rauschende Birken. Bei der Namenssuche einigte man sich auf Die Egerländer Musikanten, da die meisten der Musiker aus Böhmen stammten. Bereits im Dezember des gleichen Jahres schloss Mosch einen Vertrag mit der Plattenfirma Telefunken für weitere Aufnahmen. Die Besetzung wurde auf 18 Musiker erweitert. Mosch, der davor noch selbst Tenorhorn spielte, setzte seine Prioritäten von nun an auf das Dirigieren und den Gesang. Im Jahr 1986 formierte er in Gedenken an seine Zeit bei Erwin Lehn aus den Original Egerländer Musikanten eine Big Band. Zur gleichen Zeit fanden zum 30. Jubiläum 30 Konzerte in Deutschland und den Niederlanden statt. Dabei trat Helga Reichel erstmals live mit auf. 1988 nahm er mit den Bläsern der Prager Philharmonie und des Prager Staatstheaters, sowie seinen vier ersten Flügelhornisten Franz Bummerl, Freek Mestrini, Ferenc Aszodi und Lubomir Rezanina eine Produktion mit 16 Polkas und Walzern auf. 1990 folgte ein Tonträger mit dem Rundfunk-Blasorchester Leipzig und dem Egerländer Flügelhorn- und Tenorhornsatz. Bei der Tournee zum 35-jährigen Bestehen 1991 spielte Mosch zum ersten Mal in den Neuen Ländern. Im selben Jahr widmete ihm das ZDF eine Sondersendung mit dem Titel „Mein größtes Fest der Blasmusik“. 1995 wurden Ernst Mosch und die Original Egerländer Musikanten aus Anlass ihres 40. Jubiläums von Marianne und Michael zu deren Sendung „Lustige Musikanten“ nach Frankenmuth bei Detroit eingeladen. Nach der Rückkehr erkrankte Ernst Mosch, sodass die Herbsttournee aufs Frühjahr verschoben werden musste. Diese fand dann vom 16. März bis zum 28. April 1996 statt und umfasst 30 Konzerte in Deutschland, Österreich und Südtirol. Das bei dieser Tournee aufspielende Orchester war zahlenmäßig die stärkste je live aufgetretene Besetzung der Original Egerländer Musikanten. Trotz schlechten Gesundheitszustands entschloss sich Mosch 1998 dazu, ein letztes Mal auf Tour zu gehen. Vom 6. März bis zum 27. April 1998 waren Ernst Mosch und seine Original Egerländer Musikanten auf ihrer Abschiedstournee durch ganz Deutschland ein letztes Mal live zu sehen. Der Klang bei der Tournee 1998 gilt nach allgemeiner Überzeugung als der ausgefeilteste und technisch beste Live-Mosch-Sound aller je durchgeführten Tourneen.
0 notes
Text
Lydia, die aus Thyatira in Kleinasien stammte, lebte als „Purpurkrämerin“ in Philippi im Norden Griechenlands. Sie hatte sich hier offenbar als selbstständig tätige Händlerin niedergelassen und war durch ihren einträglichen Beruf zu Ansehen und Wohlstand gelangt. Sie ließ sich vom Apostel Paulus taufen und soll nicht nur die erste Christin in der Stadt, sondern auch die erste Christin auf europäischen Boden gewesen sein (bisher hatte das Christentum nur in Vorderasien Fuß gefasst). Als „Apostelschülerin“ unterstützte sie die Ausbreitung des Christentums und wurde, da sie vermögend war, eine „Mäzenin“ der christlichen Glaubensverkünder. Als dann Paulus und seine Begleiter gefangen genommen und schließlich als „Friedensstörer“ aus der Stadt gewiesen wurden, nahm sie die Männer ungeachtet der eigenen Gefährdung gastfreundlich in ihrem Haus auf. Historisches: Die Tätigkeit der Frauen im frühen Christentum beschränkte sich nicht nur darauf, herumziehende Glaubensboten zu beherbergen und zu versorgen. Sie versammelten oft die Gläubigen in ihren Häusern, leiteten nicht selten den Gottesdienst, der freilich noch keine festen Formen aufwies, wirkten sogar als Vorsteherinnen der Gemeinden, nahmen sich der Bedürftigen an und waren oft selbst missionarisch tätig. Mehrere von ihnen wurden von Paulus ausdrücklich als Mitarbeiterinnen bezeichnet und in seinen Grußlisten namentlich hervorgehoben Land Europa Griechenland Besonderheiten Biblische Gestalt
0 notes
Text
Auszeit
Hallo ihr Lieben,
über das Wochenende waren wir 4 Volis - endlich vereint - mal wieder in Swakopmund. Als wir losfuhren, wussten wir noch nicht, was wir machen werden. Das Einzige, was wir wussten: wir übernachten bei Linus - einem Deutschen Work & Traveller, den wir kennen - beziehungsweise bei Joyce. Joyce ist in Namibia aufgewachsen, lebte in Südafrika und in vielen anderen Ländern, in denen sie die Kultur erlebte, aber auch Kriege miterlebte. Sie selbst bezeichnet sich als Reisende, ist momentan Schriftsteller und das auch ziemlich gut! Ich werde euch mal einen Link reingeben über sie.
Angekommen in ihrem Haus standen allerlei Bücher, was vor allem die Deutschlehrerinnen und -lehrer hier interessieren dürfte (; Von Reiseführern über leichte Lektüre bis hin zu Poesie von Pablo Neruda (über den Joyce und ich später noch ins Gespräch kamen, u.a. wegen Chile). Linus erklärte uns, dass dieser riesige Teil Bücher nur rund 1/10 ihrer Bücher ist. Der Rest steht in ihrer Bibliothek in Südafrika.
Auf jeden Fall lernten wir, was "Leute kennen" heißt! Wir kannten Linus. Linus kannte Joyce, wo wir schliefen. Linus kannte aber auch Michail, einen in Swakopmund lebenden sehr netten Menschen, der uns mit auf sein Segelboot nahm für zwei Tage. Wir sahen allerhand Robben, Flamingos, ein Wrack, einen Leuchtturm und die Atlantikbucht bei Walvis Bay. Wir lernten auch einiges über Segeln (durften auch lenken, aber der Wind war echt stark), Kaya und ich fuhren Kajak, die Anderen aßen selbstgesammelte Muscheln und letztendlich schliefen wir auf dem Boot. Am nächsten Tag kam dann mit Leon und Leonie der kalte Sprung ins Unbekannte - in den wirklich eiskalten Atlantik. Wir schwommen so schnell wie die Weltmeister von der einen Seite des Bootes auf die andere Seite, wo wir uns aufs Boot retteten. Michail lachte uns etwas aus (irgendwie verständlich) und wir lachten zusammen und zogen uns rasch um. Wieder zurück an Land bedankten wir uns und schliefen erstmal eine Runde.
Am Abend gingen wir zu einem 20. Geburtstag - auch wieder durch Bekannte von Linus. Dort waren auch ziemlich viele andere Volis, die wir kennenlernten, aber auch Einheimische.
Am Sonntag ging es dann mit Kai, einem Freund aus Omaruru, der zufällig auch übers Wochenende in Swakop war, zurück nach Omaruru.
So viel zu Swakop also. Jedes Mal erleben wir etwas Neues dort und das lustige ist, dass wir nie wissen, was kommt beziehungsweise haben wir nie einen Plan.
Bis bald,
Lydia
0 notes
Link
Im ds-Podcast Startup-Insider liefern OMR-Podcast-Legende Sven Schmidt und ds-Chefredakteur Alexander Hüsing einmal in der Woche spannende Insider-Infos aus der deutschen Startup-Szene. In jeder Ausgabe gibt es exklusive Neuigkeiten, die bisher zuvor nirgendwo zu lesen oder hören waren. Zu guter Letzt kommentiert das dynamische Duo der deutschen Startup-Szene in jeder Ausgabe offen, schonungslos und ungefiltert die wichtigsten Startup- und Digital-News aus Deutschland. Pro Ausgabe erreicht der Startup-Insider-Podcast derzeit über alle Plattformen hinweg mehr als 6.500 Hörer. Hier die die neuste Ausgabe. Startup-Insider #41– Unsere Themen Insight investiert in Staffbase #EXKLUSIV +++ Der amerikanische Kapitalgeber Insight Venture Partners investiert in Staffbase. Das Chemnitzer Startup entwickelt eine Plattform, mit der Unternehmen ohne großen Aufwand eigene Mitarbeiter-Apps für den internen Gebrauch erstellen können. Über diese können die Nutzer etwa Nachrichten verschicken oder Schulungsvideos abrufen. e.ventures, Kizoo Technology Capital und Capnamic Ventures investierten bereits rund 10 Millionen Euro in die Jungfirma, die 2014 gegründet wurde – siehe auch: “Staffbase: Grandioses Wachstum und kaum Verluste“. Insider-Infos zum Ausstieg von Otto bei e.ventures #EXKLUSIV +++ Wie bereits berichtet, ist der Handelsriese Otto still und leise bei einem Fonds des Berliner Kapitalgebers e.ventures ausgestiegen. Konkret verkaufte die Otto-Gruppe, die das Geld brauchte, um ihre Bilanzen aufzuhübschen, 51 % des zweiten e.ventures-Fonds an den kalifornischen Risikokapitalgeber Industry Ventures. Wie aus dem Umfeld des Kapitalgebers zu hören ist, legte der zweite Fonds bisher eine grandiose Performance hin und spielte schon das viereinhalbfache des eingesetzten Kapitals ein. Cavalry Ventures legt neuen Fonds auf #EXKLUSIV +++ Der junge Berliner Kapitalgeber Cavalry Ventures legt einen zweiten Fonds auf. Zielgröße sind 75 Millionen Euro. Im ersten Fonds waren 20 Millionen Euro. Mit dem neuen Fonds steigt Cavalry Ventures nun in den Kreis der mittelgroßen Kapitalgeber auf. In den vergangenen Jahren investierte das Cavalry-Team rund um Rouven Dresselhaus und Stefan Walter in Startups wie caroobi, Freighthub, HeavenHR, McMakler und medbelle. Investments aus dem neuen Fonds sollen ab den dritten Quartal folgen. Der schöne Schein bei Farmako +++ Das “manager magazin” nahm gerade das junge Cannabis-Startup von Sebastian Diemer, genannt “DerDiemer” auseinander. Laut dem Wirtschaftsblatt sei “fast nichts so, wie es scheint” bei Farrmako. Der von Diemer anvisierte Millionenumsatz sei schon logistisch kaum zu realisieren, da die dafür benötigten Mengen Cannabis gar nicht lieferbar seien, heißt es im Bericht. Auch Farrmako-Mitgründer Farrmako Niklas Kouparanis kommt im Artikel nicht gut weg. Lydia Benkö ist zurück #EXKLUSIV +++ Die ehemalige Corporate Finance Partners-Macherin Lydia Benkö, die zuletzt das Europageschäft von Digital Capital Advisors verantwortete, meldet sich zurück. Gemeinsam mit Mario Zimmermann, Mitgründer von brands4friends, schob sie gerade LZW Capital. Die Neugründung positioniert sich als “fully independent M&A advisory firm”. In der Selbstbeschreibung heißt es: “Our truly entrepreneurial background in combination with years of experience both in the M&A sector and in fast growing companies sets us apart from the market and allows us to offer distinguished services to our valued clients”. Was Philipp Lahm falsch macht! +++ Wie viele andere aktive und ehemalige Sportler investiert auch Weltmeister und FC Bayern-Legende Philipp Lahm seit einigen Jahren in Startups, Grownups und Co. Doch statt direkt in Unternehmen zu investieren wäre es für Lahm und Co. aber sinnvoller, um überhaupt mal ein Gefühl für den Markt zu bekommen, etwa in Fonds zu investieren. Bei Folgerunden wäre es dann auch möglich etwa direkt in einzelne Startups zu investieren. Startup-Insider #41– Unser Podcast der Woche Abonnieren: Die Podcasts von deutsche-startups.de könnt ihr ganz leicht bei SoundCloud abonnieren und abspielen. Ansonsten bei Spotify und iTunes zuhören. Anregungen bitte an [email protected]. Hier entlang zu unserem anonymen Briefkasten. Foto (oben): Shutterstock
0 notes
Text
Feind in der Fremde
Kapitel 11
vorheriges Kapitel / Kapitel 1
Zurück auf Null?
Nach Dracos Panikattacke am Samstagmorgen traf sich Harry nachmittags mit Ron und Hermine in der Diagon Alley, um ein Geschenk für Dean zu besorgen, der abends in seinen Geburtstag reinfeiern wollte. Sonst übernahm Hermine diese Aufgabe, aber dieses Mal hatte sie sich geweigert und nun versuchten die drei, zusammen ein passendes Geschenk zu finden. Am Ende einigten sie sich auf eine magische Armbanduhr mit einer Art eingebautem Erinnermich für Termine, da Dean notorisch zu spät kam und deshalb schon Ärger mit seinen Uni-Professoren hatte.
Harry war die meiste Zeit teilnahmslos hinter seinen Freunden hergelaufen. Seine Gedanken kreisten noch immer um die Geschehnisse vom Morgen. Er konnte sich nicht von dem Bild befreien, wie Draco mit diesem panischen Ausdruck im Gesicht auf dem Boden des Supermarktes kauerte und nach Luft rang. Keine zwei Wochen zuvor hatte Harry Draco im Fieberwahn erlebt und auch das war schrecklich gewesen, aber nun hatte er seinen einstigen Schulfeind besser kennen gelernt, war ihm nahegekommen, so dass ihm dessen Panikattacke auf schmerzhafte Weise berührte.
Vom Leaky Cauldron aus apparierten die drei Freunde in den Fuchsbau. Bill, Fleur, Percy und George mit seiner Freundin Jasmine waren ebenfalls da. Harry ließ das laute Treiben an sich vorbeiziehen. Es drängte ihn in die Parkway zurück.
„Bleibst du zum Essen, Harry?“ Mollys Stimme erklang aus der Küche, aber Harry nahm sie gar nicht wahr.
„Harry, Mum hat dich gefragt, ob du zum Essen bleibst, oder musst du vorher noch im Café vorbei?“, durchbrach Ron Harrys Gedanken.
„Ja, ich muss noch ins Café“, log Harry. „Wann wollt ihr denn zur Party?“
„So gegen neun.“
„Gut, dann komme ich auch. Ich sollte dann jetzt auch mal besser los.“ Harry erhob sich.
Ron und Hermine warfen sich einen dieser speziellen Blicke zu, die Harry immer signalisierten, dass sie sich Gedanken um ihn machten. Da fragte Hermine auch schon: „Ist alles in Ordnung mit dir, Harry? Du wirkst schon den ganzen Tag so abwesend.“
„Ja, alles gut.“
„Hat Malfoy wieder was angestellt?“, hakte Ron nach.
„Ne, wieso? Ich muss los. Wir sehen uns später.“
Harry war sich sicher, dass Draco nicht wollen würde, dass Harry seinen Freunden von der Panikattacke erzählte, erst recht nicht vor der versammelten Weasley-Familie. Aber irgendjemanden wollte er davon erzählen. Daher blieb er vor dem Kamin stehen und flohte Madam Purcell an, als er in der Parkway aus den Flammen trat.
„Gab es denn einen bestimmten Auslöser für die Panikattacke?“, fragte die Heilerin, nachdem Harry seinen Bericht beendet hatte.
„Ich bin mir nicht sicher. Da war ein Ständer mit Halloween-Kostümen und ein paar Jugendlichen haben dort Masken anprobiert. Vielleicht hat sich Draco erschreckt. Aber es ist ja nicht nur die Panikattacke, sondern sein ganzes Verhalten. Er hat Angst, das Haus zu verlassen und wirkt immer so verhalten und still. Nachts schläft er schlecht und hat Albträume und ich glaube, da war auch ein Vorfall mit Greyback. Ich habe das Gefühl, er hat nichts von dem verarbeitet, was damals geschehen ist.“
„Ich kann mir gut vorstellen, dass Draco traumatisiert ist und nie die Gelegenheit hatte, darüber zu sprechen“, stimmte Madam Purcell zu. „Es sollte mit einem Gedankenheiler reden, aber ich weiß nicht, ob er dazu bereit ist. In Reinblüterfamilien gelten psychische Probleme als Schmach.“
„Ich muss ihn halt überzeugen. Würde Michael wohl mit Draco reden?“ Mrs Purcells Stiefsohn war schließlich Psychologe und kam regelmäßig für seine Gruppenstunde ins Beans.
„Wenn Draco kein Problem damit hat, dass er ein Squib ist.“
Harry hätte die Frage gerne verneint. Tatsache war jedoch, dass er nicht wusste, ob Draco seine alten Vorurteile abgelegt hatte. Draco hatte sich seit seinem Einzug nie abfällig über Muggel, Muggelstämmige oder Squibs geäußert. Im Café hielt sich Draco von anderen Personen fern. Ob aus Unsicherheit, Desinteresse oder Abneigung konnte Harry nicht sagen. Eines stand für ihn aber fest: „Wenn er noch an seinen alten Vorurteilen festhält, ist er unserer Hilfe nicht wert.“
„Aber wer soll ihn eines Besseren belehrt haben – in Azkaban?“, gab Madam Purcell zu bedenken.
Harry hatte darauf keine Antwort. Er verabschiedete sich und setzte sich an seinen Schreibtisch, um Michael anzurufen. Das Gespräch erleichterte ihn. Der Psychologe war bereit, Draco kennen zu lernen. Nun musste Harry nur noch den eigentlich Betroffenen überzeugen. Mit einem Seufzen erhob er sich, stieg die Treppe zu Dracos Wohnung hoch und klingelte.
Der wirkte überrascht, als er die Tür öffnete und Harry davor erblickte. Harry hatte eigentlich nicht vorgehabt, vor Deans Party noch nach Hause zurückzukehren. Nun folgte er Draco ins Wohnzimmer. An der Couch angekommen, nahm Draco mit einer schnellen Geste ein ältliches Buch vom Sofa und schob es in den Stapel mit seinen Studienunterlagen. Verlegen strich er danach mit den Händen über die Sofalehne.
„Ist etwas?“, erkundigte sich Harry.
„Nein. Wieso?“
„Hast du schon gegessen?“
„Ja.“ Es klang eher wie eine Frage als eine Antwort.
„Was denn?“
Die Antwort kam zögernd: „Kartoffeln.“
„Kartoffeln? Mit was? Sind noch welche da?“ Harry hatte Hunger und es war immer ratsam vor Deans feuchtfröhlichen Partys etwas Festes im Magen zu haben.
„Nein“, antworte Draco. Harry sah, wie sein Blick für eine Sekunde zu einer leeren Chipstüte auf dem Wohnzimmertisch flog.
„Das war dein Abendbrot? Chips?“ Harry ließ sich auf Dracos Sofa fallen. „Du hast ein Problem, Draco.“
„Und das sitzt gerade auf meinem Sofa.“
„Sehr witzig. Ich meine das ernst.“ Harry wies mit der Hand auf den Sessel. „Setz dich.“
Draco zog die Augenbrauen hoch und bewegte sich nicht.
„Oh mein Gott, ich meinte: ‚Bitte setz dich, ich würde gerne etwas mit dir besprechen.‘“
Draco ließ sich tatsächlich auf Lydias Fernsehsessel nieder. Steif und mit gerunzelter Stirn wartete er auf das, was Harry ihm zu sagen hatte.
„Ich habe über deine Panikattacke nachgedacht und darüber, dass es dir auch sonst nicht so gut geht.“ Dracos Augenbrauen zogen sich verdächtig zusammen. „Ich hatte dir doch erzählt, dass ich nach dem Krieg mit einem Psychologen gesprochen habe, also einem Gedankenheiler. Und…naja…ich kenne einen, der dir helfen könnte. Er ist sogar auf Traumatherapie spezialisiert.“
Draco schaute auf den Boden, aber Harry konnte sehen, dass er die Lippen zusammenpresste.
„Du musst dir Hilfe suchen, Draco. Du traust dich nicht, das Haus zu verlassen.“ Als Draco den Mund öffnete, um zu widersprechen, ging Harry sofort dazwischen: „Nicht alleine, jedenfalls. Wie willst du dich selbst versorgen, einkaufen gehen?“
Draco schwieg.
„Ich kann dich nicht ewig begleiten. Und selbst als ich heute dabei war, hast du Panik bekommen.“
„Das war eine Ausnahme. Wegen Halloween… die Maske, sie hat mich an ‚ihn‘ erinnert.“
„Du brauchst Hilfe, Draco. Professionelle Hilfe.“
„Das wird nicht noch einmal passieren. Beim nächstes Mal bin ich darauf vorbereitet.“
„Das ist doch Quatsch, du belügst dich selber, wenn du das glaubst.“
Draco stand auf, das Gesicht gerötet. Harry sagte schnell: „Es ist doch keine Schande, wenn …“
Harsch wurde er von Draco unterbrochen: „Sag du mir nicht, was Schande ist. Du weißt doch gar nicht, was das ist. Du bist dein Leben lang bewundert worden.“
„Und trotzdem war es auch mir nicht zu peinlich, Hilfe bei einem Gedankenheiler zu suchen. Weil ich nicht klarkam.“
„Ich komme klar.“
Harry stand nun ebenfalls auf und meinte eindringlich. „Das tust du nicht! Ich möchte dir helfen, Draco.“
„Ich bin aber nicht dein kleines Hilfs-Projekt, Potter. Hat Granger auf dich abgefärbt? Reichen euch die Hauselfen nicht mehr? Muss es jetzt eine Hilfsorganisation für Todesser sein? Komm, wir machen eine Selbsthilfegruppe auf für die armen Todesser-Sprösslinge des Landes. Du kannst mich mal.“
„Dein Spott ändert nichts an der Tatsache, dass du Hilfe brauchst.“
„Sicher nicht deine.“
„Anscheinend doch. Heute Morgen noch, bei deiner Panikattacke. Du hast nach mir gerufen. Und überhaupt, du warst es, der wollte, dass ich mit dir einkaufen gehe.“
„Das war offenbar ein Fehler, wenn du meinst, dich deshalb in mein Leben einmischen zu können. Geh jetzt bitte. Ich habe sowieso nie verstanden, warum du ständig hier bist.“
„Weil ich mir Sorgen machen!“
„Eher, weil ich dir leidtue. Raus jetzt, Potter!“
Harry bewegte sich nicht. „Ja, du tust mir leid. Alles tut mir leid. Das mit dem Sectumsempra, dass ich damals tatenlos zugesehen habe, wie du in dein Unglück rennst. Dass dein Vater den Kuss bekommen hat und deine Mutter in Azkaban gestorben ist. Ich will nicht denselben Fehler noch einmal machen.“
„Welchen Fehler? Was hast du mit alldem zu tun?“
„Ich habe weggeguckt.“
„Dann geht hier es also um dich? Damit dein schlechtes Gewissen beruhigt ist?“
„Nein! Es geht um dich. Weil du eben nicht mehr ‚Malfoy‘ bist. Du bist ‚Draco‘. Ich habe dich kennengelernt. Ich will dir helfen, weil ich finde, dass du Hilfe verdient hast.“
„Du irrst dich.“ Draco stellte sich neben die offene Wohnzimmertür und schaute Harry auffordernd an: „Ich möchte, dass du meine Wohnung verlässt und dich aus meinem Leben raushältst.“
Harry ging an ihm vorbei in Richtung Hausflur. An der Tür drehte er sich noch einmal um. Dracos Gesicht war eine eisige Maske. Egal, was Harry gesagt hätte, er wäre nicht zum ihm durchgedrungen.
Mit einem frustrierten Laut drehte er sich um und knallte die Tür hinter sich zu.
***
Harry flohte direkt zu Deans Party. Es war noch kein anderer Gast da, aber das störte Harry nicht, er würde dann eben bei den letzten Vorbereitungen helfen. Zunächst machte er sich aber eine Bierflasche auf. Harry musste sich beschäftigen. In seinen Adern kochten die Nachwirkungen seines Streits mit Draco. Bevor die Party ihren Höhepunkt erreichte, hatte er bereits fünf Bier und drei Kurze intus. Gegen Mitternacht war er so hinüber, dass ihm die sorgenvollen Blicke von Hermine bereits egal waren.
In Deans Wohnzimmer war ein Stück Boden für eine Tanzfläche freigeräumt worden und Harry gab sich den Beats hin, auch wenn er mit Lou Bega, S Club 7 oder DJ Otzi wenig anfangen konnte. Womit er aber schon etwas anfangen konnte, war die junge Hexe, die ihn antanzte und ihm herausfordernde Blicke zuwarf. Harry hatte sie schon zuvor bemerkt. Ihre Haare hatten den fast weißen Ton der Malfoys und Lovegoods. Sie war eine Cousine oder Freundin von Deans Mitbewohnerin Lindsey, hochgewachsen und in ihrer eckigen Schlankheit fast knabenhaft. Harry empfand sie als sehr attraktiv und ging ohne zu Zögern auf ihre Anmache ein.
Keine Stunde später fand er sich mit Helena – oder wie sie hieß – in Deans Schlafzimmer wieder. Ihre Zunge fuhr heiß in seinen Mund. Harry bekam nur am Rande mit, wie die Tür hinter ihnen zufiel und mit einem schnellen Spruch verschlossen wurde. Ihm war klar, dass die Frau nicht auf ihn als Person, sondern auf seine Berühmtheit abfuhr. Aller Wahrscheinlichkeit nach würde sie morgen zu ihren Freundinnen zurückkehren und mit ihrer Eroberung prahlen. Harry konnte nur hoffen, dass sie nicht auch noch zum Tagespropheten gehen würde. Das und seine Abneigung gegenüber bedeutungslosem Sex hatten ihn in der Vergangenheit fast immer davon abgehalten, sich auf Groupies einzulassen, egal ob Männer oder Frauen. Heute war sein Verstand allerdings benebelt und seine Laune gereizt. Außerdem war da eine Hitze ihn ihm, die sich seit zwei Wochen angestaut hatte. Als Helena seine Hose öffnete, durchfuhr ihn die Lust mit ungewohnter Heftigkeit. Gebannt stand er da und beobachtete, wie die Hexe vor ihm auf die Knie ging und sein Glied befreite. Er starrte auf ihren hellen Schopf. Automatisch fuhren seine Finger in die weichen Strähnen, die ihn so an … an niemanden erinnerten. Ihr Mund umschloss Harrys Eichel. Harry stöhnte auf und ließ sich willig auf das Gefühl in seiner Körpermitte reduzieren.
Als es vorbei war, bemühte er sich, auch ihr Befriedigung zu verschaffen. Er hatte nur wenige Male nach dem Krieg mit Ginny gehabt, bevor sie ihm ihre Gefühle für Neville gestanden hatte. Wenn er nicht so betrunken und entspannt gewesen wäre, hätte er sich wahrscheinlich für seine Ungeschicklichkeit geschämt. Zum Glück übernahm Helena selbstbewusst die Führung und dirigierte Harrys Hand. Nach wenigen Minuten hielt sie die Luft an und atmete dann langsam stöhnend aus. Harry rieb sie weiter mit dem Daumen, während er gleichzeitig ein Flattern an seinen Mittelfinger spürte, der tief in ihr vergraben war. Er war froh, nicht versagt zu haben und erleichtert, dass es vorbei war.
***
Die Woche verging, ohne dass Harry Draco sah oder von ihm hörte. Er hatte einen Stillezauber auf seine Wände gelegt, um auch ja nichts von seinem Nachbarn mitzubekommen – und umgekehrt. Seine Stimmung war durch Deans Party nicht besser geworden. Er hatte in den letzten zwei Wochen so viel Zeit mit Draco verbracht, dass ihre Funkstille nun eine unangenehme Leere hinterließ.
Es war lächerlich, wie schnell er sich an Draco gewöhnt hatte. Das zeigte nur, dass er mit dem Single-Leben noch nicht klarkam, was mit Sicherheit auch der Grund für seine untypische Eskapade auf Deans Party gewesen war. Wie Helena, so bot auch Draco eine angenehme Ablenkung vom Alleinsein. Er wollte nichts von Draco – natürlich nicht -, aber die ganzen gemeinsamen Mahlzeiten und der Kochunterricht hatten ein Gefühl von Nähe hervorgerufen und ihm Abwechslung verschafft. Oft hatten sie noch nach dem Abendessen zusammen abgehangen, Musik gehört oder Fernsehen geguckt.
Harry würde eben wieder öfter bei seinen Freunden vorbeischauen. Das war eh viel besser.
Dracos Abwesenheit im Café blieb nicht unbemerkt, ebenso wie Harrys schlechte Stimmung. Am Mittwoch fragte Jill: „Wo ist eigentlich Draco?“
„Keine Ahnung.“.
„Ist er wieder gesund?“
Harry zuckte mit den Schultern. „Ja.“
„Und?“
„Und was?“, gab er leicht genervt zurück.
„Triffst du ihn noch? Ihr hab doch immer zusammen gekocht.“
„Das ist vorbei.“
„Wieso?“
Harry legte den Block hin, auf dem er die Bestellung einer Anruferin notiert hatte. „Wir haben uns gestritten. Er will meine Hilfe nicht und ich soll ihn in Ruhe lassen.“
„Hm“, machte Jill. Harry kannte dieses ‚Hm‘. Es bedeutete, dass Jill mit der Antwort nicht zufrieden war.
„Er scheint zu meinen, ich würde ihn nur bemitleiden“, setzte er deswegen hinterher.
„Kommt er denn jetzt alleine zurecht?“
„Keine Ahnung. Ist mir auch egal.“
Jill war der Trotz in Harrys Stimme nicht entgangen. „Sicher?“
„Klar. Das war doch sowieso das Ziel, dasser uns in Ruhe lässt, am besten auszieht.“
„Hm.“
„Was?“
„Ich hatte den Eindruck, ihr versteht euch ganz gut.“
„Offenbar nicht.“
„Er sieht auch ganz süß aus.“
„Was hat das damit zu tun?“
„Du mochtest ihn, Harry. Bist du sauer, weil er deine Hilfe nicht will oder deine Gesellschaft?“
Harry riss den Zettel mit vom Block und griff in die Kühltheke ,um die Bagels für die Bestellung zusammen zu suchen. Er blieb Jill eine Antwort schuldig.
„Ihr könntet euch wieder vertragen.“
„Er hat keinen Bock auf mich.“ Warum klang seine Stimme so frustriert?
„Da wäre ich mir nicht so sicher.“
***
Harry erzählte Michael am Donnerstag nach der Gruppensitzung, dass Draco nicht mit einem Psychologen sprechen wolle. Sie tranken noch ein paar Bier zusammen und im Laufe des Abends hatte ihm Michael alles entlockt, was es zu Draco Malfoy zu sagen gab, von ihrer ersten Begegnung bei Madam Malkin bis hin zu ihrer letzten am Samstag fünf Tage zuvor. Michael wirkte sehr nachdenklich. Harry wusste, was der Ausdruck in seinem Gesicht zu bedeuten hatte.
„Was hast du vor?“, fragte er, aber der Ältere schüttelte nur den Kopf.
„Wir werden sehen.“
Am Freitagabend öffnete Harry gerade seine Wohnungstür, um sich auf den Weg ins Kino zu machen, als Draco ebenfalls in den Flur trat. Draco schaute schnell weg und Harry dachte erst, Draco würde tatsächlich so dreist sein und ihn ignorieren, da wanderte sein Blick wieder zu Harry zurück. Mit erhobenem Kinn in bester Malfoy-Manier grüßte er Harry mit einem kühlen „Guten Abend“.
„Hi“, gab Harry zurück. „Du gehst raus?“ Er nahm nicht an, dass Draco zu ihm wollte, aber der Gedanke war ihm doch kurz durch den Kopf gegangen.
„Ich wollte mir eine Pizza holen. Und du?“
„Ich bin zum Kino verabredet.“
Draco runzelte die Stirn. Dann fiel ihm wohl ein, was ein Kino ist und er nickte. „Na dann, viel Spaß.“ Er drängte sich an Harry vorbei und lief die Treppe hinunter. Harry folgte ihm schweigend zur Haustür. Draco griff nach der Klinke, zögerte für eine Sekunde und zog dann die Tür auf. Er trat allerdings nicht auf den Gehsteig hinaus.
„Was ist?“, fragte Harry selbstgefällig. Würde Draco wirklich das Haus verlassen?
Anstatt hinaus zu gehen, wich Draco zur Seite und hielt Harry die Tür auf. „Bitte, nach dir.“
Harry blieb nichts anderes übrig, als an Draco vorbeizugehen. Er wollte auf keinen Fall zu interessiert wirken, an dem was Draco so tat.
Mit einem „Tschüss“ verabschiedete er sich und ging links den Gehweg hinunter. Das Odeon lag gleich hinter der nächsten Querstraße. Nach ein paar Schritten konnte er es sich dann aber doch nicht verkneifen und schaute zurück. Draco kam tatsächlich aus dem Haus heraus und überquerte den Bürgersteig Richtung Straße. Dabei musste einem Pärchen und zwei Skatern ausweichen. An der Bordsteinkante hielt er inne und beobachtete den Verkehr, der auch abends um halb acht nicht nachgelassen hatte. Da die Parkway eine Einbahnstraße war, hielt sich die Gefahr in Grenzen. Trotzdem hielt Harry den Atem an. Draco schaute zu beiden Seiten und wollte gerade über die Straße eilen, als ein Fahrradkurier von rechts herangesaust kam. Harry hatte nicht den Eindruck, dass Draco ihn bemerkt hatte. Schnell rief er: „Draco, Achtung!“
Der sah den Fahrradfahrer gerade noch rechtzeitig und sprang zurück auf den Bürgersteig. Laut schimpfen machte der Kurier einen Schlenker und raste weiter. Draco nickte Harry zu. Harry interpretierte es als ein Dankeschön. Er sah, wie Draco erneut den Verkehr überprüfte und dann zügig über die Straße lief.
Vor dem Eingang der Pizzeria drehte er sich noch einmal zu Harry um und hob die Hand, wie zu einer Verabschiedung. Dann öffnete er die Tür und verschwand in der Sicherheit des Restaurants. Harry verharrte noch für ein paar Sekunden auf seinem Platz, bevor er sich wieder in Bewegung setzte. Sein Herz schlug schnell und die Härchen auf seinen Armen hatten sich aufgestellt. Magie waberte durch seinen Körper, als suchte sie ein Ventil, um aus ihm hinausfließen.
Montagmorgen um 9:05 Uhr kam Harry gerade mit einem Pappkarton voll Einwegbecher aus dem Lager nach vorne ins Café, als er eine Gestalt an dem Tisch in der Ecke bemerkte, an dem außer Draco niemand freiwillig saß. Die Person war halb hinter einer Tageszeitung verschwunden. Harry hätte nicht erkannt, um wen es sich handelte, wenn er nicht die vertrauten Schuhe und Hosenbeine unter dem Tisch gesehen hätte. Außerdem lugte ein Schopf heller Haare über der Zeitung hervor. Verwirrung und Freude breiteten sich in Harry aus und mit dem sperrigen Karton noch in den Armen steuerte er auf Draco zu. Der sah von seinem Daily Mirror auf und meinte: „Guten Morgen, Harry. Ich hätte gerne was zum Frühstücken. Das Übliche, bitte.“
Tagebucheintrag von Sonntag, 4. November 2001
Ich muss noch immer über Michaels Worte nachdenken: „Draco, warum studierst du Zaubertränke? Du willst Leben retten, hat mir Harry erzählt. Glaubst du, du kannst anderen helfen, wenn du selbst keine Hilfe annehmen kannst? Nach dem Krieg hast du eine Entscheidung getroffen, dir ein Ziel gesetzt. Du willst hier weg, alles hinter dir lassen, neu anfangen, etwas leisten, was Gutes tun. Dann steh auch dazu und kämpfe dafür. Sich aufzugeben, ist eine Schwäche. Für sich einzustehen und Hilfe anzunehmen, ist eine Stärke.“ Ich erklärte noch einmal, dass ich Potters Mitleid nicht ertrüge und seine Hilfe nicht bräuchte, aber dazu meinte er nur: „Aber vielleicht braucht Harry das jetzt gerade, dir zu helfen. Auch er hat was zu verarbeiten. Lass ihn doch, um seinetwillen. Harry ist nicht halb so gefestigt, wie er tut. Wahrscheinlich braucht er dich im Moment genauso, wie du ihn.“ Und dann kam das Totschlagargument: „Außerdem schuldest du ihm was, und nicht nur ein bisschen.“ Michael hätte einen guten Slytherin abgegeben. Mir war klar, dass er mich manipulierte. Ich glaube eigentlich nicht daran, dass Harry mich braucht, aber irgendetwas von Michaels Worten nagt an mir. Harrys Bereitwilligkeit, mir zu helfen, hat etwas Bedürftiges, vielleicht sogar Zwanghaftes. Warum würde er sonst so viel Zeit mit mir verbringen, wenn er das gar nicht nötig hat? Außerdem hat mir die Sache mit der Pizzeria gezeigt, dass Harry sich tatsächlich Sorgen um mich macht. Ich dachte immer, Granger wäre die Mutti in dem Trio, aber Harry ist ihr da wohl ebenbürtig. Er war seinen Freunden gegenüber schon immer sehr protektiv. Nicht, dass ich sein Freund bin. In einem hat Michael jedenfalls recht, ich stehe in Harrys Schuld. Wenn der Retter der Welt mich retten muss, um sich gut zu fühlen, dann - Merlin - soll es so sein. Warum ich aber auch zugestimmt habe, mich noch einmal mit Michael zu treffen, um Strategien gegen meine Panikattacken zu entwickeln, weiß ich nicht. Er will mich in eine Therapie locken. Dieser Squib schafft es einfach, alles, was er sagt, so plausibel erscheinen zu lassen, dass man gar nicht auf die Idee kommt, zu widersprechen. Man sieht plötzlich nur noch die Vorteile, in seinen Vorschlägen. Wirklich, ein Slytherin durch und durch. Obgleich, die Dreistigkeit, mit der er hier einfach am Freitag vor der Tür stand und sich selbst zu einem Gespräch eingeladen hast, das ist ganz gryffindor.
#Feind in der Fremde#Feind in der Fremde Kapitel 11#Drarry#fanfiction#German#Draco Malfoy#Harry Potter
2 notes
·
View notes
Photo

New Post has been published on http://deutschstyle.net/2017/10/01/eine-schone-glitzernde-halfpenny-echt-hochzeit-von-the-white-room-sheffield.html
Eine schöne, glitzernde Halfpenny Echt Hochzeit von The White Room, Sheffield
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋ ❋❋❋❋❋❋❋❋ ❋❋❋❋❋ ❋❋
Eine schöne, glitzernde Halfpenny Echt Hochzeit von The White Room, Sheffield
Rachel trug “Lydia” von Halfpenny London, ein exquisites, sequinned Stoffdesign, über einen von Hand geschnitten Seide Slip. Leider nicht mehr, hat Penny brachte ‘Chloe’ für 2017, die bald bei uns sein! Hier ist Rachel White Room und Wedding Geschichte …
“Das weiße Zimmer war das erste Brautkleid-Boutique ich besucht hatte, und das erste Mal, dass ich auf einem Hochzeitskleid versucht hatte. Die Kate Penny “Lydia” war das zweite Kleid, das ich versucht hatte, auf und haben es geliebt – ich liebte, wie bequem es war, als wie sie funkelten, als ich mit Tausenden von winzigen Pailletten bewegt. Allerdings hatte ich einen anderen Termin geplant, auf Kleidern, um zu versuchen, später an diesem Tag. Um rauschen in eine Entscheidung zu vermeiden, nahm ich an der zweiten Termin. Ich glaube, ich war durch die Teilnahme an der White Room erste und trat in die zweite Kleid Boutique verdorben ich wusste, dass ich nicht ein anderes Kleid zu finden, die im Vergleich, wie ich in Lydia fühlte. Jess und mich schließlich zurück zum Weißen Raum mit nur halbe Stunde laufen, bis das Schließen des Kleides ”
” Wir waren für 7 beschäftigt Monate vor unserer Hochzeit. Ich denke, Ross ein bisschen geschockt war, als ich im Juli 2016 heiraten vorgeschlagen, als er dachte, dass wir mehr Zeit haben, zu planen und für die Hochzeit retten (er früher vorgeschlagen sollte, wenn er eine längere Engagement wollte, da ich nicht bereit war, warten Sie, bis Juli 2017!). Wir sind am 22. Juli geheiratet 2016. Wir Im September 2010 trafen sich während sowohl für eine Sicherheitsfirma in Cardiff arbeiten, wurden wir gute Freunde und später Laufpartner. Es war erst im Oktober 2011, dass wir einander als mehr als nur Freunde und ein wenig unter 5 Jahren sahen wir später in der Stadt heiraten, die wir zum ersten Mal traf. “
“Wir haben Zeremonie Cardiff City Hall für unsere Hochzeit. Ich hatte immer erwähnt, dass ich möchte dort zu heiraten, wenn Ross jemals um bekam vorzuschlagen. Also, wenn er außerhalb der City Hall vorgeschlagen fragen ‘dieses, wo Sie möchten, dass wir heiraten, ist es nicht? “, Die die Grundlage seines Vorschlags, gab es keinen anderen Platz im Rennen. Wir haben uns in den Ratskammern mit 75 unserer engsten Familie und Freunde anwesend verheiratet. Das Zimmer war kreisförmig so dass unsere Gäste uns zu umgeben, während unsere Gelübde sagen, eine sehr intime Atmosphäre zu schaffen alignnone Größe voll
” ich kaufte auch meine Brautjungfern aus dem Weißen Raum kleidet nach verlieben mit dem fantastischen Geist London Bereich sie auf Lager. Die ganze Erfahrung auf dem Kleid zu versuchen, ist eines der Dinge, vor der Hochzeit, die ich mit Vorliebe wieder auf immer aussehen wird. Ich fühlte mich immer wie ich während meiner Besuche hört wurde und ich war das richtige Maß an Privatsphäre bei Armaturen gegeben (dies mag trivial klingen, aber seine erstaunlich, wie einige Boutiquen diese falsch). Ich erhielt Updates auf, wenn mein Kleid angekommen und wenn für Armaturen kommen in. Leanne und Karen waren auch in der Lage auf Gegenstände zu beraten wie Hochzeit Unterwäsche “
” Mein Vater begleitete mich den Gang hinunter. Offenbar Schuppen er eine Träne (was für meinen Vater sehr selten ist), obwohl ich das verpasst, als ich die Tränen selbst kämpfte zurück, als ich in Richtung Ross ging, dass, sobald die Musik in Tränen zusammengebrochen war begonnen hatte. “
Fotografie
“Chris von Context Fotografie uns tatsächlich empfohlen wurde, als er ein Freunde Familienmitglied ist. Uns gefiel seine natürlichen Stil und er war so gut mit uns am Tag. Wir hatten insgesamt Änderung des Plans mit den Fotos, und entschied sich gegen in der City Hall Familienfotos, wie sie es einfach zu heiß an dem Tag war, so konnten wir auf im Tipi später am Tag ein Familienmitglied, runden “</div >
Florist: Forbesfield, Cardiff “ich liebe Blumen, aber es war nicht etwas, das wir auf unserer Hochzeit Budget priorisiert hatten, aber als wir mit Beth traf und sah ihre Arbeit, die ich nicht bereit war, für jedermann zu begleichen sonst. Ihre Arbeit ist wirklich erstaunlich, und sie wurden nicht enttäuscht am Tag alignnone Größe
Details:
“Wir haben unsere eigene Hochzeit stationär auf Vista-Druck, die eine Aquarellmalerei gekennzeichnet von die Tipis, die meine Mutter gemalt hatte. Meine Eltern handgemachte die Hochzeit favorisiert Füllung kleine Töpfe Honig und Formbienenwachskerzen von den Bienen sie auf ihrem Land halten. Dekor wurde mit dem Schwerpunkt auf den Blumenanzeigen mit rustikalen Elementen einfach gehalten. Wir hielten auch die Champagner-Flaschen, die wir hatten von Freunden und Familie als Engagement Geschenke gegeben worden und machte sie zu Kerzen für die Top-Tabelle “
” wir haben so die Hochzeitsfeier als weniger formell Teil des Tages haben wir beschlossen, unsere erste Tanz auf die akustische Version des ‘Friends’ Titelmelodie zu haben (von unseren Folk-Band gespielt). Wir haben uns für diese, als wenn wir uns zusammen den Menschen vorstellen Reaktionen sind häufiger als nicht “oh mein Gott, du bist Ross und Rachel!« Ich bin nicht sicher, ob die Großeltern die Argumentation hinter dem Lied verstanden, aber es war etwas, das uns gemacht und ein viele unserer Freunde Lächeln “
” Es gibt so viele Momente, die ich über die auffallen in meinem Kopf, aber mein Lieblingsmoment des Tages war der Moment, Ross umdrehte schreiben konnte und wir sahen einander zum ersten Mal, während ich den Gang war zu Fuß nach unten. Alles, was ich sah, war ihm, und er war in Tränen aufgelöst, so wie ich wusste er würde be.Small Dinge unnötig waren bis zur Hochzeit in Führung betonte über und am Tag vergessen zu, aber ehrlich gesagt können wir sagen, wir würden nicht ändern Ding. Kein Stress über die feineren Details und es einfach genießen, wie es so schnell geht! Machen Sie es Ihren Weg und erinnere mich an den Tag über Sie und Ihr Mann “
Schlusswort:” The White Room ist elegant und einladend eine angenehme Umgebung bietet eine schöne Auswahl an Kleidern zu versuchen. Ich werde auf jeden Fall die White Room für alle zukünftigen Bräute werden empfehlen, dass ich vor allem in der Hoffnung, dass ich wieder die Boutique zu besuchen. Ich kann nicht Leanne und Karen genug für die brillante Service danken, die sie zur Verfügung gestellt und wirklich machen die ganze Erfahrung spezielle ”
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋ ❋❋❋❋❋❋❋❋ ❋❋❋❋❋ ❋❋
Eine schöne, glitzernde Halfpenny Echt Hochzeit von The White Room, Sheffield ❋❋ ❋❋❋❋❋ ❋❋❋❋❋❋❋❋ ❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋
0 notes
Text
[Album] Lydia Ainsworth präsentiert “Darling Of The Afterglow”

Drei Jahre nach dem Debütwerk meldet sich Lydia Ainsworth mit neuem Material zurück. Am 31.03.2017 wird mit “Darling Of The Afterglow” das zweite Album der Kanadierin via Bella Union erscheinen. Die elf Songs auf “Darling Of The Afterglow” stehen für einen sehnsuchtsvollen Future-Pop mit synthetischen Klängen, dunklen R'n'B-Elementen und intimen Emotionen verpackt in ein perfekt passendes, musikalisches Gewand. Die in Toronto lebende Ainsworth nahm das Nachfolgealbum zu “Right From Real” zusammen mir einer Vielzahl an lokalen Musikern auf und bekam auch familiäre Hilfe, fungierte ihr Vater David Krystal, seines Zeichens selbst Singer/Songwriter, als Ko-Produzent des Albums. "The Road” heißt der erste Vorbote des neuen Werks. Das Video dazu findet ihr hier.
youtube
0 notes
Text
Feind in der Fremde
Kapitel 5
Link zu den vorherigen Kapiteln
Es geht weiter abwärts - auch in den Keller
Am Dienstag schien Malfoy seine Wohnung noch immer nicht verlassen zu haben. Jedenfalls hatte Harry ihn weder im Hausflur noch auf der Straße gesehen. Er überlegte schon, ob er einen Zauber auf Dracos Wohnungstür legen sollte, der ihn alarmierte, sobald jemand über die Schwelle trat, aber Malfoy würde die Magie wahrnehmen können und … Warum sollte Harry das überhaupt tun? Es konnte ihm doch egal sein, wie Malfoy seine Zeit verbrachte. Nur, das Husten hörte sich nicht gut an und Fletcher hatte gesagt, dass er nicht gedachte, vor Monatsende vorbeizukommen.
Als Harry am Nachmittag seinen Muggel-Briefkasten im Hausflur leerte, fiel ihm auf, dass Malfoys Briefkasten überquellte. Kataloge und Werbeflyer verstopften den Briefschlitz und drohten, auf den Boden zu fallen. Also einer sollte Malfoy wirklich mal daran erinnern, seinen Briefkasten zu leeren, bevor er den ganzen Hausflur zumüllte!
Energisch zupfte Harry ein paar der Werbesendungen raus und ging in den ersten Stock. Laut klopfte er an Malfoys Wohnungstür. Mit der Klingel versuchte er es erst gar nicht mehr.
Es dauerte noch länger als üblich, bis sich die Tür öffnete. Ein seltsam säuerlicher Geruch stieg Harry in die Nase, obwohl Malfoy die Tür nur einen winzigen Spalt geöffnet hatte. Sein ehemaliger Mitschüler sagte keinen Ton, sondern starrte ihn nur aus geröteten Augen an und zog schniefend die Nase hoch. Dann hob er eine Hand, um sich eine fettige Haarsträhne hinter sein Ohr zu schieben.
„Erkältet?“, fragte Harry, als er merkte, dass er Malfoy ebenfalls angestarrt hatte.
„Ein bisschen. Wieso?“ Nach dem zweiten Wort brach Malfoys Stimme und er musste sich räuspern, um weitersprechen zu könne.
„Ein bisschen?“, entfuhr es Harry ungläubig. „Weißt du, wie sich dein Husten anhört? Ich kann nachts kaum schlafen!“
Über Malfoys Gesicht huschte Verärgerung. „Dann sprich doch einen Stillezauber auf deine Wände, wenn ich dir zu laut bin. Ach ja, das geht ja nicht, denn dann müsstest du ja auch deine bemitleidenswerten Versuche aufgeben, mich mit deinem Gekreische zu quälen.“
Harry wusste nicht, was er darauf erwidern sollte. Malfoy etwas triezen zu wollen, war eine Sache, auf so ein Verhalten aber nun offen angesprochen zu werden, eine ganz andere. Er kam daher lieber auf den eigentlichen Grund seines Besuchs zu sprechen: „Ich bin auch gar nicht wegen deines Hustens hier. Dein Gesundheitszustand interessiert mich nicht.“ Harry war sich nicht sicher, ob Malfoy seinen letzten Satz gehört hatte, da er wieder zu husten begann. Seine dürre Erscheinung erbebte geradezu. Harrys Gesicht nahm sofort einen besorgten Gesichtsausdruck an, was seine Worte Lügen strafte. Malfoy hatte zum Glück zu viele Tränen in den Augen, um das mitzubekommen.
Als der andere wieder ruhiger atmete, sprach Harry weiter: „Also, was ich dir eigentlich sagen wollte, ist, dass du deinen Briefkasten leeren musst. Dir ist doch klar, dass du unten im Hausflur einen Muggelbriefkasten hast, oder? Lydia hat immer eine ganze Menge Kataloge und Werbung bekommen. Du musst an die Firmen schreiben und sie darüber informieren, dass Lydia gestorben ist, sonst ballern sie dich weiterhin mit dem Zeug zu.“
„Zuballern?“ Malfoy kannte den Ausdruck anscheinend nicht, aber er verstand trotzdem, was Harry meinte. „Dann nimm noch einfach deinen Zauberstab und lass den ganzen Krempel verschwinden, wenn du deine eigene Post holst“, antwortete Malfoy.
Harry seufzte theatralisch und setzte schon zu einer Erwiderung an, da meinte Malfoy schnell: „Schon gut, ich weiß, du bist kein Hauself und wirst nicht den kleinsten Finger für mich zu rühren. Keine Sorge, ich kümmere mich so schnell wie möglich um den Briefkasten.“
„Wunderbar, mehr wollte ich auch gar nicht. Dann schönen Tag noch.“ Harry wandte sich ab, drehte sich dann aber doch noch mal um, fast schon verwundert, dass Malfoy die Tür noch nicht zugeworfen hatte.
„Was ist eigentlich mit Lydias Sachen?“
„Bin dabei.“
„Dann komme ich in den nächsten Tagen vorbei, um sie abzuholen.“
„Wann denn genau? Ich meine nur, falls ich nicht da bin“, antworte Malfoy und begann schon wieder, zu husten.
„Keine Ahnung. Ich klopfe einfach mal zwischendurch an. Bis dann.“ Innerlich frohlockte er über Malfoys genervten Gesichtsausdruck.
Harry stieg nachdenklich die Stufen zum Café hinunter. Dracos Worte klangen ihm noch in den Ohren: ‚Falls ich nicht da bin?‘ Malfoy war doch immer da, oder stahl er sich doch heimlich aus dem Haus raus? Es war kurz nach 17 Uhr und Jill war gerade dabei, ihre Schicht zu beenden, als Harry am Personalraum vorbeikam. Er blieb am Türrahmen stehen und fragte: „Jill, hast du den neuen Nachbarn inzwischen mal gesehen?“
„Malfoy? Ich glaube nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, dass ich ihn erkennen würde, auch wenn du ihn mir ja sehr detailliert beschrieben hast. Mir ist jedenfalls kein schlanker, blonder Mann mit komischen Augen und geraden Zähnen aufgefallen. Wieso fragst du?“
Ja, warum fragte er? Warum verwandelte sich sein Leben wieder in das 6. Schuljahr, als er Draco ständig hinterherspioniert hatte?
„Hast du denn jemanden gesehen, der Malfoy besucht haben könnte?“
„Nein, wieso?“
„Es wäre sicher praktisch, wenn du wüsstest, wie Malfoy aussieht. Vielleicht solltest du dich mal bei ihm vorstellen.“
„Bitte?“ Jills Stimme klang reichlich ungläubig.
„Naja, es ist doch von Vorteil, wenn man seine Feinde kennt? Und dann könnten wir zusammen ein Auge auf ihn haben“, beeilte sich Harry zu erklären.
„Wieso, was macht er denn?“
„Das weiß ich eben nicht. Ich frage mich nur … hm … ob… also… Ich höre ihn husten…oft, meine ich.“ Harry merkte, wie ihm die Hitze ins Gesicht stieg.
Jill starrte ihn an, dann weiteten sich ihre Augen. „Du machst dir Sorgen um ihn!“
„Nein!“, widersprach Harry schnell, gab unter Jills skeptischen Blick dann aber doch zu: „Er kennt sich in der Muggelwelt nicht aus, und ich habe den Verdacht, dass er das Haus nicht verlässt. Da frage ich mich natürlich, wie er sich mit Essen versorgt.“
„Natürlich.“
Harry errötete.
„Ich meine, vielleicht lässt ihm das Ministerium auf magischem Wege Essen zukommen. Oder ich kriege es einfach nicht mit, wenn er einkaufen geht. Ich weiß auch nicht.“ Harry nahm einen tiefen Atemzug. Er dachte an seinen Traum und wusste auf einmal, warum es ihm so schwer viel, Malfoy zu ignorieren. „Es ist nur so, Malfoy ging es schon einmal ziemlich dreckig, damals in der Schule, im 6. Schuljahr, und…naja… ich habe es gesehen, aber nichts unternommen, um ihm zu helfen. Eher im Gegenteil. Hätte ich mich damals anders verhalten, wäre der Krieg vielleicht anders verlaufen.“
„Also willst du ihm helfen“, stellte Jill fest.
Wollte er das? Wollte er dem blöden Kerl helfen? Ziel war es doch, ihn loszuwerden. Harry war nicht für ihn verantwortlich. Aber Malfoy war krank und seine Scham über sein damalige Verhalten war einer der Gründe gewesen, warum es ihm so wichtig gewesen war, bei der Gerichtsverhandlung für Malfoy auszusagen. Die Frage war nur, ob Malfoy überhaupt Hilfe benötigte. Eine Bronchitis war nicht wirklich etwas Schlimmes und ging spätestens nach zehn Tagen wieder vorbei. Malfoy war klug und selbstbewusst, er würde schon nicht in seiner Wohnung hocken und hungern, oder? Nein, auf keinen Fall, der Gedanke war absurd. Harry kannte Hunger. Die Dursleys hatten Essensentzug ein paarmal als Strafe eingesetzt, daher konnte er nicht glauben, dass sich einer aus Dummheit oder falschem Stolz diesem Gefühl aussetzen würde. Gerade so ein verwöhntes Muttersöhnchen wie Malfoy nicht. Aber Malfoy war auch irgendwie komisch. Harry konnte ihn nicht wirklich einschätzen.
Da er auf Jills Feststellung nicht reagiert hatte, fuhr diese fort: „Wie wäre es, wenn du noch einmal mit seinem Bewährungshelfer sprichst, Harry. Wenn du ihm erzählst, dass Malfoy krank ist, wird er wohl vorbeikommen und du musst dir keine Sorgen mehr machen. Lad dir nicht so viel Verantwortung auf. Malfoy wird schon klarkommen. Wir Muggel beißen schließlich nicht. So, ich muss jetzt los. Tschüss.“
„Ja, tschüss, bis morgen.“
Jill hatte recht, Harry würde einfach Fletcher Bescheid geben, und zwar sofort. Damit wäre seiner Pflicht Genüge getan.
Es stellte sich jedoch heraus, dass Malfoys Bewährungshelfer für zwei Wochen im Urlaub war. Harry erkundigte sich nach seiner Vertretung und bekam zu hören, dass es sich dabei um eine Mrs Brimbone handelte, die aber schon Feierabend hatte. Harry hinterließ ihr eine Nachricht, sich schnellstmöglich bei ihm zu melden.
Abends unterhielt sich Harry noch lange mit Jason Frye, einem der Seminarleiter. Jason war ein 50 Jahre alter Zauberer, der mit einer Muggel verheiratet war. Er hatte drei Kinder, von denen zwei magisch begabt waren. Er leitete eine Gesprächsgruppe für gemischte Eltern. Harry und er teilten den gleichen Musikgeschmack und konnten stundenlang über Bands und Platten fachsimpeln. Heute wollte Harry aber einfach nur vermeiden, weiter über Malfoy nachzudenken. Als er gegen Mitternacht müde ins Bett fiel, erneuerte Harry seinen Geräuschdämmungs-Zauber auf der Schlafzimmerwand, damit ihm Malfoys Husten kein schlechtes Gewissen machen konnte.
Fletchers Vertretung, Mrs Brimbone, meldete sich nicht am nächsten Tag bei Harry und als er deshalb am Donnerstag noch einmal im Ministerium nachhakte, wurde ihm mitgeteilt, dass die Hexe sich für den Rest der Wochen krankgemeldet hatte. Eine Vertretung gäbe es nicht, aber Harry müsse sich keine Sorgen um Malfoy machen, er hätte genug Geld, um sich selbst zu versorgen, und er hätte in Azkaban ja schließlich Muggelkunde-Unterricht erhalten, daher würde er sich in der Muggelwelt schon zurechtfinden. Harry berichtete über Malfoys Erkältung und erkundigte sich nach dessen medizinischen Versorgungsmöglichkeiten
„Mr Malfoy ergeht es da wie den Muggel. Wenn er krank ist, kann er zu einem Hausarzt in Wohnortnähe gehen, der wird ihn kostenlos behandeln. In Großbritannien ist die ärztliche Grundversorgung für Muggel frei. Wir haben Mr Malfoy mit entsprechenden Ausweispapieren versorgt, daher sollte es keine Probleme geben. Wegen einer Erkältung muss man aber doch sicher nicht gleich zum Arzt.“
Harry war ein wenig beruhigt. Malfoy war kein Kind, er würde sich schon um sich selbst kümmern können. Am Freitagnachmittag klopfte er trotzdem noch einmal an Malfoys Tür, schließlich wollte er ja noch Lydias Sachen abholen und jemand musste Malfoy über die Hausregeln in Bezug auf den Keller informieren. Nicht, dass Malfoy den auch noch zumüllen ließ. Und wenn er den Kerl erstmal aus der Wohnung gelockt hatte, konnte er auch einen genaueren Blick auf seinen Allgemeinzustand werfen. Im dunklen Wohnungsflur, aus der halb geöffneten Wohnungstür herausguckend, konnte man ja kaum etwas von ihm erkennen.
Es dauerte ewig, bis Malfoy die Tür öffnete. Der Geruch, der aus der Wohnung strömte, war nicht frischer als vor drei Tagen, aber Malfoy selbst wirkte etwas gepflegter, jedenfalls was seine Haare anging. Dieses Mal war er auch in keine Wolldecke gehüllt. Im Gegenteil, offenbar war ihm warm, denn er stand barfuß und nur mit einer Hose und einem T-Shirt bekleidet in der Tür, obwohl die Temperaturen nicht gestiegen waren. Seine Augen glänzten unnatürlich und auf seiner Stirn stand Schweiß.
„Potter. Es tut mir leid, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, Mrs Pentriss Sachen zusammen zu packen. Komm doch nächste Woche wieder,“ krächzte Malfoy anstelle einer Begrüßung.
„Schon gut. Werde du erstmal wieder gesund“, rutschte es Harry heraus, bevor er es verhindern konnte. „Ich wollte mit dir nur noch mal die Hausregeln für den Keller besprechen und dir die Räume dort zeigen. Du hast da einen Verschlag.“ Da Malfoy nicht reagierte, schob Harry hinterher: „In denen vielleicht Sachen sind, die du brauchst.“
„Muss das heute sein?“, fragte Malfoy und hustete. Es klang sehr feucht und Harry freute sich, dass Malfoys Husten sich so langsam zu lösen schien. Er hatte gehört, dass das ein gutes Zeichen war.
„Naja, jeder der hier wohnt sollte die Hausordnung kennen. Außerdem musst du vielleicht mal an den Stromkasten, wenn die Sicherungen herausfliegen. Also kommst du?“
Irgendetwas in seinem Satz hatte Malfoys Interesse geweckt, denn er antwortete bereitwillig: „Warte, ich zieh mir eben noch Schuhe an.“
Mit Pantoffeln bekleidet erschien er wenig später in der Tür und folgte Harry in den Keller. Unten angekommen schwankte er etwas, als sei ihm schwindelig. Harry stellte das Licht an und ging langsam den Gang entlang. Er deutete auf die verschiedenen Verschläge und erklärte zu welchen Hausbewohnern sie gehörten. Malfoy folgte ihm hustend.
„Das hier ist deiner. Da steht auch noch Lydias altes Fahrrad drin und ihr Werkzeugkasten. Kannst du Fahrradfahren, Malfoy?“
Der Angesprochene schüttelte den Kopf und atmete schwer. Vielleicht war es doch keine so gute Idee gewesen, Malfoy mit in den kalten Keller zu nehmen.
„Du darfst hier nirgendwo etwas abstellen. Wenn hier einer erstmal sein Gerümpel ablädt, steht bald der ganze Keller voll.“ Harry fühlte sich wie einer der Professoren in Hogwarts, aber er konnte ja nicht einfach seinen Plan aufgegeben, Malfoy mit der Muggelwelt auf die Nerven zu gehen.
Harry öffnete eine Tür und betrat den dahinterliegenden Raum. „Dieser Kellerraum war mal ein Trockenkeller, aber der wird heute nicht mehr benutzt wegen der Schimmelgefahr. Du hast ja einen Wäschetrockner in deiner Wohnung. Für empfindliche Sachen nimmst du einfach den Wäscheständer. Der steht auf Lydias Balkon.“ Harry wagte nicht, darüber nachzudenken, warum er Malfoy so ausführliche Erklärungen gab, wenn er ihm doch eigentlich Schwierigkeiten bereiten wollte.
Er ging auf eine weitere Tür zu. „Hier ist die Zentralheizung. Sie läuft mit Gas. Das da sind die Zähler.“
„Und wie stellt man die Heizung in der Wohnung an?“, fragte Malfoy mit leiser, rauer Stimme.
„Die Heizung? Einfach an dem Thermostat drehen.“ Harry schaute Malfoy überrascht an. Hatte der bisher nicht geheizt? Bei der Kälte draußen? „Da ist so ein runder Knopf an den Heizkörpern. Den nennt man Thermostat. Je weiter man den aufdreht, desto mehr Wärme gibt die Heizung ab.“ Da Malfoy ihn ausdruckslos ansah, fügte Harry spöttisch hinzu: „Du weißt doch wohl, was Heizkörper sind, oder?“
„Natürlich.“ An Malfoys Gesichtsausdruck war nicht abzulesen, ob er die Wahrheit sprach. Harry wandte sich dem Sicherungskasten zu. Wenn Malfoy etwas unklar war, würde er wohl seinen Stolz herunterschlucken und Harry fragen müssen.
„Und das sind der Sicherungskasten und der Stromzähler. Die Rechnungen für Gas, Wasser und Strom gehen direkt ans Ministerium.“
Malfoy nickte, als Harry ihm einen prüfenden Blick zuwarf, aber dieses Mal konnte Harry sehen, dass er nicht genau wusste, wovon Harry sprach. Woher auch?
„Wasser, Strom und Gas kosten Geld, Malfoy. Unsere Rechnungen werden vom Ministerium bezahlt, das den Betrag auf die Miete draufschlägt. Mit dem Gas wird das Wasser für die Heizung warm gemacht. Außerdem gibt es Gasanschlüsse in den Wohnungen. Falls du dich wunderst, warum Lydia keinen Gasherd hat, das liegt daran, dass sie Angst vor Gasvergiftungen und Explosionen hatte. Es gibt auch keine Gasthermen mehr im Haus, sondern Durchlauferhitzer. Die hast du ja sicher gesehen. Einer ist in der Küche und einer im Bad.“
Malfoy reagierte nicht und Harry war sich nicht sicher, ob er überhaupt noch zuhörte. Sein Gesicht wirkte ölig. Er hatte sich ungeachtet der Spinnenweben gegen die Kellerwand gelehnt. Harry betrachtete Malfoys Körper. Er war nur noch ein Strich in der Landschaft. Seine Schlüsselbeine traten deutlich hervor und seine Handgelenke wirkten knochig. Die Hose rutschte ihm beinahe von den Hüften. Harrys Augen wanderten zurück zu Malfoys blassem Gesicht mit den eingefallenen Wangen und umschatteten Augen. Diese starrten ihn gerade leicht glasig an. Harry räusperte sich.
„Durchlauferhitzer machen das Wasser warm“, erklärte Harry und versuchte damit, die Stille zu überbrücken. Er zeigte auf einen Kasten an der Wand. „Also, wie gesagt, das hier ist der Sicherungskasten für den Strom. Leider springen die Sicherungen oft heraus, wenn man z.B. zu viele Geräte auf einmal nutzt.“
Harry öffnete die Türen des Kastens und begutachtete die Schalter, dann stutzte er. Alle Sicherungen zu Malfoys Wohnung waren raus. Harry drehte sich zu Malfoy um.
„Du hast ja gar keinen Strom in deiner Wohnung!“ Sein Ton klang vorwurfsvoll, dabei war er eigentlich erschrocken. Kein Wunder, dass Malfoys Wohnung immer so dunkel wirkte und die Türklingel nicht funktionierte.
„Malfoy, bist du ein Idiot? Du lebst seit zwei Wochen ohne Strom in Lydias Wohnung?“
So langsam wurde Harry klar, wie Malfoy gehaust haben musste. „Und ohne Wärme? Kein Wunder, dass du krank geworden bist.“ Seine schlimmste Befürchtung schien sich gerade bestätigten. „Hast du denn irgendwas gegessen? Der Kühlschrank und der Herd funktionieren so doch auch nicht. Warst du eigentlich mal einkaufen? Oder versorgt dich das Ministerium?“
„Natürlich habe ich was gegessen oder glaubst du, ich würde hungern? Außerdem war mir bisher nicht kalt. Nur jetzt, wo ich erkältet bin, würde ich es gerne etwas wärmer haben.“ Die paar Sätze führten direkt zu einem erneuten Hustenanfall. Malfoy krümmte sich, sein Atem ging rasselnd und als er sich wieder aufrichtete war sein Gesicht puterrot. Er sah so erbärmlich aus, dass sich Mitleid in Harry regte. Verdammt.
„Geh ins Bett, Malfoy. Und wenn es dir Montag nicht bessergeht, musst du zum Arzt. Ich kann dich auch belgeiten.“ Das Letzte war Harry rausgerutscht, bevor er darüber nachgedacht hatte. Nun verfluchte er sich innerlich über seine unbedachten Worte.
„Nein danke, Saviour, ich komme ganz gut alleine zurecht. Montag geht es mir sicher auch schon wieder besser. Würdest du mir das mit den Sicherungen eben noch zeigen?“
Harry demonstrierte, wie man die Sicherungen wieder einschaltete. Danach gingen sie zurück zum Treppenhaus. „Soll ich dir oben in deiner Wohnung noch zeigen, wie man die Heizung anstellt?“, bot Harry an. Das war ja nur eine Kleinigkeit und er würde schauen können, was Malfoy in seiner Wohnung so trieb.
„Nicht nötig. Das krieg ich schon hin.“ Malfoy blieb am Fuß der Treppe stehen. Er atmete keuchend. „Geh du schon hoch, ich schaue mir noch meinen Kellerraum an.“
Harry zögerte. Malfoy gehörte ins Bett. Er brauchte Tee und Brühe und am besten Heiltränke. Aber da er ja keine Hilfe wollte, musste Harry auch kein schlechtes Gewissen haben, ihn allein zu lassen.
„Wie du meinst“, antwortete er deshalb und stieg die Stufen zum Erdgeschoss hoch. Fast hätte er sich doch noch umgedreht und gesagt: „Du weißt ja, wo du mich findest, wenn was ist“, konnte sich dieses Mal aber beherrschen. Als er durch die Hintertür ins Café ging, fiel ihm ein, dass Malfoy gar keinen Schlüssel für Lydias Kellerraum dabeihatte. Was wollte er also da unten? Am liebsten hätte Harry direkt kehrtgemacht und nachgesehen, aber er musste sich um die Kasse kümmern und den Laden zuschließen.
Tagebucheintrag von Freitag, 12. Oktober
Ich liege im Bett und zittere so stark, dass ich kaum den Stift halten kann. Mir ist zugleich heiß und kalt. Potter hat auf eine Begehung des Kellers bestanden und ist daher Zeuge meines Zustandes geworden. Es war demütigend. Immerhin durchkreuzt sein Mitleid seine halbgaren Versuche, mich zu schikanieren. Er bot sogar an, mich zu einem Muggelheiler zu begleiten, einem ‚Arzt‘. Ich hätte gelacht, wenn ich nicht zu sehr damit beschäftig gewesen wäre, mich überhaupt auf den Beinen zu halten.
Wie tief bin ich gesunken, dass mein Erzfeind mich zum Empfänger seines Helferkomplex macht? Es ist erbärmlich. Und wieso glaubt er überhaupt, ich sei der Hilfe wert?
Wenigstens habe ich jetzt Strom (Potters Verdienst) und endlich gibt es Licht! Nur warm ist es noch immer nicht. Potters Tipp, die Thermostate aufzudrehen, hatte ich natürlich schon versucht. Daran liegt es nicht. Vielleich ist etwas kaputt.
Ich würde jetzt gerne jedes einzelne Strom-Gerät ausprobieren, das es in der Wohnung gibt. In der Küche brummt es und an einigen Stellen leuchten plötzlich rote und gelbe Lämpchen. Leider reicht meine Kraft gerade nicht dazu. Ich konnte mich nur noch so ins Bett schleppen. Ich bin so schlapp, dass ich es kaum die Treppe hochgeschafft habe. Merlin sei Dank is t Potter Potter schon vorgegegegangen. Es ist zu peinl i h . Viell eicht sollte ich am Monntag wirklich zum Arztt gehen. Aber j j etzt jetzt sc--
2 notes
·
View notes