#sozioökonomische Faktoren
Explore tagged Tumblr posts
Text
Diskriminierung aufgrund sozialer Herkunft – Klassismus
Klassismus ist keine veraltete, sondern unterschätzte Realität moderner Gesellschaften. Trotz fortschrittlicher Bildung und aufgeklärter Diskurse bleibt die Diskriminierung aufgrund sozialer Herkunft ein gravierendes Problem, das nur wenige erkennen. Klassismus manifestiert sich nicht mehr durch offenen Ausschluss, sondern durch subtile Mechanismen und Barrieren, welche den Zugang zu Bildung, qualitativer Gesundheitsversorgung, anständig bezahlten Jobs und gesellschaftlichem und politischem Einfluss steuern.
Die neue Armut – Working Poor:
Über Klassismus wurde bis 2020 kaum offen geredet. Viele Menschen denken, diese Form der Diskriminierung existiert nicht mehr, denn heute kann jeder es zu etwas bringen, wenn er oder sie sich nur genug anstrengt.
Der Mythos der meritokratischen Gesellschaft, in der jeder seines eigenen Glückes Schmied ist, wird durch die Lebenssituation der allermeisten Lohnempfänger ad absurdum geführt. Viele Menschen in Deutschland mühen sich täglich ab und verdienen trotz Arbeit zu wenig, um sich finanziell abzusichern, weiterbilden oder sparen zu können.
Die neue Armut betrifft also nicht nur Arbeitslose, Obdachlose oder andere „Randexistenzen“, sondern einen Großteil der Bevölkerung: die „working poor“, also alle, die als Geringverdiener gelten – zum Beispiel Kassierer, Verkäuferinnen, Kinderpfleger, Reinigungskräfte, Maurerinnen, Altenpfleger, Lieferantinnen, Kellner, Köchinnen, Friseure, Kfz-Mechanikerinnen, Bürokräfte, Maler, Krankenschwestern usw. usf.
Nicht nur die unterschwellige Angst vor Erwerbslosigkeit und Wohnungsverlust gehören hier zum Alltag, sondern noch allerhand weitere Probleme (gesundheitlich, sozial etc.).
Vgl. auch Klassismus in Deutschland: Kampf gegen Arme statt Armut
Wenn der Erfolg vom Elternhaus abhängt
Um in Deutschland überhaupt Chancen zu bekommen, um die eigene sozioökonomische Lage zu verbessern, braucht es bestimmte Mittel (Geld, soziales Netzwerk, Bildung). Doch in einkommensarmen Familien bleibt nichts übrig, um genug Rücklagen für schwere Zeiten aufzubauen oder in die Bildung der Kinder zu investieren.
Vgl. Teufelskreis der Armut – Die Armutsspirale in Deutschland
Tatsächlich bemühen sich die meisten betroffenen Jugendlichen direkt nach der Schule um eine Lehrstelle und anschließend wird der erste verfügbare Job genommen. Natürlich aus Gründen der Not oder fehlender Perspektiven.
Oft sind auch die Noten nicht ausreichend. Nicht weil diese Schüler ungeeignet oder faul waren, sondern weil ihnen grundlegende Unterstützungen und Förderungen fehlen, die für Kinder aus mittleren sozialen Schichten völlig selbstverständlich sind.
Bei der beruflichen Orientierung von Menschen aus armutsbetroffenen Familien sind Faktoren wie Sicherheit, mangelndes Selbstbewusstsein, praktische Einschränkungen und finanzielle Not beteiligt. Daher neigen Betroffene auch dazu, sich auf das Naheliegendste zu beschränken.
Klassismus im Bildungssystem
Die Aussortierung startet früh. An entscheidenden Wendepunkten wie bereits bei dem Übergang von der Grundschule zu weiterführenden Schulen wird entschieden, wer „aufsteigen“ darf und wer nicht. Unsere Schulen spiegeln gesellschaftliche Schichten wider: Untersuchungen zeigen, dass Kinder aus sozial benachteiligten Familien selbst bei identischer Leistung oft schlechter bewertet werden.
Diese Kinder tragen vielleicht nicht die „richtigen“ Namen oder Klamotten, sprechen derber, benehmen sich anders, sind trotziger oder schwieriger – so wie Menschen es oft sind, die das Gefühl haben, nie etwas geschenkt zu bekommen und denen man keine Beachtung schenkt.
Vgl. Was Armut mit Kindern macht sowie Bildungsexpansion: mehr Bildung ist nicht die Lösung
Die Rolle des Selbstbewusstseins
Selbstbewusstsein ist nicht angeboren. Fehlt es, dann ist das oft eine direkte Reaktion auf das Umfeld. Menschen, die im Job unsicher wirken, können in anderen Lebensbereichen, wie zu Hause, durchaus selbstsicher auftreten.
Diese Unsicherheit im beruflichen Kontext kann zum Beispiel eine Folge ständiger negativer Rückmeldungen seit der Kindheit sein: Du bist nicht gut genug, du bist nicht schlau genug etc. Hinzu kommt das Gefühl, nicht dazuzugehören oder die richtigen Spielregeln nicht zu verstehen.
Sehr viele Erwachsene, die in Armut aufgewachsen sind, leiden unter einem niedrigen Selbstwertgefühl, weil sie das gesellschaftliche Vorurteil, dass Armut selbstverschuldet sei, verinnerlicht haben. Diese Scham ist tiefgreifend und hindert daran, sich gut zu verkaufen, zum Beispiel bei Bewerbungsgesprächen.
Mangelndes Selbstwertgefühl ist allerdings eine normale Reaktion auf eine gesellschaftliche Realität, die Menschen unbewusst aufgrund ihrer sozialen Herkunft abwertet. So unsichtbar diese komplexen Macht-Mechanismen auch sind, Betroffene bekommen sie bitter zu spüren.
Das Trugbild der Meritokratie
In den vergangenen Jahrzehnten haben Boulevardmedien so gut wie alles getan, um das Bild vom unmündigen, faulen Armen in der Gesellschaft zu verfestigen. Zu der finanziellen Not kommen also noch öffentlicher Spott und Verachtung – nur werden die Menschen nicht mehr an den Pranger auf den Marktplatz gestellt, sondern in einschlägigen TV-Programmen öffentlich vorgeführt.
Dennoch hat es in Deutschland lange gedauert, bis sich die Wissenschaft mit dem Thema Klassismus auseinandergesetzt hat. Denn oft wird das Problem der Diskriminierung gerade von denjenigen, die diskriminieren, gar nicht wahrgenommen.
Das betrifft natürlich auch alle Dimensionen unseres Gesellschaftssystems. Viele weiße Menschen bemerken überhaupt nicht, wie automatisch sie andere aufgrund ihrer Hautfarbe herabwürdigen. Männer übersehen häufig, wie selbstverständlich sie Frauen nicht ernst nehmen.
Und ähnlich verhält es sich mit dem Blick wohlhabender Menschen auf ärmere Schichten, geprägt von dem Glauben, Erfolg sei eine Frage von Hochbegabung und Leistung. Vgl. Sozialer Aufstieg durch Bildung – Die Opfer des Erfolgs
Wenn Beziehungen mit Talent verwechselt werden
Die Mitglieder der sogenannten „Mittel- und Oberschichten“ sind sich oft nicht bewusst, dass sie bereits mit Privilegien zur Welt kommen, die anderen Kindern verwehrt bleiben. Dazu gehört natürlich weit mehr als nur das Geld und Eigentum der Eltern.
Es beginnt mit so grundlegenden Dingen wie einem eigenen Zimmer und dem Kleidungsstil, setzt sich fort über die zahlreichen Kurse, mit denen Kinder auf den gesellschaftlichen Wettbewerb vorbereitet werden oder durch die sie ihr Potenzial entfalten lernen. Es geht weiter mit Reisen und dem scheinbar selbstverständlichen Netzwerk, das diese Kinder ein Leben lang begleitet – ein Bezugssystem aus Ärztinnen, Lehrern, Juristinnen, Politikern etc., welches Türen öffnet und Wege ebnet.
Das Resultat dieser Ungleichheit ist gravierend. Wer von vornherein keine Gelegenheit erhält, sich emporzuarbeiten, wird selten genug verdienen, um finanzielle Sicherheit zu erlangen oder Vermögen aufzubauen.
Lies auch hier: Randseiter (marginal man) – Ambivalenz des Bildungsaufstiegs
Menschen aus ärmeren Schichten bleiben Positionen wie Professur, Management, Journalismus oder andere höhere Berufe in Deutschland verwehrt – Jobs, für die oft der richtige „Stallgeruch“ und das richtige Beziehungsnetzwerk entscheidend sind. Und so werden Menschen aus den unteren sozioökonomischen Klassen systematisch übersehen, nicht anerkannt und klein gehalten.
Klassismus entsteht im Kopf, so wie alle Vorurteile
In welche gesellschaftliche Schicht Menschen hineingeboren werden, prägt ihr Leben. Die unsichtbaren Barrieren, die in unserem Land die verschiedenen Milieus trennen, sind starr. So bleibt die politische, wissenschaftliche und wirtschaftliche Elite des Landes eine geschlossene Gesellschaft, die ihre Privilegien durch selektive Netzwerke und Beziehungen aufrechterhält.
Diskriminierung aufgrund sozialer Herkunft beeinflusst aber nicht nur die Bildungschancen und Karrierewege, sondern darüber hinaus auch Gesundheit, Rechtslage, Wohnraum, soziale Beziehungen – eigentlich die gesamte Lebensqualität eines Menschen.
Vgl. Armut & Depression: Die gesundheitliche Ungleichheit
Fazit: Diskriminierung aufgrund sozialer Herkunft
Klassismus ist nicht einfach ein Phänomen unter vielen, sondern eine der fundamentalsten Diskriminierungsformen unserer Gesellschaft. Er ist fest in Strukturen, Regeln und Gesetzen verankert, die sich weitreichend auf einen erheblichen Teil der Menschen in Deutschland auswirken.
Es wird Zeit, dass wir ein Bewusstsein dafür erlangen, dass Klassismus immer noch existiert und menschengemacht ist.
#klassismus#diskriminierung#bildungsdiskriminierung#Armutskreislauf#neue armut#working poor#erwerbsarmut#klasse#soziologie#sozioökonomische Faktoren#strukturelle diskriminierung#soziale ungleichheit#ungerechtigkeit#soziale ausgrenzung
0 notes
Text

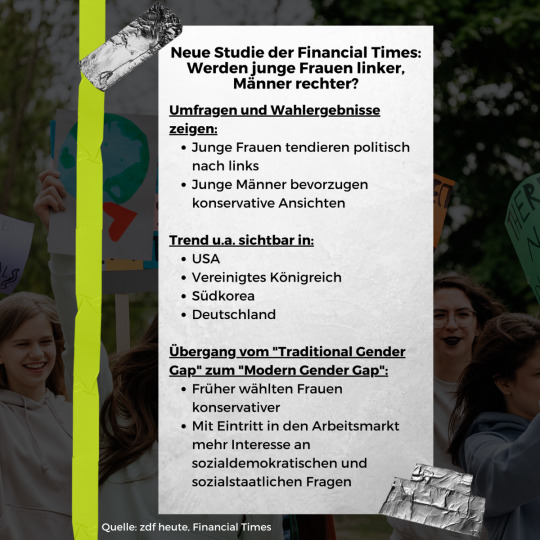

🌍Die politische Landschaft der Jugend wandelt sich, wie eine Analyse der Financial Times zeigt. Die Politikwissenschaftlerin Simone Abendschön betont, dass neben dem Geschlecht auch Bildung, sozioökonomischer Status und weitere Faktoren die Wahlentscheidung beeinflussen. Menschen als vielfältige Individuen zu sehen, ist dabei entscheidend. Quelle: zdf Heute 🤔 Was denkst DU über diesen Trend?
#gendergap#konservativ#liberal#links#rechts#politik#deutschland#gleichberechtigung#feminismus#ngo#npo#talk2move#redenumzubewegen#fundraising#nebenjob#fundraiser#t2m#studentenjob#jobmitsinn
1 note
·
View note
Link
0 notes
Text
größenvergleich menschen cm
🎰🎲✨ Erhalten Sie 500 Euro und 200 Freispiele, plus einen zusätzlichen Bonus, um Casinospiele mit nur einem Klick zu spielen! ✨🎲🎰
größenvergleich menschen cm
Die menschliche Körpergröße wird üblicherweise in Zentimetern gemessen. Die durchschnittliche Körpergröße variiert je nach Land, Ethnie, Geschlecht und anderen Faktoren.
In den meisten entwickelten Ländern liegt die durchschnittliche Körpergröße für Männer zwischen 170 cm und 180 cm, während bei Frauen die durchschnittliche Körpergröße zwischen 160 cm und 170 cm liegt. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dies nur Durchschnittswerte sind und es große individuelle Unterschiede geben kann.
Die Körpergröße wird durch genetische und umweltbedingte Faktoren beeinflusst. Während die Gene einen großen Einfluss auf die Körpergröße haben, können auch Ernährung, Krankheiten und sozioökonomische Bedingungen die Körpergröße beeinflussen. Es ist bekannt, dass eine ausgewogene Ernährung mit ausreichender Zufuhr von Nährstoffen und eine gesunde Lebensweise zur optimalen Entwicklung der Körpergröße beitragen.
Die Körpergröße hat auch eine soziale und psychologische Bedeutung. Menschen, die überdurchschnittlich groß oder klein sind, können sich in bestimmten Situationen anders fühlen oder behandelt werden. In einigen Kulturen wird eine größere Körpergröße als attraktiv angesehen, während in anderen Kulturen kleinere Körpergrößen bevorzugt werden.
Es ist wichtig anzumerken, dass die Körpergröße nicht das gesamte Bild einer Person definiert. Es gibt viele andere Faktoren, die die Gesundheit und das Wohlbefinden beeinflussen. Der Fokus sollte auf einer ganzheitlichen Betrachtung der Gesundheit liegen, die sowohl körperliche als auch psychische Aspekte umfasst.
Insgesamt bietet die menschliche Körpergröße eine interessante Perspektive auf die Vielfalt der Menschen. Es ist faszinierend zu sehen, wie wir alle unterschiedlich geformt und größer sind und dennoch Teil derselben Spezies sind.
Die durchschnittliche Körpergröße von Männern variiert je nach Land und ethnischer Zugehörigkeit. In Deutschland beträgt die durchschnittliche Körpergröße eines erwachsenen Mannes etwa 180 cm. Dieser Durchschnittswert kann jedoch je nach Region leicht variieren.
Es wurde festgestellt, dass die genetische Veranlagung und die Umweltfaktoren eine Rolle bei der Bestimmung der Körpergröße spielen. Während die genetische Veranlagung den Grundstein für das Wachstum legt, können Umweltfaktoren wie Ernährung, Lebensstil und Krankheiten ebenfalls einen Einfluss auf die endgültige Größe haben.
Im Allgemeinen haben europäische Länder tendenziell eine etwas höhere durchschnittliche Körpergröße als asiatische Länder. Zudem gibt es innerhalb Europas Unterschiede, wobei skandinavische Länder im Durchschnitt die größten Männer haben.
Die durchschnittliche Körpergröße von Männern hat sich im Laufe der Zeit verändert. Frühere Generationen waren im Durchschnitt oft kleiner als heutige Männer. Dies wird teilweise auf verbesserte Ernährung und Gesundheitsversorgung zurückgeführt.
Es ist wichtig anzumerken, dass der Durchschnittswert lediglich eine allgemeine Angabe ist und individuelle Unterschiede vorhanden sein können. Nicht jeder Mann erreicht die durchschnittliche Körpergröße, und das ist völlig normal.
Die durchschnittliche Körpergröße von Männern ist eine interessante Statistik, die Einblicke in die Variabilität der menschlichen Körpergröße gibt. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die Körpergröße nicht das einzige Maß für Attraktivität oder Gesundheit ist. Jede Person ist einzigartig und sollte in ihrer eigenen Haut wohl fühlen, unabhängig von ihrer Größe.
Das Verhältnis der Körpergrößen zwischen Männern und Frauen ist ein interessantes Thema, das seit Langem Gegenstand von Untersuchungen und Diskussionen ist. Es gibt allgemein bekannte Unterschiede zwischen den durchschnittlichen Körpergrößen von Männern und Frauen, jedoch gibt es auch individuelle Abweichungen, die von vielen Faktoren abhängen.
Grundsätzlich sind Männer im Durchschnitt größer als Frauen. Dies liegt zum Teil an genetischen Faktoren, da die meisten Männer aufgrund von Hormonen, insbesondere Testosteron, während der Pubertät einen Wachstumsschub erleben. Dies führt häufig dazu, dass Männer im Erwachsenenalter im Durchschnitt größer sind als Frauen.
Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass die Körpergröße nicht das einzige Indiz für Attraktivität oder Geschlechtsmerkmale ist. Es gibt viele andere Aspekte eines Individuums, die zur Anziehungskraft beitragen, wie zum Beispiel Persönlichkeit, Ausstrahlung und Intelligenz.
Es ist auch wichtig zu betonen, dass das Verhältnis der Körpergrößen zwischen Männern und Frauen nicht gleichbedeutend mit biologischer Geschlechtsidentität ist. Geschlecht ist ein komplexes Thema, das sowohl biologische als auch soziale und kulturelle Faktoren umfasst.
Im Zusammenhang mit dem Verhältnis der Körpergrößen zwischen Männern und Frauen ist es auch wichtig zu bedenken, dass Schönheitsstandards und soziale Erwartungen an Attraktivität von Kultur zu Kultur variieren können. Was in einer Kultur als attraktiv angesehen wird, kann in einer anderen Kultur anders bewertet werden.
Insgesamt ist das Verhältnis der Körpergrößen zwischen Männern und Frauen ein komplexes Thema, das von vielen Faktoren beeinflusst wird. Es ist wichtig, über diese Unterschiede zu sprechen und sie in einem breiteren Kontext zu betrachten, der die Vielfalt und Komplexität der menschlichen Natur widerspiegelt.
Größenunterschiede bei verschiedenen Altersgruppen
Größe ist ein Merkmal, das sich im Laufe der Zeit verändert und von verschiedenen Faktoren wie genetischen, Umwelt- und Ernährungseinflüssen beeinflusst wird. Insbesondere bei verschiedenen Altersgruppen gibt es auffällige Unterschiede in Bezug auf die Körpergröße. In diesem Artikel werden wir uns mit den Größenunterschieden bei verschiedenen Altersgruppen befassen.
Bei Neugeborenen ist die durchschnittliche Körpergröße in der Regel zwischen 45 und 55 Zentimetern. Im ersten Lebensjahr wachsen Babys besonders schnell und können innerhalb dieses Zeitraums bis zu 25 Zentimeter an Körpergröße gewinnen. Während der Kindheit geht das Wachstum in einem langsameren Tempo weiter, wobei Kinder im Alter von 6 Jahren im Durchschnitt etwa 120 Zentimeter groß sind.
Während der Pubertät erleben sowohl Mädchen als auch Jungen einen weiteren Wachstumsschub. Mädchen beginnen normalerweise im Alter von 10 bis 11 Jahren zu wachsen und erreichen ihre maximale Wachstumsgeschwindigkeit zwischen 12 und 14 Jahren. Im Durchschnitt werden sie in diesem Zeitraum etwa 20 Zentimeter größer. Jungen beginnen ihren Wachstumsschub normalerweise etwas später, im Alter von etwa 12 Jahren, und erreichen ihre maximale Wachstumsgeschwindigkeit zwischen 14 und 16 Jahren. Im Durchschnitt können Jungen in dieser Zeit etwa 25 Zentimeter an Körpergröße gewinnen.
Nach der Pubertät verlangsamt sich das Wachstum allmählich und die meisten Menschen erreichen ihre endgültige Größe im Alter von 18 bis 20 Jahren. Es ist wichtig anzumerken, dass individuelle Unterschiede bei der Körpergröße auch von genetischen Faktoren abhängen. In einigen Fällen können Menschen auch nach der Pubertät noch etwas wachsen, jedoch nur in geringem Maße.
Zusammenfassend lassen sich also signifikante Größenunterschiede bei verschiedenen Altersgruppen beobachten. Vom Neugeborenenalter bis zur Kindheit, Pubertät und Erwachsenenalter gibt es verschiedene Phasen des Wachstums, in denen sich die Körpergröße deutlich verändert. Diese Unterschiede sind normal und Teil des natürlichen Entwicklungsprozesses eines jeden Menschen.
Die Körpergröße von Menschen wird von verschiedenen Einflussfaktoren bestimmt. Obwohl die Genetik eine entscheidende Rolle spielt, gibt es auch andere Faktoren, die das Wachstum und die Körpergröße beeinflussen können. Hier sind fünf wichtige Einflussfaktoren:
Genetik: Die vererbten Gene sind der wichtigste Faktor für die Körpergröße. Kinder erben ihre genetische Veranlagung von ihren Eltern, insbesondere von den Eltern, die in der Familie die größte Körpergröße haben. Dies erklärt, warum Kinder oft ähnliche Körpergrößen wie ihre Eltern haben.
Ernährung: Eine ausgewogene Ernährung spielt eine wichtige Rolle beim Wachstum und der Körpergröße. Viele Nährstoffe wie Protein, Kalzium und Vitamin D sind für das Knochenwachstum unerlässlich. Eine ausreichende Menge dieser Nährstoffe in der Ernährung kann dazu beitragen, das Wachstum zu fördern.
Hormone: Hormone wie Wachstumshormone und Schilddrüsenhormone spielen eine Schlüsselrolle bei der Regulierung des Wachstums. Ein Ungleichgewicht dieser Hormone kann zu einer unzureichenden Produktion von Wachstumshormonen führen und das Wachstum beeinträchtigen.
Lebensstil: Ein aktiver Lebensstil mit regelmäßiger körperlicher Aktivität kann das Wachstum und die Körpergröße unterstützen. Bewegung regt das Wachstum der Knochen an und hilft dabei, eine gesunde Körperhaltung zu entwickeln.
Gesundheitszustand: Krankheiten und Gesundheitsprobleme können das Wachstum beeinflussen. Einige Erkrankungen wie Kleinwuchs oder Gendefekte können zu einer reduzierten Körpergröße führen. Eine gute allgemeine Gesundheit ist wichtig, um das optimale Wachstum zu fördern.
Es ist wichtig zu beachten, dass die Körpergröße von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist und durch eine Kombination verschiedener Einflussfaktoren beeinflusst wird. Es ist nicht immer möglich, die Körpergröße zu verändern, da die genetische Veranlagung den größten Einfluss hat. Dennoch können eine gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung und eine gute allgemeine Gesundheit dazu beitragen, das optimale Wachstum zu fördern.
0 notes
Text
Ehestress kann die Genesung junger Erwachsener nach einem Herzinfarkt beeinträchtigen Eine stressige Ehe kann sich negativ auf die Genesung nach einem Herzinfarkt auswirken. Ehestress bei jüngeren Erwachsenen (im Alter von 18–55 Jahren) war mit einer schlechteren Genesung nach einem Herzinfarkt verbunden. Diese negativen Auswirkungen änderten sich nach Berücksichtigung demografischer und sozioökonomischer Faktoren wie Bildung, Beschäftigung, Einkommen und Krankenversicherungsstatus nicht wesentlich, so eine vorläufige Studie, die auf den Scientific Sessions 2022... #Ausbildung #Betonen #BLUT #chronisch #Chronische_Erkrankung #Die_Ehe #Epidemiologie #Forschung #Gesundheitspflege #Gesundheitsvorsorge #Gesundheitswesen #Herz #Herzinfarkt #Herzkrankheit #Krankenhaus #Krankenversicherung #Medizin #OKT #pH_Wert #Psychische_Gesundheit #Schmerzen #Sexuelle_Beziehung #Streicheln #Umweltverschmutzung #Weltweite_Gesundheit
#Medical_Condition_News#Medical_Research_News#News#Ausbildung#Betonen#BLUT#chronisch#Chronische_Erkrankung#Die_Ehe#Epidemiologie#Forschung#Gesundheitspflege#Gesundheitsvorsorge#Gesundheitswesen#Herz#Herzinfarkt#Herzkrankheit#Krankenhaus#Krankenversicherung#Medizin#OKT#pH_Wert#Psychische_Gesundheit#Schmerzen#Sexuelle_Beziehung#Streicheln#Umweltverschmutzung#Weltweite_Gesundheit
0 notes
Text
Studie: Körpergröße erhöht Risiko für bestimmte Krankheiten
dpa-Wissenschaftsmeldung
Ob groß oder klein: Die Körpergröße eines Menschen erhöht das Risiko für bestimmte Krankheiten. Das berichten US-Forscher im Fachblatt PLOS Genetics. Dabei spielen nicht nur die Gene eine Rolle, sondern auch sozioökonomische Faktoren und vor allem die Umwelt, wie ein deutscher Experte betont.
Weiterlesen bei Berliner Zeitung
Weiterlesen bei Spiegel Online
0 notes
Photo

Freitag, 14. Januar 2022 Erst in Berlin, dann bundesweit Wie Neukölln zum Omikron-Vorboten wurde Von Sebastian Schneider Nach Bremen ist Neukölln der zweite deutsche Omikron-Hotspot. Die Fallzahlen explodieren in dem Berliner Bezirk, die Behörden stoßen an ihre Grenzen. Die Dynamik wird sich wohl bald auch bundesweit zeigen - auch weil Neukölln in der Pandemie bisher immer ein Vorbote war. Es passiert nicht zum ersten Mal, dass sich eine Corona-Welle in Deutschland zuerst in Neukölln zeigt. Im Oktober 2020 stiegen in dem Berliner Bezirk die Fallzahlen, bevor sie es im Rest des Landes taten, und kündigten so die zweite Welle an. Auch wenn es kurz nach Jahresbeginn zunächst Bremen war, das zum ersten Omikron-Hotspot wurde, ließ der rapide Anstieg der Fallzahlen in Neukölln nicht lange auf sich warten. In dem Berliner Bezirk liegt die Inzidenz inzwischen bei 1374, am Donnerstag vor einer Woche war sie noch bei 545. Damit ist Neukölln aber nicht alleine. In Friedrichshain-Kreuzberg ist die Entwicklung ebenso sichtbar: Von 399 am vergangenen Donnerstag steigt die Inzidenz dort am heutigen Freitag auf 1521. Beide verbindet eine Gemeinsamkeit: Sie zählen zu den am dichtesten besiedelten Berliner Bezirken. Auch wenn sich der Fallanstieg in Neukölln nicht an einem "pauschalen Grund" festmachen ließe, erkennt Bezirksbürgermeister Martin Hikel ein Muster. "Wir können in unseren Auswertungen sehen, dass in den Quartieren, wo die Bevölkerungsdichte sehr hoch ist, die Inzidenzzahlen wesentlich höher sind als in den Bereichen, wo die Bevölkerungsdichte geringer ist", sagte der SPD-Politiker am Dienstag im RBB. In diesen Quartieren lebten nicht nur viele Jüngere, sondern "auch viele Menschen, die mit einem kleinen Einkommen leben und eher viele Menschen in kleinen Wohnungen, also die sozialen Verhältnisse nicht zwingend die besten sind", erklärte Hikel. Und vor allem Menschen, die es sich nicht leisten könnten, "mit einer größeren Familie in einer Sechs-Zimmer-Wohnung oder einem Einfamilienhaus zu leben", so der Bezirksbürgermeister. "Da infiziert man sich einfach schneller" Ähnliches berichtete auch der Sprecher des Neuköllner Bezirksamts, Christian Berg, gegenüber t-online.de. Er sprach von "großen Familien in kleinen Räumen". "Bei sechs, sieben oder acht Haushaltsmitgliedern in drei Räumen - da infiziert man sich einfach schneller. Isolieren ist nicht möglich." Zudem könnte bei manchen auch die Sprachbarriere ein Problem sein, sagte Berg. 44 Prozent der knapp 330.000 Neuköllnerinnen und Neuköllner haben laut der offiziellen Statistik einen Migrationshintergrund, der Bezirk beheimatet Menschen aus über 160 Nationen. In öffentlichen Debatten spielt der Migrationshintergrund häufig eine Rolle. Für die Wissenschaft ist das keine Erklärung. Das sieht auch der Neuköllner Amtsarzt, Nicolai Savaskan, so. "Was wir durchweg in allen vier Wellen sehen - wenn Sie Daten erheben zu migrantischer Bevölkerung und die sauber normalisieren zu Faktoren wie Geschlecht, Alter, sozioökonomischer Status, Bildungsstatus - dass die eigentlichen Kernzahlen für Erkrankungen sich in zwei Punkten kristallisieren: Der eine ist ganz klar Einkommensverhältnisse und der zweite Punkt ist ganz klar Bildungsstatus", sagte der Mediziner im Dezember im Deutschlandfunk Kultur. Verantwortlich für ein erhöhtes Infektionsrisiko ist somit nicht der migrantische Hintergrund, sondern die Lebensumstände. Wenn große Familien beengt auf kleinem Wohnraum leben müssen, weil sie sich mehr nicht leisten können, ist dort nicht viel Platz für Quarantäne und Isolation. Analysen des Robert-Koch-Instituts mit den Daten der zweiten Welle zeigten, dass die Sterblichkeit in sozial stark benachteiligten Regionen um rund 50 bis 70 Prozent höher ist als in Regionen mit geringer sozialer Benachteiligung. Das ist auch in Neukölln der Fall. "Die sozioökonomischen Verhältnisse sind nicht durchgängig genauso gut wie in anderen Bezirken. Das heißt kleinere Wohnungen mit größeren Familien, wenig Ausweichmöglichkeiten, keine Homeoffice-Möglichkeiten, weil die Tätigkeit es nicht zulässt", sagte Bezirksbürgermeister Hikel. "Das sind Parameter, die dazu führen, dass die Infektionszahlen in Bezirken wie Neukölln sehr steil nach oben gehen." Erst Neukölln, dann bundesweit Dass sich die hohen Infektionszahlen auf andere Kreise ausbreiten, ist nur eine Frage der Zeit. Das ist zumindest die Erwartung des Bezirksamtssprechers Berg. "Wir sind einfach nur früher dran. Neukölln ist nur der Vorbote. Was wir hier sehen, gibt es bald in ganz Berlin." Er rechnet schon bald mit 2000er-Inzidenzen. Auch Bürgermeister Hikel erwartet, dass sich das Infektionsgeschehen weiter ausbreitet - und dass "Neukölln traurigerweise dort zuerst dran gewesen ist". In der zweiten Welle war es so, dass ab Oktober 2020 die Fallzahlen in Neukölln für Vor-Omikron-Verhältnisse explodierten. Zwölf Tage lang war es der Kreis mit der bundesweit höchsten Inzidenz. Am 15. Oktober lag der Wert bei 170, am 3. November bei 325. Es dauerte jedoch nicht lange, bis sich die Dynamik auch in anderen Bezirken zeigte. Ende November wiesen acht der zwölf Berliner Bezirke eine Inzidenz von über 200 auf. Später war es die bayerische Grenzregion um Passau sowie das thüringische Hildburghausen und das sächsische Bautzen, die die bundesweite Hotspot-Liste anführten. Nun ist die deutlich ansteckendere Omikron-Variante da. Spätestens sie hat die Pandemiebekämpfung verändert - damit auch die Arbeit der Gesundheitsämter. Seit Monaten arbeiten sie an der Belastungsgrenze. Das Aufspüren von Infektionsketten, das in den ersten Wellen wichtig war, ist mit den heutigen Zahlen nicht mehr möglich. Neukölln hat deshalb bereits vor Wochen die Kontaktverfolgung angepasst. Es wird priorisiert. Im Fokus stehen vor allem Menschen, die älter als 69 Jahre alt sind, Menschen in Pflegeeinrichtungen und Minderjährige in Kitas, Schulen und anderen Bildungseinrichtungen - und Omikron-Fälle. Der Rest wird per Mail oder Brief kontaktiert. Doch auch das ist keine ausreichende Entlastung. Am Donnerstag warnte die Behörde auf Twitter, dass es bis zu fünf Tage dauern könnte, bis sie sich bei positiv Getesteten meldet. Die Omikron-Welle zeigt sich inzwischen auch im Rest der Stadt wie etwa in Mitte (Inzidenz 1192) oder Reinickendorf (1156). Auch Berlins Gesundheitssenatorin Ulrike Gote rechnet damit, dass sich die Variante weiter ausbreitet. "Wir werden kurzfristig die 1000er-Inzidenz überschreiten", sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Das könnte dann für neue Probleme sorgen, vor allem in der Testinfrastruktur. "Wir haben hohe Testkapazitäten und Labore bauen ihre Kapazitäten weiter aus. Das hätte für Delta gereicht, für Omikron reicht das nicht."
0 notes
Text
Der Wert der Fischanlandungen in Laâyoune erreichte im ersten Semester mehr als 720,5 MDH (ONP)

El Marsa-Der Wert der Fischanlandungen im Hafen von Laâyoune erreichte im ersten Halbjahr 2021 mehr als 720,58 Millionen Dirham, ein Anstieg von 4% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres, den Daten des Nationalen Fischereiamtes (ONP) zufolge.
Dieser Anstieg wurde ungeachtet des Rückgangs der Anlandungen von maritimen Produkten auf 80.375 Tonnen im ersten Halbjahr 2021 gegenüber 128.993 Tonnen ein Jahr zuvor erreicht, erklärte der Regionaldirektor des Nationalen Fischereiamts in Laâyoune (ONP), Khatari Ezaroili.
Er schob nach, dass der Rückgang der Anlandungen, im Besonderen bei pelagischen Fischen, hauptsächlich auf die schlechten Wetterbedingungen in diesem Zeitraum zurückzuführen sei.
Auf der anderen Seite verzeichneten die Anlandungen von Weißfischen, Kopffüßern und Krustentieren in der ersten Hälfte dieses Jahres einen deutlichen Anstieg um 21% auf 22.228 Tonnen gegenüber 18.427 Tonnen im gleichen Zeitraum des Vorjahres, ließ Herr Ezaroili bemerken.
Laut ihm hatte die Zunahme dieser Anlandungen einen positiven Einfluss auf den Umsatz dieser Fischart, der innerhalb eines Jahres um 30% auf über 506,76 Millionen Dirham angestiegen ist.
Der Direktor des ONP in Laâyoune unterstrich, dass der Seefischereisektor als einer der Hauptmotoren des sozioökonomischen Wachstums in Laâyoune-Sakia El Hamra, einer Region mit enormem maritimen Potenzial, angesehen wird und dass dieser Sektor der erste Arbeitgeber in der Region dank der Schaffung von Tausenden von direkten, aber auch indirekten Arbeitsplätzen ist.
Dies beinhaltet die Einstellung von Seeleuten für Handwerks-und-Küstenfischereifahrzeuge sowie die Einstellung von Arbeitskräften für die Meeresfrüchte-Entwicklungseinheiten und für andere verwandte Industrien in der Gemeinde El Mersa, wo sich der Hafen von Laâyoune befindet, fuhr er fort.
Herr Ezaroili verweist darauf, dass dieser herausragende Platz, den der Seefischereisektor jetzt in der sozioökonomischen Dynamik einnimmt, das Ergebnis der Anstrengungen des Staates zur Schaffung groß angelegter Infrastrukturen zur Förderung dieser maritimen Produkte ist, insbesondere die Entwicklung der Häfen von Laâyoune, Boujdour, Tarfaya, Dakhla und Lamhiriz.
Es geht überdies um den Aufbau von Fischmärkten der neuen Generation, die mit den modernsten Geräten und Technologien ausgestattet sind, um die Einhaltung internationaler Normen und Standards in diesem Bereich zu gewährleisten, um die Wettbewerbsfähigkeit der Fischprodukte der Region zu fördern, an die Gründung von Fischerdörfern erinnernd, die durch die Förderung ihres Einkommens zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Seeleute beigesteuert haben.
Diese Faktoren machen den Hafen von Laâyoune zur führenden nationalen maritimen Plattform in Bezug auf das Volumen der Fischanlandungen, im Besonderen für die handwerkliche Fischerei und Küstenfischerei, aber auch in Bezug auf den Umsatz, stellte der Regionaldirektor des ONP fest.
Er gab an, dass die in 2020 im Hafen von Laâyoune vermarkteten Küstenfischereiprodukte und handwerklichen Fischerei 25 % des Volumens der Fischanlandungen auf nationaler Ebene und 23 % ihres Wertes ausmachen.
Diese Entwicklung habe sich positiv auf die Einnahmen der Gemeinde El Mersa ausgewirkt, die sich im Laufe der Jahre zu einem wichtigen Wirtschaftszentrum entwickelt habe, das mehr Investitionen für die Region anziehe, stellte er die Behauptung auf.
Herrn Ezaroili nach haben diese Einnahmen es der Gemeinde El Mersa bewerkstelligt, in den letzten Jahren sozioökonomische Vorzeigeprojekte im Zusammenhang mit der Modernisierung ihrer städtischen Infrastrukturen und der Verbesserung des Lebensumfelds der Einwohner dieser Gemeinde durchzuführen.
Quellen:
http://www.corcas.com
http://www.sahara-online.net
http://www.sahara-culture.com
http://www.sahara-villes.com
http://www.sahara-developpement.com
http://www.sahara-social.com
0 notes
Text
Fach Artikel
Beitrag auf wissenschaftlicher Basis Forschungen belegen seit Jahren, dass Migranten und ihre Nachkommen seltener wählen und sich weniger politisch engagieren als Menschen ohne Migrationshintergrund. Die Wahlbeteiligung von Deutschen mit Migrationsgeschichte lag bei der Bundestagswahl 2018 bis zu 20 Prozentpunkte unter der der Gesamtbevölkerung.
Doch politische Partizipation und die politische Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund findet nur geringe öffentliche Aufmerksamkeit. Es gibt viele Studien über die Integration und die humanitäre Hilfe aber es gibt nur wenige Studien über das politische Verhalten und die Einstellungen von Deutschen mit Migrationshintergrund und in Deutschland lebenden Ausländern.Die aktuelle Studie “Politische Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland” von Stephanie Müssig analysiert Unterschiede in der politischen Partizipation zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund in Deutschland.Müssig ist die Stellvertretende Geschäftsführerin der zentralen wissenschaftlichen Einrichtungen der Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg.
Sie betrachtet genauer, welche Faktoren politische Teilhabe beeinflussen. Aus welchen Gründen engagieren sich Menschen mit Migrationshintergrund politisch? Und was hält sie davon ab, politisch aktiv zu werden?Um diese Frage zu beantworten hat Müssig die Daten von Migranten aus über 100 Ländern und ihren Nachkommen ausgewertet. Im Gegensatz zu anderen Studien, entwickelte sie eine genauere Einteilung der verschiedenen Lebensrealitäten von Menschen mit Migrationshintergrund.
Sie unterscheidet dabei vier verschiedene Klassifikationen (unterschieden durch die Aufenthaltsdauer und den Aufenthaltstitel). Neben diesen Faktoren versucht sie auch sozioökonomische und kulturelle Faktoren in ihre Analyse einzubeziehen.Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund sei gegenüber der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund ökonomisch und sozial im Nachteil. Sie sei im Durchschnitt ärmer und weniger gebildet. Deshalb würden sie ihre Möglichkeiten zur politischen Partizipation seltener ausschöpfen. Außerdem kommt sie zu dem Schluss, dass Menschen mit Migrationshintergrund mit zwei zugewanderten Elternteilen bei der Wahlbeteiligung deutlich seltener partizipieren als Nachkommen von Migranten mit nur einem zugewanderten Elternteil und als Personen ohne Migrationshintergrund.Das deutet laut Müssig darauf hin, dass die politische Partizipation gelingt, wenn wenigstens ein Familienmitglied über das passende Wissen zu politischen Inhalten und Prozessen verfügt.
Abgesehen davon, in welchem Land diese Person ihre Wurzeln hat. Unabhängig davon, ob in diesem Land ein autoritäres oder ein demokratisches Regime herrscht.Müssig schließt daraus, dass “das demokratische Zusammenleben in Deutschland so gestaltet werden muss, dass ungleiche Startbedingungen zu Beginn des Lebens frühzeitig ausgeglichen werden müssen, um politischer Ungleichheit im Lebensverlauf entgegenzuwirken.” Nur so könne politische Gleichheit in Deutschland erreicht werden.
0 notes
Text
Hormone und Brustkrebs

Neben dem heftig umstrittenen Mammographie-Screening sorgt im Zusammenhang mit Brustkrebs und dessen Risken eine weitere Frage permanent für Diskussion und schürt Ängste bei Frauen: die Frage nach dem Sinn oder Unsinn einer Hormonersatztherapie im Klimakterium. Gerade in den vergangenen Jahren wurde durch die Ergebnisse einiger großer Studien der Benefi t dieser Behandlung immer wieder in Frage gestellt und die ganze Thematik sehr stark emotionalisiert. Daher lohnt sich ein kritischer Blick auf dieses Problem nicht nur im Zusammenhang zwischen Brustkrebs und Hormonen, sondern auch darüber hinaus. Die steigende Lebenserwartung selbst ist ein permanent größer werdender Risikofaktor für viele Leiden. Die Entstehung etlicher Krankheiten im fortgeschrittenen Alter ist aber auch bis zu einem gewissen Grad genetisch vorprogrammiert. Dazu gehören kardiovaskuläre Erkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall (Apoplexie), Osteoporose und Demenz. Ihr Krankheitsbeginn und damit ihre Konsequenzen für Morbidität (Krankheitsstand) und Mortalität (Sterblichkeitsziffer) lässt sich durch Lebensgewohnheiten wie etwa Essverhalten, körperliche Aktivität und ähnliches mehr zum Teil günstig, aber ebenso auch negativ beeinfl ussen. Es wird immer wichtiger, diese Zusammenhänge zu erkennen. Denn in der heutigen Gesellschaft ist nicht allein das Altwerden selbst gefragt, sondern vielmehr ein Altern in guter Qualität, also in körperlicher und geistiger Frische und, wenn es sich dann machen lässt, auch noch bei jugendlichem Aussehen. Es geht also zusehends um eine Kompression der Morbidität im Alter – das heißt, es geht darum, den Zeitraum des Krankseins vor dem Tod möglichst kurz zu halten. Eine hohe Lebensqualität ist auch in den späten Jahren gefragt. Es sollte daher Ziel sein, das Alter in guter Qualität und Gesundheit sowohl körperlich als auch geistig zu erleben. Dies sollte nicht nur ein medizinisch-humanistisch geprägter Wunsch sein, sondern auch eine Grundvoraussetzung, die rasch steigende Kostenexplosion in der Medizin, zum Teil bedingt durch die immer aufwendigere medizinische Versorgung einer zunehmend älter werdenden Bevölkerung, in den Griff zu bekommen. Hier sei darauf hingewiesen, dass heute bereits für eine 65-jährige Frau jährlich rund fünfmal mehr rezeptpfl ichtige Medikamente verschriebenen werden, als für eine 25-jährige. Dies trifft annähernd auch für Männer dieser Altergruppen zu. Vorsorgemedizin und nicht Reparaturmedizin wird in Zukunft immer mehr gefragt sein. Eine individuelle, richtig durchgeführte Hormonersatztherapie über einige Jahre hindurch, die eine Verkürzung der immer länger dauernden hormoninaktiven Zeit in der zweiten Lebenshälfte darstellt, kann für die Frau daher durchaus ein zielführender Weg in diese Richtung sein. Dazu gehört natürlich ebenso die Risikoabwägung und Risikominimierung den Brustkrebs betreffend. Auf Grund der geänderten Lebensbedingungen in der industrialisierten westlichen Welt werden die Menschen zunehmend älter, was zu einer sich deutlich ändernden Gesellschaftsstruktur führt. Immer mehr Menschen befi nden sich in der zweiten Lebenshälfte, bei sinkender Kinderzahl. Dies bedingt in vielen Lebensbereichen, darunter auch in der Gesundheitsvorsorge und in der Medizin, eine intensive Auseinandersetzung mit diesem Lebensabschnitt. Das trifft besonders auf Frauen zu, die in der westlichen Welt ein um etwa sechs bis acht Jahre höheres Lebensalter als Männer erreichen. Betrug das Lebensalter am Ende des 18. Jahrhunderts noch knapp über fünfzig Jahre, so ist es bis heute auf knapp 82 Jahre angestiegen, wobei die Frau rund ein Drittel dieser Zeit ohne Hormonproduktion in der Menopause beziehungsweise in der Postmenopause verbringt, was verschiedene Beschwerden und Erkrankungen verursachen beziehungsweise fördern kann. Die ständig verbesserten sozialen Umstände, die rasante Entwicklung der Medizin und die zunehmend bessere Ernährung sind im Wesentlichen für das zunehmend hohe Alter verantwortlich. Man kann durchaus behaupten: Die steigende Lebenserwartung ist kein natürlicher biologischer Vorgang, sondern wird von äußeren Faktoren bestimmt. Wenn man in die Dritte Welt, in die so genannten Entwicklungsländer blickt, dann hat sich die Lebenserwartung dort in den vergangenen Jahrzehnten nur geringfügig verändert oder ist sogar gleich geblieben. Sie liegt auch heute noch zwischen 51und 56 Jahren, abhängig von den einzelnen Ländern, also ungefähr dort, wo die Lebenserwatung in Europa noch vor 150 Jahren lag. In Asien liegt die durchschnittliche Lebenserwartung in den besser entwickelten Ländern noch immer rund zehn Jahre unter der der westlichen Welt. Ausnahme ist das wirtschaftlich hoch entwickelte Japan, das weltweit die höchste Lebenserwartung hat, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern.

Das Menopausenalter, das im Gegensatz zur Lebenserwartung (noch) nicht von äußeren Faktoren beeinfl usst werden kann, hat sich in den vergangenen 2000 Jahren biologisch nur geringfügig, nämlich lediglich um rund fünf Jahre verschoben. Es liegt im Durchschnitt derzeit zwischen 51 und 52 Jahren. Der Zeitraum der Postmenopause ist also im Vergleich zu früher erheblich länger geworden, dies kann aber nicht als natürlicher physiologischer Prozess angesehen werden. Das heißt, durch die heutige Lebenserwartung der Frau von rund 82 Jahren in der westlichen Welt lebt sie in der Postmenopause noch rund 30 Jahre ohne Sexualhormonproduktion, besonders ohne Östrogene. Biologisch gesehen ein durch den technischen Fortschritt herbeigeführtes Novum, denn die Natur kennt nur bei ganz wenigen Tierspezies überhaupt eine Menopause, aber niemals in dieser Länge. Allein von diesem Gesichtpunkt aus ist neben dem medizinischen Aspekt die Frage nach einer Substitution, nach einem Ersatz der verloren gegangenen Hormone in der künstlich verlängerten Menopause zu diskutieren. Die Menopause kann, muss aber nicht zu klimakterischen Beschwerden und metabolischen Störungen wie zum Beispiel einer Osteoporose führen. Der Östrogenmangel löst jedoch bei etwa 70 bis Prozent aller Europäerinnen mehr oder weniger ausgeprägte klimakterische Beschwerden aus, die eine medikamentöse Behandlung notwendig machen können, um eine entsprechende Lebensqualität und Leistungsfähigkeit der Frau in diesem Lebensabschnitt zu erhalten. Steroidhormone, Östrogene, Progesteron und Androgene sind nicht nur aber eben auch in diesem Lebensabschnitt mitentscheidend für Wohlbefi nden, Lebensqualität und gesunden Stoffwechsel. Natürlich gab es immer schon sehr alte Menschen, aber wesentlich weniger als heute. Und diese haben wahrscheinlich auch damals ebenso sämtliche Probleme des langen hormonfreien Lebensabschnitts gekannt. Nur zum Vergleich: Im 17. Jahrhundert haben nur etwa 17 Prozent der Frauen die Wechseljahre erreicht und danach wenige Jahre in der Postmenopause gelebt. Heute erreichen in den industrialisierten Ländern rund 95 Prozent der Frauen das Wechselalter und haben dann noch eine Lebenserwartung von bis zu 30 Jahren. Übrigens zeigt das Klimakterium im zeitlichen Auftreten nur geringe ethnische und rassische Unterschiede. So liegt das Menopausenalter in den USA von Weißen und Schwarzen nur unwesentlich auseinander. Allerdings werden sozioökonomische Unterschiede diskutiert: Frauen mit niedrigem Sozialstatus und niedrigem Einkommen kommen früher in die Menopause als Frauen mit höherem Sozi- 86 alstatus. Ebenso scheinen Unterschiede sowohl im Menarchealter (die Zeit der ersten Menstruation) als auch im Menopausenalter zwischen Entwicklungsländern und westlichen Industrienationen zu bestehen. Auf Grund besserer Ernährung kommt es in den Industrienationen neben einem größeren Körperwachstum auch zu einem früheren Auftreten der Menarche und etwas späteren Eintritt der Menopause. Andererseits spielen aber auch die geänderten Lebensgewohnheiten der westlichen Hemisphäre zunehmend eine negative Rolle in der Beeinfl ussung des Menopausenalters. So konnte in Studien nachgewiesen werden, dass erhöhter Nikotinkonsum das Menopausenalter um bis zu zwei Jahre früher eintreten lässt. Das Nikotin bewirkt eine stärkere Gefäßveränderungen in den Eierstöcken (Ovarien), was zu einem verminderten Sauerstofftransport dorthin führt. Durch die so hervorgerufene Minderdurchblutung kommt es zu einer eingeschränkten Östrogenproduktion in den Eierstöcken. Zusätzlich wird durch andere Inhaltsstoffe der Zigaretten die Entwicklung dieses Hormons (die so genannte Aromatisierung von Androgenen als Östrogenvorläufer) gehemmt. Durch all diese Faktoren kommt es jedenfalls zu einer verringerten Produktion des Sexualhormons, was auch als Ursache des erhöhten Osteoporoserisikos von Raucherinnen angesehen werden kann. Die Möglichkeit, im Wechsel von außen Hormone zuzuführen und damit Beschwerden, die durch den Hormonmangel hervorgerufen werden, zu beseitigen, hat Lebensqualität, Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit von Frauen in der Menopause und Postmenopause entscheidend verbessert und darüber hinaus auch das Bild der postmenopausalen Frau in der Gesellschaft stark verändert. Es gibt sowohl in den skandinavischen Ländern als auch zum Teil in Deutschland Untersuchungen, die zeigen, dass die Leistungsfähigkeit von Frauen unter Hormonersatztherapie deutlich höher ist, als von Frauen ohne Therapie. Ebenso sind die Krankenstände von Frauen ohne Therapie deutlich höher. Für viele Frauen ist der Verzicht auf eine Hormonersatztherapie mit einem nicht unerheblichen Verlust an Lebensqualität und Wohlbefi nden verbunden. Obwohl es heutzutage eine sehr breite Palette von Hormonpräparaten in den verschiedensten Verabreichungsformen gibt, die es dem erfahrenen Spezialisten ermöglichen, eine individuelle Hormonersatztherapie adäquat und sinnvoll mit größtmöglichem Erfolg und minimalstem Risiko durchzuführen, sind viele Frauen verunsichert. Was umso tragischer ist, als auch die mangelnde Auseinandersetzung mit dem Spezialgebiet der Endokrinologie und mit den Bedürfnissen und Wünschen der Frau dazu führt,

dass selbst von ärztlicher Seite den Frauen nur wenig Hilfestellung gegeben wird. Das führt dazu, dass viele Frauen von einer Hormonsubstitution absehen oder eine bereits durchgeführte Behandlung kurzfristig wieder abbrechen. Hinzu kommen irrationale Ängste, Unwissenheit über die Hormone und deren Wirkungsmechanismen, Angst vor unbekannten Risken, öffentlich geschürter Krebsangst und Furcht vor möglichen Nebenwirkungen wie etwa ein Wiederauftreten von Blutungen oder Gewichtsprobleme. Gerade hier müsste der Arzt oder die Ärztin aufklärend eingreifen und somit den Frauen das Verständnis und die Sicherheit für die Therapie geben, beziehungsweise Ängste abbauen helfen, und nach einer qualifi zierten Risikoabschätzung im gegebenen Fall natürlich auch von einer solchen Therapie abraten. Die positiven Effekte einer richtig durchgeführten individuellen und zeitlich begrenzten Hormonersatztherapie überwiegen im Generellen die möglichen Gefahren durch eine geringe Erhöhung des Brustkrebsrisikos. Voraussetzung sind hierfür freilich die richtige Dosierung, das richtige Präparat und regelmäßige Kontrollen. Eines muss an dieser Stelle aber ganz klar gesagt werden: Die Verabreichung von Hormonen stellt natürlich einen weitreichenden Eingriff in den Organismus der Frau dar und sollte daher auch auf die Indikation von Wechselbeschwerden, die die Lebensqualität tatsächlich beeinträchtigen, beschränkt bleiben. Ein unrefl ektiertes Feilbieten von Hormonen etwa als Jungbrunnen und Anti-Aging-Mittelchen, welche am besten schon ab einem frühen Lebensjahr und möglichst lange eingenommen werden sollten, muss abgelehnt werden. Es sollte auf der anderen Seite jedoch auch nicht zu einer absoluten Notwendigkeit werden, Hormone gegen Wechselbeschwerden einzunehmen. Wenn die klassischen Symptome wie Schweißausbrüche und Hitzewallungen nicht im Vordergrund stehen und zu schweren Beeinträchtigungen führen, gibt es auch andere Möglichkeiten, etwa homöopathische Behandlungen, Phytoöstrogene, Melbrosia oder Gelee Royale. Auch eine Akupunktur kann helfen. Es muss aber auch für diese Therapien ganz klar gesagt werden, dass sie mehr schaden als nützen können, wenn sie nicht sachgerecht angewendet werden. Welche Risken sind durch eine Hormonersatztherapie nun tatsächlich zu erwarten und wie hoch sind sie? Seit Sommer 2002 werden die Ergebnisse der Women’s Health Initiative Study (WHIStudie) in der breiten Öffentlichkeit zum Teil sehr emotional, zum Teil auch unsachlich und in der Interpretation nicht immer ganz korrekt diskutiert. Nur ein Jahr später, wieder in den Sommermo- 88 naten des Jahres 2003, wurde die Diskussion neuerlich durch die Ergebnisse der One Million Women Study (OMWS) angeheizt und erfuhr einen fast unglaublichen Höhepunkt. Obwohl seitdem ein Teil der Ergebnisse nach erneuten sachlichen Beurteilungen und Feinauswertungen korrigiert und damit gleichzeitig einzelne Risikofaktoren deutlich reduziert wurden, haben die Diskussionen und Interpretationen dieser beiden Studien sowohl Ärztinnen und Ärzte also auch betroffene Frauen völlig verunsichert und die Hormonersatztherapie in Verruf gebracht. Zum besseren Verständnis dieses Hormonstreits eine kurze Replik der beiden Studien. Die WHI sollte im Wesentlichen die Auswirkungen verschiedener Einfl üsse der Lebensführung – zum Beispiel Ernährung und einige präventive Behandlungen – auf den Gesundheitszustand und das Erkrankungsrisiko von postmenopausalen Frauen ohne klimakterische Beschwerden untersuchen. In den USA wurden dafür in den Jahren von 1993 bis 1998 insgesamt 16.809 postmenopausale Frauen in eine groß angelegte prospektive, randomisierte doppelblinde Studie aufgenommen. Die Studienteilnehmerinnen wurden in drei Gruppen aufgeteilt. In der ersten waren Frauen, denen die Gebärmutter noch nicht chirurgisch entfernt worden war. Diese wurden mit einer Kombination von Östrogen und Gestagen behandelt und mit der zweiten Gruppe verglichen, in der die Frauen statt der Hormone ein Placebo erhielten. Eine dritte Vergleichsgruppe schließlich umfasste Frauen, die bereits eine Gebärmutterentfernung (Hysterektomie) hinter sich hatten, und die eine reine Östrogen-Monotherapie erhielten. Nach einer durchschnittlichen Beobachtungszeit von mehr als fünf Jahren entschied im Mai 2002 dann die US-amerikanische Studienkontrollbehörde, das Data and Safety Monitoring Board, die Untersuchungen der Studie an der ersten Frauengruppe, die eine Östrogen-Gestagen-Kombination erhielten, vorzeitig abzubrechen, da in dieser Gruppe die Risken bei einer längeren Verabreichung höher als der Nutzen liegen würden. Als Grund für den Studienabbruch wurde die in einer Zwischenauswertung gefundene erhöhte Rate von Mammakarzinomen sowie ein erhöhtes Thrombose- und Herzinfarktrisiko angegeben. Die Kontrollbehörde sprach sich jedoch für die Weiterführung der Untersuchungen der dritten Frauengruppe, die nur Östrogen bekamen, über die geplante Studiendauer von acht Jahren aus. Der Grund: Die Nutzen-Risiko-Bilanz fi el bei diesen Frauen günstig aus. Eine erste Veröffentlichung dieser Auswertung erfolgte am 17. Juli 2002 im „Journal of the American Medical Association“ (JAMA). Das in vielen Diskussionen

vorge-brachte Argument, die Ergebnisse der WHI-Studie sprächen generell gegen eine Hormonsubstitution, ist aufgrund dieser Ergebnisse nicht nachvollziehbar. Die Untersuchungen der Frauen, denen die Gebärmutter entfernt worden war und die eine reine Östrogen-Monotherapie erhielten, wurden schließlich nach einer Studiendauer von 6,8 Jahren abgebrochen. Das Überraschende: Nach dieser Zeit waren die Risken für die Entstehung von Brustkrebs und Herz-Kreislauferkrankungen nicht gestiegen, sondern im Gegenteil zwar nicht signifi kant, aber doch zurückgegangen. Allerdings: Einen leichten, ebenfalls nicht signifi kanten Anstieg gab es bei den Risken für Schlaganfälle und venösen Thrombosen. Die Begründung für den vorzeitigen Abbruch lautete, dass keine weiteren Erkenntnisse durch die Fortführung der Studie bis zum Ende zu erwarten seien. Vielleicht wollte man aber auch nicht zulassen, dass die Abnahme des Brustkrebsrisikos eventuell statistisch signifi kant und damit nur noch schwer anzweifelbar werden könnte. Denn damit wären noch mehr Fragen für die Zukunft offen geblieben. Anders ist die Beeinfl ussung der Studienergebnisse durch die Verkürzung der Studiendauer nicht nachvollziehbar. Die One Million Women Studie (OMWS) ist eine rückblickende Erfassung von medizinischen Daten zur Inzidenz, also zur Häufi gkeit des Mammakarzinoms. Die Daten stammen aus Befragungen der Teilnehmerinnen am britischen Brustkrebs-Screeningprogramm mittels Mammographie. Knapp mehr als eine Million Frauen im Alter zwischen 50 und 64 Jahren füllten damals Fragebögen aus, die mit den Erkrankungs- und Sterbezahlen abgeglichen wurden. Demnach waren innerhalb von 2,6 Jahren 9364 dieser Million Frauen an Brustkrebs erkrankt, 637 starben daran. Die Erkrankungsrate betrug im Gesamten also 0,9 Prozent, die Sterberate 0,06 Prozent. Etwa die Hälfte aller Frauen befanden sich unter einer Hormontherapie. Dazu muss festgehalten werden, dass in Großbritannien keine regelmäßige Kontrolluntersuchungen vorgesehen sind und Mammographien nur alle drei Jahre durchgeführt werden. Dennoch: Von allen Frauen, die an Brustkrebs erkrankt waren, schluckten mehr als 3500 überhaupt keine Hormone, gut 5800 erhielten eine solche Therapie. Der Unterschied in den Erkrankungszahlen zwischen diesen beiden Gruppen liegt bei 66 Prozent: Das angegebene relative Risiko, das zu einem Aufschrei geführt hat. Auf die Gesamtzahl der untersuchten Frauen bezogen ergeben sich freilich ganz andere Werte: Von einer Million Frauen im Alter zwischen 50 und 65 Jahren nahm die Hälfte keine Hormone zu sich. Von diesen 500.000 Frauen erkrankten in fünf Jahren gut sieben Prozent an Brustkrebs. Von den 500.000 Frauen, die Hormone schluckten, entwickelten mehr als elf Prozent ein Mammakarzinom. Auch wenn – im Gegensatz zum wesentlich dramatischer klingenden relativen Risiko von 66 Prozent – das absolute Risiko von etwas mehr als sieben Prozent die Tatsachen etwas besser abbildet, so ist auch das nur ein Teil der Wahrheit, denn diese Zahlen spiegeln den statistischen Mittelwert und geben noch keine Auskunft über das Risiko der verschiedenen Formen der Hormonersatztherapie und über das altersbedingte Risiko. Die Studie hat aber auch ein unterschiedliches Risiko für verschiedene Arten der Hormonersatztherapie festgestellt. So ist die Gefahr einer Monotherapie mit Östrogen alleine weit weniger hoch, als eine Kombinationsbehandlung mit Östrogen und Gestagen. Im Vergleich zu Frauen, die keine Hormone nehmen, ist das relative Risiko an Brustkrebs zu erkranken bei alleiniger Östrogenbehandlung um etwa 30 Prozent erhöht, bei einer gemeinsamer Östrogen und Gestagentherapie um rund 100 Prozent. Weiteres wurde in dieser britischen „One Million Women Study“ das jeweilige Risiko auf die verschiedenen Altersgruppen und auch auf die Dauer der Hormoneinnahme aufgeteilt. Bei einer Analyse aller dieser Werte, ihrer Umlegung auf die Gesamtzahl der Studienteilnehmerinnen und der Angabe von absoluten Werten kommt man nun auf folgende, nicht mehr ganz so alarmierende, tatsächliche Zahlen: Von 1000 Frauen im Alter von 50 Jahren, die keine Hormone nehmen, erkranken laut dieser Studie 18 an einem Mammakarzinom. Von 1000 Frauen im selben Alter, die bis dahin zehn Jahre Östrogene allein schluckten, erkranken ebenfalls 18 an Brustkrebs, und von der gleichen Anzahl gleichaltriger Frauen, die zehn Jahre lang eine Kombination aus Östrogen und Gestagen einnahmen, entwickeln ebenfalls nur 18 einen Tumor in der Brust. Für diese Altersgruppe konnte die Studie also überhaupt keine Risikoerhöhung feststellen. Im Vergleich mit der Zahl von Mammakarzinomen, die auch ohne die Medikamente entstehen, ist die Zahl der zusätzlichen Krebsfälle durch eine Hormontherapie welcher Art auch immer gleich null. Anders sieht es jedoch bei älteren Frauen aus. Von 1000 Frauen im Alter von 60 Jahren, die keine Hormone nehmen, erkranken laut dieser heftig und kontrovers diskutierten Studie 38 an Brustkrebs, also 20 mehr als in der Gruppe der um zehn Jahre jüngeren Frauen. Was im einzelnen Fall natürlich extrem tragisch, aber dennoch absolut logisch ist, schließlich ist Krebs primär eine Alterserkrankung. Von 1000 Frauen im Alter von 60 Jahren,
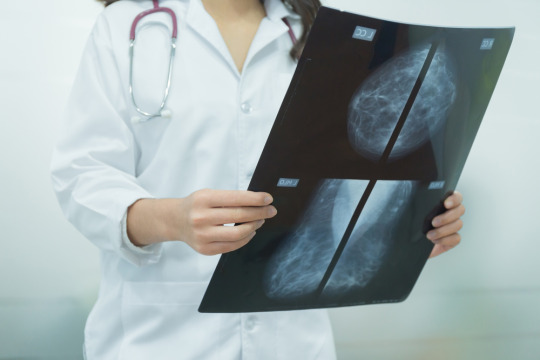
die zehn Jahre lang bereits Östrogene schlucken, entwickeln 43 ein Mammakarzinom und von 1000 Frauen mit 60, die zehn Jahre lang Östrogen und Gestagen schlucken, erkranken 57 daran. Was müsste man also aufgrund dieser Studie, die nicht nur in Österreich zahlreiche Patientinnen verunsichert hat, einer Frau mit 60 Jahren sagen, die bereits seit zehn Jahren Östrogene gegen ihre Wechselbeschwerden geschluckt hat? Man müsste ihr sagen, dass von 1000 Frauen in ihrer Altergruppe laut Statistik bei 38 Frauen wahrscheinlich ein Mammakarzinom diagnostiziert wird. Und dass sich dieses Risiko durch die zehnjährige Hormonersatztherapie vermutlich um fünf Fälle erhöhen wird – also um 0,5 Prozent. Und hätte sie über diesen Zeitpunkt hinweg eine Kombinationstherapie mit Östrogen und Gestagen erhalten, wäre das absolute Risiko um knapp zwei Prozent gestiegen. Derart ausgewertet und betrachtet erscheint das Risiko einer Hormonersatztherapie doch ein klein wenig anders als mit der drastischen Angabe, dass eine solche Behandlung das Brustkrebsrisiko um 66 Prozent erhöht, die damals in den meisten Medien für Schlagzeilen und unter Patientinnen für entsprechende Panik gesorgt hat. Es gibt aber noch einige andere Kritikpunkte anzuführen. Im Gegensatz zu allen bisherigen Studien und Publikationen war in der OMWS das Risiko, an einem Mammakarzinom zu sterben, um derartige Dimensionen erhöht, dass sämtliche Forscher, die bisher Studien zu diesem Thema angestellt hatten, unfähige Stümper hätten sein müssen. Denn derartig gigantische Risikoerhöhungen hätten schon früher erkannt werden müssen. Im Gegensatz zu allen anderen vorangegangenen Studien ließen die Ergebnisse der OMWS vermuten, dass die Inzidenz von Brustkrebs bereits bei einer Hormoneinnahme über 2,4 Jahre hindurch ansteigen könnte. Die Teilnehmerinnen an der Studie hatten im Durchschnitt jedoch schon eine rund sechsjährige Hormoneinnahme hinter sich, als die Studie begann. Ebenso in Gegensatz zu allen bisherigen Untersuchungen war in der OMWS das Risiko auch bei anderen, synthetischen Hormonen wie beispielsweise Tibolon erhöht. Diese Ergebnisse, die in keinen anderen Studien nachvollziehbar waren und sind, ließen darauf schließen, dass sowohl schwere methodische Fehler als auch, bedingt durch das Studiendesign, Fehler in der Auswahl des Patientinnenkollektivs gemacht worden sind – zum Beispiel eine nicht ausgewogene Verteilung aller bekannten, aber insbesondere aller unbekannten Risikofaktoren, damit die Studienteilnehmerinnen überhaupt repräsentativ sind und die Ergebnisse auf alle betroffenen Frauen umgelegt werden können. Selbst die Studienautoren konnten die zahlreichen Kritikpunkte bis heute nicht ausräumen. Dennoch ist eines passiert: Die Ergebnisse machten Schlagzeilen, viele Frauen brachen auf Grund der darauf folgenden öffentlichen Diskussion, die auch zu einem Streit unter Medizinern führte, aus Verunsicherung und Angst ihre laufende Hormonersatztherapie sofort ab. Doch auf Grund der danach wieder auftretenden starken klimakterischen Beschwerden entschloss sich rund die Hälfte dieser Frauen in den Folgemonaten, doch wieder zu einer solchen Therapie. Weil ihre Lebensqualität ohne Behandlung so stark herabgesetzt war, dass sie in ihrem täglichen Leben deutlich beeinträchtigt waren. Der Hormonstreit, ausgelöst durch die einseitige Darstellung der Ergebnisse der OMWS, muss auch unter einem ökonomischen Gesichtspunkt betrachtet werden: Allein in Österreich fallen derzeit nach Auskunft der Statistik Austria 753.371 Frauen in das betroffene Alter zwischen 50 und 64 Jahren. Mehr als 20 Prozent von ihnen erhalten eine Hormonersatztherapie. 2,6 Millionen derartiger Verordnungen kosten die Krankenkassen jährlich 23,8 Millionen Euro. Ziemlich viel Geld für das öffentliche Gesundheitssystem, dem es fi nanziell ohnedies nicht besonders gut geht. Kein Wunder, dass gerade Gesundheitspolitiker und von der öffentlichen Hand unterstützte Organisationen gegen die Hormonersatztherapie Sturm liefen. Auf der anderen Seite darf natürlich auch nicht verschwiegen werden, dass sehr viele Ärztinnen und Ärzte und vor allem die Pharmaindustrie sich mit dieser Therapie eine goldene Nase verdienen. Da sehr viele Frauen als Privatpatientinnen die Hormone nicht über eine Kassenabrechnung beziehen, muss davon ausgegangen werden, dass noch etliche Millionen Euro mehr als die oben erwähnten knapp 24 Millionen für diese Medikamente jährlich ausgegeben werden. Jedenfalls stellt sich die Frage nach dem Stellenwert einer Hormonersatztherapie für die Zukunft. Nach den heutigen modernen Erkenntnissen führt eine Hormonersatztherapie in der Menopause zu einer geringen Risikoerhöhung für ein Mammakarzinom, sowohl bei Substitution von Östrogenen alleine, als auch bei einer Kombination von Östrogenen mit Gestagenen – hier wird das Risiko sogar stärker erhöht. In jedem Fall müssen Frauen von ihren Ärztinnen und Ärzten objektiv und umfassend über Nutzen und Risken aufgeklärt werden, in letzter Konsequenz sollte es dann in der freien Entscheidung der Frauen liegen, den zu erwartenden Nutzen und das zu befürchtende Risiko gegeneinander abzuwägen. Insbesondere beim Vorliegen weiterer Risikofaktoren für eine Brustkrebser- Hormone und Brustkrebs krankung sollte heute mit einer Empfehlung für eine Hormonsubstitution sehr zurückhaltend umgegangen werden. Gerade hier liegt ein Schwerpunkt der Zukunft: Es müssen postmenopausale Frauen, deren zusätzliche Risikofaktoren sich mit jenen einer Hormonersatztherapie potenzierten, rechtzeitig erkannt werden. Diese Möglichkeiten haben Ärztinnen und Ärzte wenigsten zu einem Teil bereits heute, sie müssen nur angewendet werden. Die Behandlung der Wechselbeschwerden mit einer Hormonersatztherapie daher zu verteufeln hält beispielsweise auch Peter Nawroth, der Vorstand der Abteilung für Innere Medizin und Endokrinologie an der renommierten medizinischen Universität Heidelberg, für ebenso falsch, wie einen Lobgesang auf die Hormone anzustimmen. Der Wissenschaft müsse es endlich gelingen, exakt herauszufi nden, welcher Frau diese Therapieform nutzt und welcher sie schadet, konstatiert er in der österreichischen Tageszeitung „Der Standard“. Zwei Dinge scheinen heute jedoch klar geworden zu sein: In der Vergangenheit wurden zu vielen Frauen Hormone verabreicht, vielfach auf Wunsch und Drängen der Frauen selbst, denen die Therapie von Medizinern als Jungbrunnen verkauft wurde. Und die Tatsache, dass eine Kombinationstherapie von Östrogenen und Gestagen ein noch größeres Risiko in sich birgt, als Östrogen allein, muss Auswirkungen auf die Praxis haben. Denn postmenopausalen Frauen, denen die Gebärmutter (Uterus) nicht entfernt wurde – und das sind viele –, hat man bisher selten Östrogen allein gegeben, das galt mitunter fast als Kunstfehler: Weil man annahm, dass Östrogen allein das Gebärmutterkrebsrisiko fördert, kombinierte man fast immer. Diese Praxis muss jetzt neu überdacht werden. Dennoch: Für viele Frauen sind Hormone das Einzige, um Wechselbeschwerden wie Wallungen, Nachtschweiß, Scheidentrockenheit, Juckreiz, Libidoverlust, Schlafstörungen und andere die Lebensqualität gravierend beeinträchtigende Befi ndlichkeitsstörungen zu lindern. Wie aber kommt es überhaupt zum Versiegen der Hormonproduktion? Das Keimgewebe der Eierstöcke verbraucht sich während der Zeit der Geschlechtsreife. Beide Ovarien enthalten bei der Geburt etwa eine Million Eizellen, bis zur Menopause sind etwa 99 Prozent verbraucht. Enthalten die Ovarien keine reaktionsfähigen Eifollikel mehr, büßen sie auch die Fähigkeit zur Hormonbildung ein, es versiegt die Östrogenbildung. Die Fruchtbarkeit versiegt. Das hat auch einen logischen Grund: Wie oben ausgeführt, ist die heutige Lebenserwartung primär durch äußere Faktoren derart in die Länge gezogen worden, nicht jedoch durch biologische. Die Evolution hinkt dabei dem technischen Fortschritt nach, genetisch bedingt und physiologisch umgesetzt, hört der weibliche Organismus mit dem Eintritt ins Klimakterium auf, derart viel Energie für die biologische Möglichkeit einer nochmaligen Schwangerschaft aufzubringen, da der nicht mehr damit rechnet, seine Nachkommen bis zu deren Selbständigkeit betreuen zu können. Warum also hier noch investieren? Zu dumm nur, dass der medizinische und technische Fortschritt sowie eine ausgewogenere Ernährung die Lebensspanne derart stark nach hinten ausgedehnt hat. Das führt natürlich zu Beschwerden. Was hier vielleicht nach einem darwinistisch-reduktionistischen Frauenbild aussieht, wird in der Wissenschaft zusehends ernst genommen. Die Fruchtbarkeit einer evolutionären Sicht medizinischer Probleme wurde und wird auch zur Zeit noch stark unterschätzt. Ein Beispiel dafür ist das anscheinend erst vor nicht zu langer Zeit einsetzende Ansteigen der Häufi gkeit von Brustkrebs in westlichen Industriegesellschaften. Eine ganze Reihe von möglichen Ursachen dafür werden diskutiert, wie in diesem Buch bereits ausgeführt wurde. Der US-Anthropologe Boyd Eaton und seine Kollegen von der Emory Universität in Atlanta, Georgia, vermuten jedenfalls, dass dieser Anstieg mit dem Hormonstatus von Frauen zusammenhängt und suchen die Ursache in den Änderungen der Lebensweise von Frauen in modernen Gesellschaften, obwohl sie die Evolution nur an ein Leben in urzeitlichen Jäger-Sammler-Gesellschaften angepasst hat. In solchen primitiven Gesellschaften wurden Mädchen mit etwa 15 Jahren geschlechtsreif und bald darauf schwanger. Was darauf folgte waren zwei oder drei Jahre Stillen, auf die wieder eine weitere Schwangerschaft folgte. Nur in der Zeit zwischen dem Abstillen und der nächsten Schwangerschaft lebten die Frauen mit normalen Menstruationszyklen und damit auch mit enormen Schwankungen in ihrem Hormonspiegel. Im Gegensatz dazu werden Mädchen in modernen Gesellschaften mit zwölf oder dreizehn Jahren geschlechtsreif. Vielleicht zum Teil deshalb, weil in der heutigen Konsumgesellschaft selbst sehr junge Mädchen bereits so viel Fett angesammelt haben, dass sie einen Fetus ernähren könnten. Doch sie werden dann erst Jahrzehnte später oder vielleicht nie schwanger. Eine Frau, die in einer JägerSammler-Gesellschaft lebte, erlebte insgesamt vielleicht 150 Menstruationszyklen, während es bei einer Frau in einer modernen Gesellschaft 450 oder mehr Zyklen sind. Natürlich wird es nur wenige Leute geben, die vorschlagen würden, dass junge Frauen schon als Teenager schwanger werden sollten, weil das später ihr Krebsrisiko vermindert. Aber es könnte doch sein, vermutet diesbezüglich der US-Evolutionsforscher Georges C. Williams von der Universität von Kalifornien in Los Angeles, dass eine frühe Hormonzufuhr von außen, welche eine Schwangerschaft simuliert, dieselbe Wirkung hat. Nur müssten dazu eben solche synthetischen Hormone entwickelt werden, die kein Erkrankungsrisiko mit sich bringen. Entsprechende Forschungen werden derzeit bereit unternommen. Read the full article
#brustkrebssymptome#InwelchemAlterBrustkrebs#IstBrustkrebsansteckend#IstBrustkrebsgutheilbar#IsteinhormonellerBrustkrebsvererbbar#WaskannBrustkrebsverursachen#WelcheNebenwirkungenhatTamoxifen#WiehochsinddieChancenbeiBrustkrebs#WiemerkeichdassichBrustkrebshabe#WievielProzentderFrauenbekommenBrustkrebs
0 notes
Text
Neue Studie „Sichtbar“: zu Lebenslagen seelisch beeinträchtigter Menschen
Die Studie "Sichtbar" über das Leben von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen in München wurde kürzlich dem Gesundheitsausschuss des Stadtrats präsentiert. Sie untersucht u. a., wie viele psychisch erkrankte Menschen es in München gibt, wie sie auf die verschiedenen Stadtteile verteilt und mit welchen spezifischen Belastungen und Hindernissen sie konfrontiert sind.
Ich liefere im Folgenden keine Zusammenfassung, sondern möchte bestimmte Punkte aus der Studie hervorheben, weil ich diese für aussagekräftig halte.
Über die Studie
Sie ist eine Maßnahme des zweiten Aktionsplans der Landeshauptstadt München zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und kann unter https://stadt.muenchen.de/infos/gesundheitsberichte.html abgerufen werden.
Ein spezielles Augenmerk lag darauf, die Hindernisse zu beschreiben, mit denen seelisch beeinträchtigte Menschen im täglichen Leben konfrontiert sind, wie im zwischenmenschlichen Kontakt, im Berufsleben, bei kultureller Teilhabe usw.
Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen waren bei dieser Studie kontinuierlich als Co-Forschende beteiligt und brachten ihre Erfahrungen, Perspektiven und Ideen zur Beseitigung von Barrieren in das Forschungsteam ein. Dieses partizipative Vorgehen entspricht den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention und könnte als erfolgreiches Beispiel für zukünftige Projekte der Stadtverwaltung dienen.
Die Teilnehmer der Befragung nannten im Durchschnitt 3 verschiedene psychische Krankheiten, teilweise von Ärzten diagnostiziert, teils in Selbstdiagnose. Hier spiegelt sich wider, dass das alte System, psychische Störungen in feste Kategorien einzuteilen, nicht gut funktioniert. Neuere Studien deuten mehr und mehr darauf hin, dass „psychische Störungen ineinandergreifen und es keine harten Trennlinien gibt.“ (Heinz, Müller und Rosenthal 2016)
Das Besondere
Partizipative Forschung (Citizen Science)
Betroffene sind selten aktiv in Forschungsprojekten involviert. Stattdessen wird über sie geforscht oder Experten geben Auskunft über sie. In Deutschland ist das noch extremer, als in anderen Ländern, auch wenn sich in der sozialwissenschaftlichen Gesundheitsforschung entsprechende Bemühungen zeigen. Die Psychologie und Psychotherapie scheint sich darum wenig zu kümmern.
Darum ist das Motto; „Nichts über uns ohne uns“ von Behindertenrechtsaktivisten seit den 1990er Jahren vertreten, und auch das Prinzip der Citizen Science betont die Bedeutung Betroffener-Beiträge zur Aufklärung komplexer Forschungsfragen.
Die vorliegende Studie war daher kein rein akademisches, sondern ein vorbildliches Gemeinschaftsprojekt, bei dem auch nicht-wissenschaftliche Akteure aktiv beteiligt wurden. Die Zusammenarbeit von Wissenschaftlerinnen und Betroffenen führte zu einer gegenseitigen Ergänzung der Perspektiven, was die Relevanz und Wirksamkeit der Untersuchung deutlich unterstreicht.
Im Wesentlichen zeichnet sich die Studie durch folgende Merkmale aus:
Orientierung an lebensweltlichem, gesellschaftlich relevantem Thema
mit Betroffenen als Partner*innen statt als Objekte der Forschung
starker Fokus auf das Selbsterleben und Erfahrungswissen
Erarbeitung von problemorientiertem Handlungswissen
Empowerment im Prozess
Erkenntnisse zu Begrifflichkeiten
Die Art und Weise, wie im Alltag über psychische Erkrankungen oder Betroffene gesprochen wird, zeichnet sich durch die Vielzahl an verwendeten Begriffen aus.
„psychisch Kranke“ und „Menschen mit psychischen Erkrankungen“
„psychisch beeinträchtigt“
„Menschen in (psychischen) Krisen“
„seelisch behindert“, „Menschen mit seelischer Behinderung“,
„Personen mit psychischen Störungen“
„Psychiatrie-Erfahrene*r“
„ver-rückt“ (im Sinne aus dem psychischen Gleichgewicht Geraten-Sein).
Die Studien-Autoren kommen zu dem Schluss:
“Letztendlich ist keiner der Begriffe neutral: Jeder Begriff weckt Assoziationen bzw. trägt Konnotationen, die bei Betroffenen auf Ablehnung stoßen (können). Dies gilt vor allem für den Begriff „Behinderung“.”
Häufig wurde der Begriff “psychische Erkrankung” kritisiert, da er auf eine Wiederherstellung des vorherigen Zustands abziele und somit das subjektive Erleben in der Krankheit als etwas Abnormes betrachtet.
Es bringt laut den Autoren also nichts, nach einem neutralen Wort zu suchen. Viel wichtiger ist, dass wir verstehen, was ein Begriff an Konnotationen beinhaltet. Wie über und mit Menschen mit psychischen Leiden gesprochen wird, ist mehr als wichtig: Nicht nur, weil einige Begriffe stigmatisieren und damit Betroffenen schaden.
Sondern auch, weil die Bezeichnungen, die wir für Personen mit psychischen Erkrankungen verwenden, sich auch auf unsere Haltung ihnen gegenüber auswirkt.*
*Granello und Gibbs (2016) Forschungen zeigen, dass der Begriff „psychisch krank“ bei Leser*innen deutlich eher Assoziationen in Richtung „gewalttätige Personen“ auslösen als der Begriff „Menschen mit psychischen Erkrankungen.“
Der Begriff “Psychiatrieerfahrene” wird als zu eng gefasst betrachtet, viele verstehen darunter Personen mit stationärer Psychiatrie-Erfahrung.
Häufigkeit
Quelle: stadtbezogenen Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB). Im Jahr 2021 wurde bei etwa 274.000 erwachsenen Münchner Bürgern, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, mindestens eine psychische oder Verhaltensstörung ambulant diagnostiziert. Dies entspricht einem Anteil von 27,1% aller Münchner GKV-versicherten Erwachsenen mit Arztbesuch. Besonders bei Frauen lag der Anteil mit 30,4% höher als bei Männern mit 23,0%.
Erwähnenswert sind außerdem die sozialräumlichen Aspekte:
"Je höher der Anteil an ALG II-Empfänger*innen, umso höher fällt in der Tendenz der Anteil der GKV-Versicherten mit F30-39 Diagnosen aus. Der Zusammenhang auf aggregierter Ebene der Stadtbezirke ist statistisch signifikant."
Kapitel 2 – Psychische Erkrankungen in der Außen- und Innenperspektiven
Selbsterleben psychischer Krankheit als innere Barriere
Wie es Gottfried Wörishofer, der ehemalige Geschäftsführer der Münchner Psychiatrie-Erfahrenen (MüPE e.V.) formulierte: „Durch die Erkrankung selbst, deren Medikation oder durch beides stellen wir die Absenkung des gesamten Energielevels fest. Minderung von Belastbarkeit, Interesse, Durchhaltevermögen, Freude am Tun, Schwinden von Sinnerleben und geistig-seelischer Präsenz bündeln sich zu einer <Barriere>, die sich als <schwankende Leistungsfähigkeit> zeigt.“
„Innere Barrieren“ im Wechselspiel
Innere Blockaden allein machen es einer Person schwer, am sozialen Leben teilzuhaben. Allerdings wird übersehen, dass solche Ausschlüsse meistens entstehen, wenn Menschen, die nicht betroffen sind, kein Verständnis zeigen und ungeduldig oder unsicher sind. Das kann dazu führen, dass sich betroffene Personen selbst abwerten.
Teils ziehen sich Menschen nicht wegen einer Depression zurück, sondern weil sie sich für ihren Zustand sch��men. Sie übernehmen gesellschaftliche Stereotype und sehen sich selbst so, wie sie glauben, dass andere sie sehen.
Das erklärt auch, warum „innere Blockaden“ so wichtig sind – sie spiegeln Erfahrungen von Ausgrenzung und Selbststigmatisierung wider.
Leben mit einer psychischen Erkrankung als „Alltags-Leistung“
Das Leben mit einer psychischen Erkrankung stellt eine enorme Herausforderung dar, die Betroffene täglich bewältigen müssen. Es geht nicht nur darum, sich mit den Symptomen zu arrangieren, sondern auch darum, sie immer wieder zu überwinden, um ein halbwegs normales Leben führen zu können. Besonders schwierig wird dies bei Symptomen wie Antriebslosigkeit, Ängsten oder Zwängen.
Aber das ist noch nicht alles, was betroffene Menschen Kraft raubt, die für andere Dinge nicht zur Verfügung steht. Denn sie müssen sich auch mit direkter Stigmatisierung und Diskriminierung auseinandersetzen oder sie fühlen sich gezwungen, ihre Krankheit und Symptome zu verstecken.
In den Interviews der Studie betonten viele Betroffene immer wieder, wie anstrengend ihr täglicher Kampf gegen unsichtbare, nicht greifbare Widrigkeiten ist. Die Stärke dieser gefühlten Barrieren lässt sich für Außenstehende nur ansatzweise erahnen.
"Das Gefühl ist so: Irgendjemand hat mir eine Glaskuppel übergestülpt und ich bin nicht mehr fähig, irgendetwas zu tun. Ich sehe immer nur "Um mich herum tut sich was". Ich selbst bin aber nicht mehr handlungsfähig. Und in mir ist so ein Gefühl von Aussichtslosigkeit. Schwere, Angst … das ist ein Wust aus vielen Dingen, dass sie das Gefühl haben "Da komm ich nie wieder raus". Ich kann nichts mehr tun. Ich hab kein Hunger mehr, keinen Durst. (…) Und das Nicht-Können … aus dem Bett ... das wird gleichgesetzt mit Faulheit. Das ist schlimm." -- Betroffene, Hauptdiagnose Depression
Angesichts des täglichen Kraftaufwands und der permanenten Überwindung von Alltagshindernissen, ist es fast schon lächerlich, dass psychisch erkrankte Menschen in unserer Gesellschaft als "leistungsschwach" angesehen werden, wie die Autoren richtig bemerken.
Leben mit einer psychischen Behinderung als „Bereicherung“.
Obwohl psychische Erkrankungen belastend sind, können sie die Sichtweise der Betroffenen auf sich selbst und andere mit der Zeit ändern. In der Studie kam oft zur Sprache, dass psychische Krankheiten zwar schwierig sind, aber auch positive Veränderungen bringen können.
Manche Betroffene entdecken durch ihre Krankheit neue Werte oder Lebensweisen. Andere lernen Fähigkeiten, die sie als bereichernd empfinden. Wichtig zu betonen: trotz dieser positiven Aspekte verschwinden die belastenden Symptome der Erkrankungen nicht dahinter. Es wurde also nicht behauptet, dank der Erkrankung wäre das Leben jetzt sinnvoller oder besser als zuvor.
Kapitel 3 (ab S. 64)
Behandlungs- & Unterstützungssystem
Das System der psychischen Gesundheitsversorgung ist selbst für Fachleute schwer zu durchschauen – Laien fühlen sich oft überfordert. Es umfasst 4 Hauptbereiche: Beratung, Behandlung, Unterstützung zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und Selbsthilfe, mit einer Fülle von Angeboten in jedem Bereich und zahlreichen kurzlebigen Projekten, die für zusätzliche Komplexität sorgen. Ironischerweise kann eben dieses Hilfesystem eine Hürde für die Teilhabe sein.
Das zeigen auch die Ergebnisse der Umfragen. Was fehlt im "professionellen Hilfeangebot für psychisch Kranke in München"?
Hier wurde vor allem das psychiatrisch-psychotherapeutische Angebot kritisiert. Am meisten bemängelt: dass man zu lange auf ambulante Behandlungen warten muss. Das ist besonders kritisch, da mit der Wartezeit auch das Chronifizierungsrisiko steigt.
Laut den Umfragen bilden das ambulante Behandlungssystem und die ausgrenzenden Mechanismen des Arbeitsmarktes die wichtigsten Hürden für die soziale Teilhabe (nachzulesen in Kapitel 8.1). Fachleute und Angehörige von psychisch erkrankten Menschen stimmen dem gleichermaßen zu (siehe Abbildung 8.1).
2 große Probleme, die für ganz Deutschland gelten
Alarmierend, aber nicht neu: dass etwa 10 % der Betroffenen angaben, sie verzichten aufgrund langer Wartezeiten oder schwer zugänglicher ambulanter Dienste auf Therapie oder psychiatrische Hilfe.
In diesem Zusammenhang scheint mir ein Aspekt wichtig: Die Befragten empfanden es als großes Risiko und Hürde, Therapeuten akzeptieren zu müssen, zu denen man eigentlich kein Vertrauen hat und deren Fachlichkeit man anzweifle.
Tatsächlich sind die Versorgungslücken im System so groß, dass eine freie Therapeutenwahl unmöglich wird.
Systeminterne Nutzungsbarrieren
Viele Betroffene fühlen sich durch die langen Wartezeiten und den schwierigen Zugang zum Hilfesystem überfordert, besonders in Krisenzeiten. Diese persönliche Überforderung, die durch ein Zusammenspiel von inneren Hürden und der komplexen Struktur der Behandlungs- und Unterstützungsangebote entsteht, wurde in den Befragungen und Gesprächen als entscheidendes Hindernis für die Inanspruchnahme von Hilfe identifiziert. Die fortwährende Stigmatisierung psychischer Krankheiten (siehe Kapitel 7) und die damit verbundenen Schamgefühle hindern viele Menschen daran, frühzeitig Hilfe zu suchen. Viele greifen erst auf Unterstützungsangebote zurück, wenn sie keine andere Wahl mehr sehen.
Erkrankungsbilder
Betroffene und Fachleute monieren, dass der Einstieg in ambulante Behandlungen noch schwieriger ist, weil einige Therapeuten sich eher leichte Fälle aussuchen.
Vgl. Klassismus in der Psychotherapie
Erschwerte Kontaktaufnahme
Oft müssen Betroffene über Wochen oder Monate hinterher telefonieren, um Kontakt zu Therapeuten zu finden.
Mangelnde technische Barrierefreiheit
Es fehlen Optionen, sich online über Angebote zu erkundigen und digitale Kommunikationswege mit Fachpersonal, wie Online-Terminbuchungen oder Chats, nutzen zu können.
Regelungsbedingte Einschränkungen
Die Kritik richtet sich vor allem gegen die Höchstzahl an Therapiestunden, die Krankenkassen bewilligen, und die Begrenzung auf nur bestimmte genehmigte Therapiearten.
Kritik an Behandlungsansätzen
Hier wurde vielfach bemerkt, dass Psychiater zu oft und zu schnell Medikamente verschreiben, statt umfassendere Behandlungen anzubieten – und dass teilweise Diagnosen gestellt werden, die fachlich nicht fundiert sind.
Entlassmanagement
Die Weitervermittlung von stationären an ambulante Behandlungs- und Unterstützungssysteme findet selten statt, sodass Patienten und deren Angehörige oft alleingelassen werden.
Begrenztes Vermittlungsangebot
Viele Betroffene und ihre Angehörigen sind durch die therapeutischen Angebote überfordert – gerade auch wegen der Vielfalt – oder wissen nichts davon. Und auch wenn man von den Angeboten weiß, scheinen die zuständigen Stellen einen nicht aktiv an das psychiatrisch-psychotherapeutische System weiterzuvermitteln. Gerade diese konkrete Hilfe benötigen Betroffene allerdings. Auch fehlt es an konkreten Empfehlungen für Therapie-Arten und passende Therapeuten.
Situation der Angehörigen
Angehörige kümmern sich i. d. R. zuerst um Erkrankte – und meist tun sie das eine sehr lange Zeit, bevor Betroffene professionelle Hilfe überhaupt suchen. Bei schweren oder lang andauernden Krankheiten bedeutet das eine enorme Belastung, die sich kaum jemand vorstellen kann.
Probleme von Angehörigen:
Angehörige und Freunde bekommen nicht genug Unterstützung, um mit der Situation fertig zu werden.
Viele Angehörige und Freunde fühlen sich regelrecht überfordert.
Etwas kritischer ist vor allem die Lage von Angehörigen, die mit dem/der Betroffenen zusammenleben
Angehörige, die überdurchschnittlich häufig zu wenig Hilfe bekommen, sind Partner (63,9%) und Eltern (48,5%), die mit den Erkrankten zusammenleben, sowie Kinder und Schwiegerkinder (56,5%), die nicht im gleichen Haushalt leben. Vgl. Depression: Angehörige & das unsichtbare Leid & Depression beim Partner: extreme Belastung für die Beziehung
Kritik der Angehörigen am Gesundheitssystem
In der Studie bringen Angehörige deutlich zum Ausdruck, dass sie sich alleingelassen fühlen. Sie bemängeln, ihre ständige Sorge und die damit verbundene Last werde weder von psychiatrischen Diensten noch von der Stadtgesellschaft wahrgenommen. Das Gefühl, dass ihre Leistung – das Auffangen der Defizite des erkrankten Familienmitglieds bis hin zur Absicherung seines Lebensunterhalts – öffentlich wenig Wertschätzung erfährt, verstärkt ihre psychische Belastung noch.*
*Schätzungsweise 40 bis 60 Prozent „aller Angehörigen eines psychisch Kranken entwickeln aufgrund der Belastung deshalb selbst psychische Krankheiten oder sind anfälliger für körperliche Beschwerden wie Bluthochdruck. Studien belegen, dass jeder 2. Lebensgefährte eines depressiv Erkrankten nach einiger Zeit selbst depressive Symptome zeigt.“ (https://www.therapie.de/psyche/info/fragen/angehoerige-psychisch-kranker/artikel/).
Besonders in der Kritik: dass Angehörige von (volljährigen) psychisch kranken Menschen oft von wichtigen Informationen ausgeschlossen werden.
Die Tatsache, dass die Gesellschaft Angehörige von psychisch Kranken kaum wahrnimmt, hängt damit zusammen, dass auch die psychisch Kranken selbst oft ausgegrenzt und ihre Beiträge zur Gesellschaft nicht anerkannt werden. Dieses Problem trifft nicht nur Angehörige von psychisch Kranken, sondern generell alle Angehörigen, welche Pflege für Familienmitglieder oder Partner übernehmen.
Kapitel 4 (ab S. 104) – Arbeit
"Die Teilhabe von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen am Arbeitsmarkt ist im Vergleich zur Münchner Allgemeinbevölkerung deutlich eingeschränkt: Während laut letzter Bürgerbefragung rund drei Viertel (75,3%) der der 18- bis 65-Jährigen Münchner Bürger*innen am Arbeitsleben teilnehmen, trifft dies nur für gut die Hälfte (54,6%) der ZBFS-Befragten zu 24,0%.
Rund 40 % aller Frühberentungen der rentenversicherten Münchner*innen sind mit psychischen Störungen begründet. Psychisch erkrankte und erwerbsgeminderte Personen sind somit „ausgesteuert“. Dass manche von ihnen unter den derzeitigen Bedingungen auch gar nicht mehr am Arbeitsleben teilhaben wollen, ändert nichts am strukturellen Ausschluss.
Neben faktischen Leistungsminderungen im Zuge psychischer Erkrankungen sind es vor allem das Fehlen flexibler(er), erkrankungsadäquater Arbeitszeitmodelle, das Fehlen leistungsadäquater (Einfach-)Arbeitsplätze, und bedürfnisgerechter return-to-work-Programme sowie – entscheidend – die Stereotypisierung Betroffener als generell leistungsschwach, die der Ausgrenzung zugrunde liegen."
(Psychische) Gesundheit und Armut
"Der Zusammenhang zwischen materiellen Notlagen und dem Gesundheitszustand ist in der Forschung seit langem bekannt: Je schlechter die Einkommenslage, desto schlechter der Gesundheitszustand.*
* Landeshauptstadt München (Sozialreferat) (2017: 171-172); Landeshauptstadt München (Sozialreferat) (2022: 225-226) sowie diverse Analysen der Münchner Gesundheitsberichterstattung: https://stadt.muenchen.de/infos/gesundheitsberichterstattung.html
Besonders ausgeprägt ist der Zusammenhang mit Blick auf den körperlichen Gesundheitszustand. Der soziale Gradient zeigt sich aber auch bezüglich der psychischen Gesundheit: Während nur 12,0 % der Personen aus armen Haushalten einen (sehr) guten psychische Gesundheitszustand angeben, sind es bei Personen aus Haushalten der oberen Mitte bzw. aus reichen Haushalten 26,5 %"
Vgl. auch Armut & Depression: gesundheitliche Ungleichheit
"Die geringeren materiellen Handlungsspielräume begrenzen nicht nur die sozialen Teilhabe-Chancen der Betroffenen, sondern wirken ihrerseits als Stressoren. Mit Armut geht häufig eine doppelte Ausgrenzung und Demütigung einer, eine gleichsam verdoppelte Erfahrung des Nicht-Verstanden-Werdens – als psychisch erkrankte Person und als Armutsbetroffene „mit dem Gefühl, in fast allen Lebensbereichen, Bittstellerin zu sein.“
Die reine Alltagsbewältigung rückt noch mehr in den Vordergrund. Die enge Verbundenheit, die viele Betroffene mit anderen psychisch erkrankten Personen spüren (siehe Kap. 6.1.1), hat auch mit dieser doppelten Ausgrenzung zu tun. Diese Stimmen verdeutlichen, dass es bei psychisch erkrankten Armutsbetroffenen zu kurz greift, ausschließlich die psychische Belastung wahrzunehmen und zu behandeln. Armutspolitik und bedarfsgerechte Behandlungsangebote sind zusammen zu denken."
Kapitel 6 (ab S. 161)
Soziale Beziehungen und soziale Teilhabe
Verhaltensweisen, die teilweise durch die Krankheit ausgelöst werden – z. B. Misstrauen, erhöhte Sensibilität, starke Stimmungsschwankungen und Reizbarkeit (siehe Kapitel 2.2.1) – wirken sich oft auf die sozialen Beziehungen der Betroffenen aus. Sie können sowohl das Aufrechterhalten als auch das Knüpfen von sozialen Kontakten erschweren. Häufig ziehen sich die Betroffenen von selbst zurück.
Vgl. Vereinsamung – Was Einsamkeit aus Menschen macht
Psychische Erkrankungen verändern die Art und Weise zu kommunizieren, das Selbstbild und die Bedürfnisse nach sozialen Kontakten. Wenn man dann noch bedenkt, dass sich Menschen wegen erlebter Stigmatisierung und Diskriminierung oft zusätzlich zurückziehen (siehe Kapitel 7), und dass ihre finanziellen Mittel häufig beschränkt sind, was die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben weiter einschränkt (siehe Kapitel 4.4), entsteht ein Teufelskreis der Einsamkeit.
Evtl. auch interessant für dich: Was Armut mit Kindern macht
Viele Betroffene sind einsam
Viele Befragte fühlen sich einsam. Der Bedarf nach Maßnahmen wird besonders klar, wenn man sich vor Augen führt, dass es für einsame Menschen umso schwerer wird, sich aus ihrer Einsamkeit zu befreien, je länger sie sich einsam fühlen. Längere Zeiten der Einsamkeit können das Selbstwertgefühl senken und es zusätzlich schwieriger machen, Chancen zu ergreifen, um mit anderen in Kontakt zu treten.
Es steht außer Frage, dass Einsamkeit ernsthafte Auswirkungen auf die seelische und körperliche Gesundheit hat.
Ausschluss durch andere und selbst gewählter Rückzug verstärken sich oft gegenseitig. Der Rückzug kann sowohl durch die Krankheit selbst bedingt sein als auch eine Folge davon sein, wie Betroffene sich selbst sehen und bewerten, nachdem sie Diskriminierung erfahren haben (siehe Kapitel 7.3.1).
Das bedeutet: Der soziale Rückzug Betroffener und der daraus resultierende Mangel an sozialer Teilhabe sollten nicht nur als innere Hürden verstanden werden, sondern vielmehr als durch Erfahrungen geprägte Schutzstrategie, die dabei helfen soll, angesichts eigener Einschränkungen und Diskriminierungserfahrungen besser klarzukommen.
Zu wenig Unterstützung
Zudem gaben viele der Befragten an, dass sich ihr Freundeskreis durch die psychische Erkrankung wesentlich verkleinert hat und sie sich aufgrund ihrer psychischen Probleme oft aus dem gesellschaftlichen Leben zurückgezogen haben. Obwohl die befragten Menschen nicht in einer isolierten Welt leben, in der sie kaum Kontakt zu anderen außerhalb ihres eigenen Netzes haben, zeigt sich doch ein klares Muster: Je schwerer die psychische Erkrankung, desto wichtiger werden die Kontakte zu anderen Betroffenen.
Für Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen sind oft nur diese Gleich-Betroffenen (Peers) diejenigen, die sie als gebende und wertschätzende Personen sehen und anerkennen. Im Umgang mit Nicht-Betroffenen fühlen sie sich schnell nur auf ihre Krankheit reduziert.
Es ist keineswegs selbstverständlich, dass es zwischen Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und denen ohne zum Kontakt kommt. Das zeigt, dass es an emotionaler Unterstützung und praktischer Hilfe mangelt. Dieser Mangel erschwert auch den Zugang zu professionellen Hilfsangeboten (siehe Kapitel 3).
Kapitel 7 (ab. S 190)
Stigmatsierung und Diskriminierung
Psychische Krankheiten sind in München weit verbreitet (siehe Kap. 2.1.2), trotzdem werden Betroffenen oft stigmatisiert. Die Stigmatisierung macht es schwer, sich selbst zu akzeptieren und verhindert Teilhabe. Menschen mit psychischen Problemen müssen immer auf der Hut sein und viel Energie aufwenden, um gegen die Ungerechtigkeit und falsche Vorstellungen anzukämpfen. Diskriminierung bedeutet dann, wegen der Krankheit wirklich benachteiligt oder ausgeschlossen zu werden. Zudem führt Stigmatisierung zur Internaliserung solcher Vorurteile und dadurch zur Selbststigmatisierung.
Während man gegen Diskriminierung mit politischen Mitteln vorgehen kann, ist das bei Stigmatisierung viel schwieriger. Das andauernde Stigma, das in Deutschland psychisch kranke Menschen betrifft, zeigt das ganz deutlich. Das heißt nicht, dass es keine Fortschritte bei der Bekämpfung dieser Stigmata gibt – aber es zeigt, wie viel Arbeit noch vor uns liegt.
Menschen mit psychischen Krankheiten wissen oft aus eigener Erfahrung, dass viele Leute Vorbehalte oder falsche Meinungen ��ber sie haben. Sie spüren, wie die Gesellschaft sie sieht. Auch wenn Leute, die jemanden mit einer psychischen Krankheit kennen, manchmal vorsichtiger sind, hören Menschen, deren Krankheit nicht so offensichtlich ist, immer wieder harte und verletzende Kommentare über psychische Leiden.
Häufige Vorurteile: mangelnder Leistungsfähigkeit, generellen Unberechenbarkeit, Unzuverlässigkeit. In der Studie kam immer wieder zur Sprache, wie stark Betroffene diese Stigmatisierung spüren und sich daher aus dem sozialen Leben zurückziehen.
Diskriminierung allgemein
Es ist allgemein bekannt, dass psychische Krankheiten und Menschen, die daran leiden, in unserer Gesellschaft nicht akzeptiert und ausgegrenzt werden. Das spiegelt sich auch in der Studie. Münchner mit psychischen Erkrankungen erleben häufiger Diskriminierung als gesunde Münchner.
Da in den Befragungen nicht speziell nach rassistischen und sexistischen Diskriminierungserfahrungen gefragt wurde, geben die in dieser Studie gezeigten Zahlen wahrscheinlich nicht das ganze Ausmaß der Diskriminierung wieder, die die Befragten wirklich erlebt haben.
In der Arbeitswelt werden Betroffene am häufigsten diskriminiert. Mehr als jede*r 4. sagt, dass er oder sie in den vergangenen 2 Jahren am Arbeitsplatz wegen psychischen Leiden unfair behandelt wurde. An 2. Stelle kommt das eigene private Umfeld, wie Familie und Freunde, und an 3. Stelle der Bereich Gesundheit und Pflege.
Besonders in privaten und im Gesundheitsbereich (Ärzte, Pflegepersonal) sind Mikroaggressionen zu beobachten, die eine negative Wirkung auf Betroffene haben. Zum Beispiel kleine Bemerkungen, abwertende Botschaften und Verhaltensweisen, die eine Person herabsetzen – und das oft, ohne dass sich derjenige, der sie macht, dessen bewusst ist.
Viele, die Diskriminierung erfahren haben, berichten auch von schlechter Behandlung in der Öffentlichkeit, während der Freizeit, beim Einkaufen, bei Dienstleistungen oder auf Ämtern.
Diskriminierung durch Unsicherheit
Wirklich bemerkenswert ist, dass die Studien-Teilnehmer sehr reflektiert über diese Diskriminierungstendenzen berichteten. So sehen sie die fehlende Sensibilität oftmals nicht nur als Resultat unzureichenden Wissens oder gesellschaftlicher Vorurteile. Vielmehr wird sie häufig als Ausdruck der Unsicherheit angesehen – eine Unsicherheit, die bis zur Hilflosigkeit und einem Gefühl der Überforderung führen kann.
“Dies verweist auf die Herausforderungen, denen sich „Entstigmatsierungsaktionen“ gegenübersehen bzw. betont die Bedeutung von Hilfen bei der Stigmabewältgung. Denn: „Irrationalität ist durch Aufklärung und Wissensvermehrung nicht aufzuheben.“ (Finzen 2013, 50).”
Das Phänomen der "Selbststigmatisierung" kommt in den Gesprächen nur selten zur Sprache. Aber das bedeutet nicht, dass Selbststigmatisierung keine großen Auswirkungen hat. Auch wenn jemand nicht mehr krank ist, kann sie verhindern, sich um Arbeit, eine eigene Wohnung, soziale Kontakte oder Beziehungen zu bemühen. Oft ist es nicht die psychische Krankheit selbst, sondern die Selbststigmatisierung, die es den Betroffenen schwierig macht, diese Ziele zu erreichen.*
*"Rüsch & Berger (2012). Ausdrücklich sei betont, dass „Selbststigmatisierung“ ein gesellschaftlich bedingter Prozess ist. Zum einen, weil es – offensichtlich – ohne „öffentliche“ Stigmatisierung gar keine Selbststigmatisierung geben könnte. Zum zweiten, weil Selbststigmatisierung letztendlich „nur“ bedeutet, dass das „Wertesystem aus gesunden Tagen sich gegen sich selbst kehrt“ (Finzen 2013: 65)."
Wichtig: Anti-Stigma-Aktion haben bislang zwar die Einstellungen von Menschen positiv beeinflusst, nicht jedoch ihr Verhalten. Vgl. auch Entstigmatisierung: Was hilft?
Diskriminierung im Gesundheitsbereich
Alarmierend ist, dass gerade in Gesundheits-Einrichtungen für psychisch Kranke berichtet ca. jede 3. bis 4. Person Diskriminierung erlebt. Das zeigt, dass es sich bei solchen Vorfällen nicht nur um vereinzeltes Fehlverhalten handelt, sondern dass diskriminierende Praktiken oft in den Strukturen dieser Institutionen verankert sind. Ähnliche Muster finden sich ebenso in Behörden und Ämtern wieder. Vgl. Stigmatisierung in der Psychiatrie
Kapitel 8 (ab. S. 209)
Schlussfolgerungen
„Es ist offensichtlich, dass die Gruppe der psychisch Erkrankten „nicht als homogene Gruppe betrachtet werden kann. Sie nehmen Hürden oder Zugangsschwierigkeiten teils unterschiedlich wahr und äußern unterschiedliche Bedarfe, die sich auch widersprechen können.“
Angesichts dieser Komplexität erhebt die vorliegende Studie nicht den Anspruch, diese Bedarfe in ihrer Gesamtheit abzubilden oder all die Barrieren, die deren Befriedigung im Wege stehen, zu benennen. Dies wäre vermessen, sofern eine einzelne Studie dies überhaupt leisten könnte.“
(…) „a) Zentral bei der Einbeziehung von Betroffenen (und Angehörigen) ist deren Erfahrung mit psychischen Erkrankungen, dem Hilfesystem sowie mit alltäglichen Teilhabeausschlüssen. Im Sinne der UN-BRK besteht die Herausforderung, nicht nur der Fachwelt eine Expertise zuzugestehen, sondern auch den Betroffenen selbst.
Es geht bei einer solchen Einbeziehung nicht nur darum, Betroffene zu beteiligen und ihre Meinung anzuhören, sondern ihre Erfahrungen und ihr Wissen als Expertise zu nutzen.“
Quellen:
1) Rathaus Umschau 54 / 2024, veröffentlicht am 15.03.2024 2) muenchen-wird-inklusiv.de_ Koordinierungsbüro zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in München 3) SIM Sozialplanung und Quartiersentwicklung, Studie “sichtbar” – Kurzbericht
#studie#aktuell#münchen#betroffene#co-forschung#diskriminierung#stigma#entstigmatisierung#angehörige#kritik an Psychotherapie#kritik#depression gesellschaft#psychosoziale faktoren#armut#sozioökonomische Faktoren
0 notes
Text
Strategische Früherkennung Szenarientechnik
Langfristige Planungshorizonte benötigen ausreichend vorhandes und möglichst der Wahrheit entsprechendes Informationsmaterial. Erstquellen, die belegt sind oder belegt wurden, sind die beste Wahl. Die Strategische Früherkennung beinhaltet Informationen, die für Planungen für kurz-, mittel- bis hin zu langfristigen Szenarien und Visionsbildungen führen. Sind Organisationen besonders Investitionsinvestiv, dann spielen die möglichst genauen Planungen oft die entscheidende Rolle. Informationspotenziale nähren sich von weichen bis harten Signalen um für Zeiträume von bis zu 10 und 15 Jahren in die Zukunft blicken zu können. Man muss in seinem Blickfeld immer die Wirtschaftlichkeit der Situation betrachten.Generell aber, je intensiver die Beobachtungen der Momente und deren Interpretationen sind, desto größer ist die Ausbeute, Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Vorkommnisse in der Zukunft. Die Wahrscheinlichkeit das eine Voraussage zutreffend ist oder sein kann erhöht sich. Die Dinge sind in der Welt, man muss sie beobachten lernen. Die Vorgänge in der Welt wiederholen sich. Insbesondere der hierführ relevante Zyklus in der Volkswirtschaft der Bedürfnisse von Menschen. Aber auch für das Erreichen von Zielen, die mit Visionsbildung und Strategien im Zusammenhang stehen, ist die Fähigkeit der Beobachtung und diese entsprechend zu interpretieren wichtig. Ich denke man darf ausnahmslos behaupten, wenn die ursprüngliche Vorstellung des Bedürfnisses zum Motivationszeitpunkt erscheint, dann gilt das Ziel als erreicht. Auch dann, oder insbesondere dann, wenn Ziele erst nach 10 bis 15 erreicht werden. Früherkennungsindikatoren Der Bereich mit Weitblick zwischen 5 und 10 Jahren, je nach Informationsqualitäten bis 15 Jahre, beinhaltet Früherkennungsindikatoren wie beispielsweise Informationen zum demografischen Wandel, Gesetzesinitiativen, Technologieentwicklungen oder Werterhaltungen, bzw. Verschleiß. Von den Hinweisen der Früherkennungsindikatoren wird ein Übnergang zu den Frühwarnindikatoren durch Konkretisieren gebildet. Bei der Recherche und Aufbau dieser Informationspotenziale steht die induktive Schlussfolgerung im Vordergrund. Die weichen Faktoren geben Hinweis und Aufschluss für Tendenzen. Häufen sich Hinweise, zieht dies die Aufmerksamkeit auf sich. Frühwarnindikatoren Im Hinblick auf Planungen von 1 bis 5 Jahren konkretisiert man Informationen als Frühwarnindikatoren. Sie sind eine Intensivierung der bisherigen Faktoren zur Früherkennung. Man geht den ersten Hinweisen konkreter nach. Dennoch werden auch weitere Faktoren hinzugefügt. Dies beinhaltet Anfrage verhalten, Zins- und Preisentwicklungen sowie Änderungen von Einkommen. Als deduktive Schlussfolgerung bezeichnet werden kann dieses System aufgrund der Tatsache, das hier teilweise verwertbares Datenmaterial zugrunde liegt. Harte Faktoren lassen Hochrechnungen und Wahrscheinlichkeiten zu. Es kann aus Erfahrungswerten geschöpft werden. Operative Frühwarnung Teile volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung. Als operatives Frühwarnsystem bezeichnet man den Zeitraum von bis ca. 6 Monate, teilweise bis zu einem Jahr. Aktuelle Ergebnisse, Umsatz- und Gewinnentwicklungen, Produktivität, Return of Invest, Vergleiche von anderen Berichtszeiträumen und vergangene vergleichbare Zeitzonen. Bestimmte Produkte und Dienstleistungen sind aufgrund von Umfangreichen Investitionen auf möglichst langfristige Planung angewiesen und nehmen daher auch weit entfernte Hinweise und Wahrscheinlichkeitsszenarien an, während weniger Investitionsabhängige Einrichtungen und Organisationen sich mit weniger intensiven Zeithorizonten zufriedengeben. Um die Nachfrage, beruhend auf kollektiven Bedürfnissen verschiedener Organisationen, abschätzen zu können, sowie Prognosen fortschreiben und in Zusammenhänge bringen zu können werden Szenarien verwendet. Mit der Szenariotechnik ist es möglich, Entwicklungen der Zukunft greifbar, abschätzbar zu machen, unter Umständen auch Sensibilität für zukünftiger Ereignisse zu fixieren. Szenariotechnik Für die Szenariotechnik werden zwei Szenarien erstellt. Worst-Case-Szenario und Best-Case-Szenario. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit das beste und schlechteste Möglichkeit berücksichtigt wurden. Bestenfalls entwickelt sich die Realität zwischen diesen beiden Szenarien. Szenarien haben die Auffälligkeit auf Verkettungen aufzubauen, und damit die Berücksichtigung von Kausalitäten zu begünstigen. Dies kommt der realen Entwicklung am nächsten. Als Beispiel sind im Folgenden zwei Szenarien aufgeführt, die der Shellstudie von 2004 entnommen sind. Die Dargestellten Szenarien sind keinesfalls ausführlich dargestellt, gekürzt und dienen ausschließlich als Beispiele! Szenario 1: Tradition (Worst-Case) Treibende Liberalisierung und Globalisierung der Weltwirtschaft führen zu einem zögerlichen Konsumverhalten der Menschen. Subjektive Einschätzung der ökonomischen Wirklichkeit wirkt auf motorisierten Individualverkehr. Ohne bedeutende Impulse auf Motorisierung und Bestandsentwicklungen bleiben Veränderungen in Verhaltensweisen der Bevölkerung und sozioökonomischen Entwicklungen. Menschen fürchten den Anschluss zu verlieren und Ausgrenzungen in der Gesellschaft zu erleben. Sehen sich zunehmend als Verlierer. Globalisierung wird als Prozess einer dauerhaften Bedrohung wahrgenommen. Auswirkungen erhöhen die Sorgen Lebensstandard und Lebenssituation entfalten sich zu deren Nachteil. Der Theoretische Weitblick für Eigenverantwortlichkeit und der Folgen für die eigene Gestaltungsmöglichkeit ist zwar vorhanden, die Skepsis überwiegt aber so das der Zweifel jegliche Hoffnung auf Besserung zerstören. Staat und Verantwortliche Institutionen sollen die Verantwortung zur Absicherung des persönlichen Wohlergehens übernehmen. Lebensläufe sollen nach traditionellen Mustern verlaufen und langfristig planbar sein. Vorbehalte gegenüber neuen wachstumsstarken Technologien werden möglichst lange aufrechterhalten. Biotechnologie und Gentechnik werden lange diskutiert und kritisch eingeschätzt. Die Frage nach Risiken und Gefahren stehen im Fokus. Kontroversen sind emotional stark aufgeladen. Dies begünstigt ein entschleunigtes Wachstum technologischer Entwicklungen. Mittel- bis langfristig wird sich technologischer Fortschritt durchsetzen. Im Vergleich zu anderen Nationen kann Deutschland aus Sicht technologischer Entwicklung dennoch keinen der vordersten Plätze belegen. Deutschland bleibt Zuwanderungsland. Diskussion und Kritik nehmen nehmen zu und wirken hinderlich. Nach hoher Arbeitslosigkeit setzt sich kontinuierliche und umfassende Zuwanderung nach Bedarf und Qualifikation langsam und zögerlich durch. In Deutschland geht die Bevölkerung bis 2030 um mehr als 3 Millionen zurück, sofern sich die Geburtenrate bei 1,4 Kindern pro Frau kontinuierlich hält. Ganztägige Betreuung für Kinder und jugendliche bleiben eine Ausnahme. Bei Zu- und Abwanderung beträgt der Überschuss an Einwanderung zum Jahr 2030 ca. 5,7 Millionen Einwanderern. Der Altersaufbau sorgt für einen Rückgang der zu erwartenden Einwohnerzahlen in Deutschland. Das Alter der Arbeitskräfte steigt im Durchschnitt. Die Situation am Arbeitsmarkt in Bezug auf Qualifizierte und junge Schulabgänger entwickelt sich nachhaltig negativ. Es fehlen klare Leitbilder, Bildung an Wettbewerb-, Effizienz- und Qualitätskriterien um lebenslanges Lernen in Arbeits- und Schulleben dauerhaft zu manifestieren. Dem Arbeitskräfteangebot wirken Faktoren wie höhere Frauenerwerbstätigkeit und längere Lebensarbeitszeit entgegen. Ein späterer Renteneintritt und Zuwanderung kompensieren den fehlenden Fachkräftemangel am Arbeitsmarkt ebenfalls etwas. Die reale Zuwachsrate in Deutschland expandiert bis 2030 bei 1,6 Prozent pro Jahr. Das Wachstumstempo nimmt gegen Ende des Betrachtungszeitraumes ab. Die Weltwirtschaft verliert an Fahrt. Die Expansionsraten in aufholenden Staaten mit steigendem Einkommensniveau schwächen ebenfalls ab. Die Einwohnerzahlen in Deutschland und der aus volkswirtschaftlicher Sicht definierten übrigen Welt und den weiteren Industrieländern sinken. Dies bremst die Nachfrage und senkt das Arbeitskräftepotenzial. Die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes erfolgt schwerfällig. Flexible Arbeitszeiten und Teilzeit gewinnen dennoch an Bedeutung. Normalarbeitsverhältnisse dominieren den Arbeitsmarkt weiterhin. Mehrmalige Wechsel des Arbeitgebers, Tätigkeiten oder Berufswechsel innerhalb der individuellen Erwerbsbiografie bleiben Ausnahme. Die Arbeitslosenzahl liegt 2015 bei etwas über 3 Millionen. Die Zahl der Erwerbspersonen ist rückläufig. Im weiteren Verlauf Differenzieren sich Qualifikation der Arbeitslosen und Anforderungen der Unternehmen zunehmend auseinander. Die Arbeitslosenzahl wird im Jahr 2030 bei etwas mehr als 1,7 Millionen liegen und einer Quote der Arbeitslosen von 4,5 Prozent entsprechen. Es wird sich eine gewisse Knappheit am Arbeitsmarkt einstellen. Szenario 2: Impulse (Best-Case) Treibende Liberalisierung und Globalisierung der Weltwirtschaft werden überwiegend als Chance gesehen. Das Konsumverhalten ist wachsend. Technologie führende Länder die bereits Durchsetzungsvermögen dargestellt haben, entwickeln sich zunehmend zu Vorbildfunktionen. In Folge sozioökonomischer Entwicklungen und Verhaltensweisen der Menschen bereitet sich im Hinblick auf Motorisierung und Bestandsentwicklung ein Klima der Zuversicht und Hoffnung. Insbesondere jüngere Bürger wollen Freiräume bei Absicherung und Selbstvorsorge. Eine umfassende Versorgung durch den Staat ist nicht gewünscht. Dieses Stimmungsbild treibt die Meinung und das Gesamtbild der Gesellschaft. Das Klima begünstigt grundlegende Strukturveränderungen. Mit tief greifenden Reformen wird Hoffnung auf allgemeines Wachstum und persönliche Chancen verbunden. Veränderungen werden gerne angenommen, auch wenn es zunächst Einschnitte und Umstellungen für den Einzelnen bedeuten kann. Die Aufbruchstimmung ist Basis für eine positive und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung. Gegenüber Technologien ist man im Kontext der Aufbruchstimmung aufgeschlossen. An Branchen wie Bio- oder Gentechnik, die hohes Wachstumspotenzial haben, stellt man hohe Erwartungen. Aus den Spitzentechnologien entwickeln sich immer wieder neue Impulse für andere Bereiche und Branchen. Sie wirken auf die wirtschaftliche Entwicklung beschleunigend. Unternehmen, Wachstum und Beschäftigung ziehen daraus positive Schlüsse. Deutschland kann zu anderen Nationen aufschließen. Deutschland bekennt sich zu seiner Rolle als Einwanderungsland. Getrieben vom Wettbewerb hat man klare Ziele vor Augen. Zuwanderung wird für den Arbeitsmarkt positiv wahrgenommen, und als Bereicherung für die gesellschaftliche Entwicklung empfunden. Die Geburtenrate in Deutschland liegt bei 1,4 pro Frau, die Lebenserwartung ist steigend, die Bevölkerung geht bis 2030 um mehr als 2 Millionen Menschen zurück. Betreuung der Kinder und jugendlicher kann durch Ganztageseinrichtungen Flächendecken angeboten werden. Öffentliche und private Angebote ergänzen sich. Der Überschuss an Einwanderung beträgt 6,5 Millionen Menschen. Der Altersaufbau hat sich deutlich korrigiert. Die Zuwanderung kann die Alterung nicht kompensieren. Aber, sie trägt dazu bei dass Engpässe und Spitzen vermieden werden können, und kräftigt vor allem den Wettbewerb. Das Arbeitskraftpotenzial der Unternehmen steigt. Die zwingende Notwendigkeit für Investitionen in Bildung und Weiterbildung erhöhen sich spürbar. Deutschland befindet sich deutlich oberhalb des Durchschnitts der OECD-Länder. Die Attraktivität und damit auch die Wettbewerbsfähigkeit am Wissensstandort steigt. Lebenslanges Lernen ist die Regel, keine Ausnahme. Arbeitszeit und Bildungszeiten wechseln sich ab. Arbeitskräfte profitieren für bessere Qualifikation und sind den sich ständig verändernden Bedürfnissen angepasst. Bildungseinrichtungen profitieren vom Austausch mit der Praxis und wirken Impuls gebend für bedarfsgerechte Gestaltung der Angebote. Kinderbetreuung als Flächendeckendes Angebot hebt die Frauenerwerbstätigkeit deutlich an. Auch zielgerichtete Zuwanderung unterstützt diesen Prozess und kompensiert Engpässe am Arbeitsmarkt als günstiger Nebeneffekt. Längere Lebensarbeitszeit geben Ihr übriges dazu, Ausbildungen verkürzen sich, der Renteneintritt hebt sich, dass Lebensarbeitszeit wird angenehmer und attraktiver. Auch aufgrund von mehr Ausgewogenheit, Arbeiten macht zunehmen Freude. Das reale Wachstum der deutschen Wirtschaft expandiert bis 2030 um rund 2 Prozent jährlich. Die Weltwirtschaft verlangsamt das Wachstum gegen Ende des Betrachtungszeitraumes etwas, das Wachstumstempo sinkt. Weil die Bevölkerungszahlen nur geringfügig nach unten korrigieren, fällt das rückläufige Wachstum aber nur wenig ins Gewicht. Für den Einzelnen erfolgen schnelle und umfassende Veränderungen. Arbeitsorte, Arbeitsinhalte und Arbeitszeiten befinden sich in permanentem Wandel. Zeitlich begrenzte Tätigkeiten gewinnen an Bedeutung. Auch die Zusammenarbeit in projektbezogenen Netzwerken und virtuellen Unternehmen sind zunehmend. Eine dynamische Wirtschaftsentwicklung einer Beschäftigungs-orientierten Lohnpolitik und ein flexibler Arbeitsmarkt senkt die Zahl der Arbeitslosen nach 2015 auf unter 2,5 Millionen. Arbeitskosten sinken infolge verringerter Abgabenbelastung. Gut qualifizierte Arbeitskräfte haben zur Konsequenz, das sich die bestehende Arbeitslosigkeit dynamisch verhält, der Arbeitsmarkt atmet. Die zahl der Langzeitarbeitslosen sinkt, kurzfristige Erwerbslose suchen nach besseren Job-Möglichkeiten und werden schnell fündig. Die Arbeitslosenquote beträgt 3,4 Prozent und entspricht im Jahr 2030 ca. 1,3 Millionen Arbeitssuchenden. Quelle: Shell Szenarien Studien https://www.shell.de/medien/shell-publikationen/shell-pkw-szenarien-bis-2040.html Strategisches Management, WHB Darmstadt, Preißner, Andreas 2015 Pearson Psychologie 2008
0 notes
Link
0 notes
Link
Wie beeinflussen sozioökonomische Faktoren das Sterberisiko von Arbeitnehmern in Deutschland? Um diese Frage zu beantworten, werteten Forscher des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung einen Datensatz der Deutschen Rentenversicherung mit mehreren Millionen Versicherten aus und legen nun e...
0 notes
Text
Ehestress kann die Genesung junger Erwachsener nach einem Herzinfarkt beeinträchtigen
Ehestress kann die Genesung junger Erwachsener nach einem Herzinfarkt beeinträchtigen
Eine stressige Ehe kann sich negativ auf die Genesung nach einem Herzinfarkt auswirken. Ehestress bei jüngeren Erwachsenen (im Alter von 18–55 Jahren) war mit einer schlechteren Genesung nach einem Herzinfarkt verbunden. Diese negativen Auswirkungen änderten sich nach Berücksichtigung demografischer und sozioökonomischer Faktoren wie Bildung, Beschäftigung, Einkommen und…

View On WordPress
0 notes
Link
Seit Jahrhunderten entwickeln Landwirte, Hirten, Fischer und Förster vielfältige und lokal angepasste Agrarsysteme, die mit bewährten und ausgeklügelten Techniken betrieben werden. Diese Praktiken haben zu einer wesentlichen Kombination von sozialen, kulturellen, ökologischen und wirtschaftlichen Dienstleistungen für die Menschheit geführt. "Globally Important Agricultural Heritage Systems" (GIAHS) sind herausragende Landschaften von ästhetischer Schönheit, die landwirtschaftliche Biodiversität, belastbare Ökosysteme und ein wertvolles kulturelles Erbe vereinen. An bestimmten Standorten auf der ganzen Welt gelegen, bieten sie Millionen von Kleinbauern nachhaltig eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen, Nahrung und Lebensgrundlage.
Durch einen bemerkenswerten Prozess der Koevolution von Mensch und Natur sind solche Orte über Jahrhunderte kultureller und biologischer Interaktionen und Synergien entstanden, die die gesammelten Erfahrungen der Landbevölkerung repräsentieren. Leider sind diese Agrarsysteme durch viele Faktoren bedroht, darunter der Klimawandel und der zunehmende Wettbewerb um natürliche Ressourcen. Sie befassen sich auch mit der Migration aufgrund der geringen wirtschaftlichen Lebensfähigkeit, die dazu geführt hat, dass traditionelle landwirtschaftliche Praktiken aufgegeben wurden und endemische Arten und Rassen verloren gingen. In Anerkennung dieser globalen Bedrohungen für die Familienbetriebe und die traditionellen Agrarsysteme hat die FAO vor 16 Jahren das GIAHS-Programm gestartet. Mit dem Ziel, ein Gleichgewicht zwischen Erhaltung, nachhaltiger Anpassung und sozioökonomischer Entwicklung herzustellen, trägt das GIAHS-Programm dazu bei, Wege zu finden, um die Bedrohungen der Landwirte zu mildern und den Nutzen dieser Systeme zu erhöhen.
Durch die Unterstützung mehrerer Interessengruppen zielt dieser Ansatz darauf ab, technische Hilfe zu leisten, das Verständnis für den Wert der Erhaltung nachhaltigen landwirtschaftlichen Wissens zu fördern und landwirtschaftliche Produkte, Agrotourismus und andere Anreizmechanismen und Marktchancen zu fördern.
Derzeit gibt es 50 GIAHS-konforme Standorte in 20 Ländern auf der ganzen Welt, und möglicherweise werden noch viele weitere folgen.
0 notes