#naturgesetz
Explore tagged Tumblr posts
Text

leipzig 2023
30 notes
·
View notes
Link
#Spinoza#Spinoza Der ALL²NATURgesetze ALL²wissen im ALL²tag Da geht nichs drüber Gipfel der Betrachtung - statt existezilsitscher n
3 notes
·
View notes
Text

Austausch mit dem Physiker
Zur epistimologischen Genese der Naturgesetze. Die Anwendung juristischer Prinzipien auf die Beschreibung der Natur. Die abendländische Wissenschaft als Ergebnis der Übernahme des römischen Zivilrechts durch das Christentum. Die päpstliche Theokratie habe eine machtpolitisch effektive Verschmelzung juridischer Operatoren mit den christlichen Texten vollzogen (Legendre). Idee und Begriff des Gesetzes werden als Rationalitätstypus ubiquitär. Entgegnung: der Islam und die Wissenschaften, Abu Ishaq Ibrahim ibn Yahya an-Naqqasch az-Zarqali, der arabische Mathematiker aus Toledo, der herausragendste Astronom seiner Zeit.
0 notes
Text
Alles verändert sich - immer und zu jeder Zeit. Je früher wir das lernen, desto eher verstehen wir die Naturgesetze des Lebens und können loslassen, woran wir stetig anhaften.
× Shunyatah | Gedanken.
#gedanken#anhaften#loslassen#leere#gefühle#zitate#tagebuch#basis noir soninja#angst#essstörung#liebe#tränen#leben#quote
43 notes
·
View notes
Note
⸻ Bist du bereit, hinter den Schleier zu blicken?
Ich rufe jene, die sich vor dem Unbekannten nicht fürchten. Der Weg ist gefährlich, doch für die, die ihn wagen, bietet er die Möglichkeit, Schicksale neu zu schreiben und Mächte zu konfrontieren, die das Vorstellbare übersteigen.
🌑 Gesucht:
Abenteurer, die die Grenzen der Realität herausfordern.
Geister, die nicht durch die Stimmen der Leere zerbrochen sind.
Herzen, die sich weder vor Blut, Chaos noch den Wahrheiten im Schatten scheuen.
🌓 Was dich erwartet:
Reisen in die Tiefen des Nichts, wo das Unwirkliche Wirklichkeit wird.
Begegnungen mit Geistern, Dämonen und Wesen, die die Naturgesetze sprengen.
Geheimnisse, verborgen in den vergessenen Winkeln von Thedas und darüber hinaus.
🌕 Voraussetzungen:
Mut, die Grenze zwischen Licht und Dunkelheit zu beschreiten.
Bereitschaft, sich deinen Ängsten zu stellen und dein Potenzial zu entfalten.
Die Stärke, durchzuhalten, wenn die Realität um dich zerbricht.
Der Schleier wird dünner, und die Welt verändert sich. Wo wirst Du stehen, wenn die Schatten verweilen und Legenden geboren werden?
𝙁𝙊𝙇𝙂𝙀 𝘿𝙀𝙈 𝙍𝙐𝙁.
(ger | mdni | offen für Crossovers)
^
6 notes
·
View notes
Text
Wozu Anthropofagie?
1.
Die rechtstheoretische und rechtshistorische Forschung zur Anthropofagie zieht an, sie nimmt zu, ist wohl so eine Mondphase. Letzens war eine andere Phase und demnächst wird wieder eine andere Phase sein. Als ich vor zwei Jahren Ricardo Spindola und Panu Minkkinen und noch ein paar "Fünf-Sterne-Helden" der Rechtstheorie zu einem Workshop über Recht und Anthropofagie eingeladen habe, und die Reaktionen teils darin bestanden, davon auszugehen, dass ich entweder Witze mache oder aber mal wieder die Gefahr besteht, dass ich meinen Job verliere und dazu noch die Polizei gerufen werden muss, da muss so eine Art Halbmondphase gewesen sein. Die Hälfte der Eingeladenen sind immerhin gekommen und die anderen haben hat nicht die Polizei gerufen oder Kollegen darauf hingewiesen, ich solle meine Job verlieren. Die Phasen sind halt mal so mal so.
Es ist daran zu erinnern, dass sich niemand mit diesem Thema ein Thema ausdenkt. Es war wirklich nicht meine Idee Anthropofagie zum Thema zu machen, schon gar nicht mit der entweder üblich-absurden oder aber melancholisch-akzeptablen These, bisher hätte niemand (so richtig) über das Thema nachgedacht.
Anthropofagie ist für die Rechtswissenschaft kein neues Thema - und in der Rechtswissenschaft wird nicht nur dann über Anthropofagie nachgedacht, wenn es um die Strafbarkeit von Kannibalismus geht. In der Rechtswissenschaft wird über Anthropofagie unter anderem auch dann nachgedacht, wenn über das Recht, das Verschlingen oder Verzehren als Rechtspraxis oder wenn über "vague Assoziationen" (Luhmann) nachgedacht wird. Wenn etwa das Gründungsereignis einer Gemeinschaft oder Gesellschaft nicht ein gemeinsamer Schwur, eine Schreibszene oder eine Lesung/ ein Lesen sein soll, sondern ein Tafeln oder die Teilung von Speisen und Trank, dann liegt es nahe, über Anthropofagie oder Theofagie nachzudenken. Man kann schon das Cover von Gunther Teubners Buch zur Autopoiesis des Rechts (dessen Version des Motivs vom Ouroboros aus einem bekannten Druck zur Allchemie stammt und das bereits vor der Erscheinung von Teubners eine Renaissance in den (südamerikanischen) Publikationen zur Autopoiesis erlebte, als Bild eines Rechts lesen, dessen Wesen sich selbst verschlingt oder dessen Wesen sich verschlingen. Das ist dann bei Teubner zwar etwas anderes als Anthropofagie (man könnte es im abstrakt-wissenschaftssprachlichen Stil des Buches Referenzfagie nennen) aber nicht total anders, weil die Reproduktion dessen, um das es gehen soll, auch als Verschlingen vorgestellt wird. Anders gesagt: Verschlingen oder Verzehren sind dann produktive oder reproduktive Techniken.
2.
Es gibt zwei Begriffe in dem Buch von Gunther Teubner, an denen ich mit weiteren Überlegungen zur Geschichte und Theorie der Anthropofagie ansetzen würde. Da ist zum einen der Begriff der Verschleifung, zum anderen der Begriff der Unbestimmtheit. Beide Begriffe tauchen in dem Buch gleich zum Anfang auf, beide im Kontext der berühmten Geschichte um Rabbi Eliezer. Dessen wohl begründete Rechtsauffassung wurde von den anderen Rabbis nicht geteilt, also griff der Rabbi zum Beweis der Richtigkeit seiner Auffassung auf Wunder, Außerkraftsetzung der Naturgesetze und die himmmlische Stimme Gottes zurück, nur half das dem Rabbi Eliezer alles nichts. Gott lachte am Ende der Geschichte. Teubner schreibt, dass Rabbi Eliezer (trotz oder gerade weil Gott lachte) schmerhaft erfahren musste, dass das Recht nicht durch "externe Autoritäten" bestimmt, nicht durch die Autorität der Texte, nicht durch weltliche Macht, nicht durch das Recht der Natur, nicht durch göttliche Offenbarung bestimmt sei. Die Geschichte sage etwas über die Nichtdeterminierbarkeit des Rechts, so Teubner, mit einem Zusatz: von außen!
Die Nichtdeterminierbarkeit von Außen assoziiert er in dieser Deutung mit einer Undurchschaubarkeit des Rechts, also vielleicht sogar mit dem Unvermögen, sehen oder sagen zu können, wo denn der Übergang von Außen nach Innen oder von der Selbstreferenz zur Fremdreferenz liege. Er verbindet die Geschichte weiter mit dem Begriff der Nicht-Steuerbarkeit und schließlich kommt er damit auch zum zweiten Begriff , dem der Verschleifung, die er auch zirkuläre Struktur nennt. Diese Verschleifung beschreibt er im Hinblick auf normative Stratifikation, also in Bezug auf den Unterschied höherer und niederer Normen oder höherer und niederer Rechtsquellen. Das Recht operiere wie eine nicht-triviale Maschine. Es sei synthetisch determiniert, aber analytisch nicht bestimmbar, sei vergangenheitsabhängig, aber nicht voraussagbar. Was Teubner in dem Buch als Unbestimmtheit und Verschleifung beschreibt, soll in Bezug auf die Geschichte und Theorie der Anthropofagie weiter gedacht werden.
Meine Frage lautet, ob sich nicht die Geschichte und Theorie der Anthropofagie auch im Kontext dessen entwickelt, was Teubner dort als Unbestimmtheit und Verschleifung beschreibt. Die These, dass das so ist, sollte klein gehalten werden. Das heißt, dass es in den Forschung zu Anthropofagie und Recht nicht darum gehen kann, allgemeine Rechtstheorie oder allgemeine Theorie der Anthropofagie zu werden. Auch soll keine Universalgeschichte des Rechts oder der Anthropofagie entworfen werden. Was die Arbeiten der brasilianischen Moderne, der 'niederen Anthropologie' (Eduardo Viveiros de Castro) oder von Aby Warburg für eine Geschichte und Theorie von Recht produktiv macht, das liegt meines Erachtens unter anderem darin, die von Teubner genannte Unbestimmtheit weiter als Unbeständigkeit zu denken, sie sich weder leer noch homogen vorzustellen, dabei keine Unterscheidung, auch nicht die zwischen innen/außen oder zwischen Selbst- und Fremdreferenz zur letzten Größe gerinnen zu lassen, also auch nicht den Verlockungen des Dogmas großer Trennung zu erliegen. Das Verschlingen ist eine juridische Kulturtechnik, darin liegt eine Praxis des 'Verschleifens', die sich auch unabhängig von eingerichteten Normenhierarchien entwickelt hat, und zwar u.a. als Praxis der Gastfreundschaft, der Übersetzung und dessen, was Aby Warburg Distanzschaffen nennt.
2 notes
·
View notes
Text
Gender und Geschlechtsidentität - Verständnis der Unterschiede 🌍💭
Der Begriff Gender bezieht sich auf die sozialen, kulturellen und individuellen Aspekte von Geschlecht, die über die biologischen Merkmale hinausgehen.
Geschlechtsidentität hingegen beschreibt die individuelle persönliche Erfahrung und Identifikation mit einem bestimmten Geschlecht, unabhhängig von biologischen Faktoren.
Es ist wichtig, die Unterschiede zu erkennen und Vielfalt anzuerkennen. 💡💖
Warum ist es wichtig Vielfalt anzuerkennen 🤝💬
Die Anerkennung und Unterscheidung von verschiedenen Identitäten und Erfahrungen ist entscheidend für ein respektvolles Miteinander und eine inklusive Gesellschaft. Indem wir die Vielfalt anerkennen, schaffen wir Raum für Selbstbestimmung, Respekt und Wertschätzung für alle. Es ist wichtig, die Unterschiede zu verstehen, um Vorurteile abzubauen und Diversität zu feiern. 💖✨
©️®️nordhessenseniorin - CWG, Pfingstmontag, Mai 2024
#Anerkennung #Vielfalt #respekt #Gender #Geschlechtsidentität #biodiversität #naturgesetze #naturkreisläufe #alleshatseinensinn #alleshateinensinn #cwg64d #cwghighsensitive #nordhessenseniorin #oculiauris #florianatopfblume
2 notes
·
View notes
Text
Dracula und sein Schatten

Stoker porträtiert Dracula in seinem gleichnamigen Roman als ein Wesen, das keinen Schatten wirft.
Und doch ist er umgeben von ihnen: Vor allem bei Jonathan Harkers Ankunft in Transsylvanien und im Schloss des Grafen beschreibt Stoker eine Welt voller Schatten, Dunkelheit und Zwielicht, die die bedrückende und bedrohliche Atmosphäre unterstreichen, der Harker ausgeliefert ist. Noch mehr löst der fehlende Schatten seines Gastgebers Misstrauen und Unbehagen in ihm aus.
Der junge Anwalt, der sonst rational handelt und von Regeln und Ordnung überzeugt ist, zweifelt allmählich an der Realität und an den Naturgesetzen seines vertrauten Weltbilds. Harker starrt immer eindringlicher auf seinen eigenen Schatten, um sich zu versichern, dass die gegebenen Naturgesetze noch gelten.
Diese Zweifel an der Logik und der Aufrechterhaltung der bekannten Normen sind eine übliche Methode der Schauerliteratur und übernatürlichen Literatur, um Spannung zu erzeugen.
Durch seinen fehlenden Schatten rückt Dracula in den Raum des Übernatürlichen und Unmenschlichen und positioniert sich als das bedrohende Andere. Dadurch scheint er für Harker nicht greifbar und keine reale Person zu sein; aber auch für Leser:innen, für die ja dieselben Gesetze gelten wie für den Protagonisten.
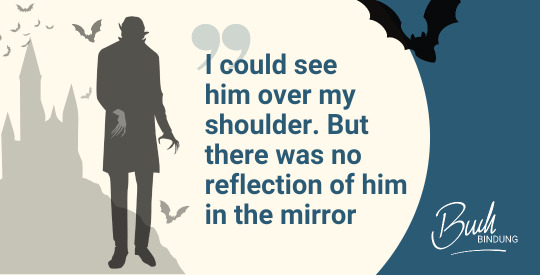
Ebenso besitzt Dracula keine Reflektion im Spiegel, die normalerweise identitätsstiftend ist: Der Graf scheint ohne Schatten und ohne Reflektion kein eigenes Selbst zu besitzen.
Das wird auch in seinem bestialischen Verhalten deutlich, wenn er das Blut seiner Opfer trinkt, sich die Identitäten der Menschen einverleibt, um selbst zu überleben - zu existieren.
Obwohl Dracula umgeben ist von Schemen und Dunkelheit, findet er wegen seines fehlenden Schatten weder in dieser „Schattenwelt“ noch in der irdischen, menschlichen Welt einen Platz und ist dazu verdammt, sich ruhelos zwischen diesen Welten zu bewegen.
Auch das verstärkt seine Position als bedrohliche Instanz, die für den logischen Menschenverstand nicht erklärbar ist. Auffallend ist seine selbstbezeugte Affinität zu Schatten und zur Dunkelheit, wenn er beteuert: „I love shade and shadow“.
Einerseits nutzt er die undurchsichtigen Merkmale der Dunkelheit und des schummrigen Lichts für seine Zwecke aus, andererseits ist er fasziniert von etwas, das er selbst nicht besitzt und auch nicht erreichen kann: einen eigenen Schatten zu werfen - und damit menschlich zu sein.
Auch das Spiel von Licht und Schatten, von Tag und Nacht, und die Umkehrung dieser beiden Zeiten machen es deutlich, dass sein "Gast" Jonathan Harker in einer anderen, verkehrten Welt erwacht. Er zweifelt an seiner visuellen Wahrnehmung, wenn er Dracula sich wie eine Echse die Schlossmauer entlang bewegen sieht, und hält dies im ersten Moment für einen Trick des Mondlichts oder für einen seltsamen Schatteneffekt.
Verstärkt wird dieser Eindruck auch durch durch seine bloße nächtliche Existenz seit seiner Ankunft im Schloss und die ausschließlichen Begegnungen mit dem Grafen bei Dunkelheit oder Nacht.
Ebenso wie sein Tag-/Nacht-Rhythmus ist auch sein Glaube an die Wissenschaft verkehrt worden. In seiner Hilflosigkeit und Unsicherheit versucht er daher, Aberglaube und Wissenschaft zu vereinen.
Nicht nur Draculas abnormale Existenz - ohne eigenen, nur zwischen fremden Schatten - beeinflussen Harkers Verstand, sondern auch die unvertraute Landschaft, in der er sich wiederfindet.

Das unbekannte, dunkle Transsylvanien ist ihm durch die unvertraute Sprache, aber auch durch den ländlichen Aberglauben fremd. Trotz der Wegbeschreibungen der Einheimischen hat er Schwierigkeiten, das Schloss ausfindig zu machen und ist völlig orientierungslos, da seine Umgebung in Schatten und Zwielicht versinkt.
Stoker bedient sich sowohl des Licht- und Schattenspiels als auch der Abwesenheit eben jener Schemen, um den Einfluss der Umgebung auf die menschliche Psyche darzustellen.
#book quotes#dracula#bram stoker#bram stokers dracula#vampire#gothic horror#supernatural literature#schauerliteratur#german blog#buchtipp#buchblogger#buchzitat#vampirgeschichte#english literature#irish literature#englische literatur#literatur#bücher#buchempfehlung#buchblog#gothic fiction#victorian literature#viktorianische literatur
4 notes
·
View notes
Link
0 notes
Text
Karneval Unterrichtsmaterial Physik
Karneval im Physikunterricht – Spielerisch Naturgesetze entdecken 🎭⚙️ Karneval ist nicht nur bunt und fröhlich, sondern auch ein spannendes Thema für den Physikunterricht! Von der Bewegung der Karnevalswagen über den Flug der Konfetti bis hin zur Akustik von Karnevalsmusik – überall steckt Physik drin. Hier findest du Unterrichtsmaterial zu Karneval in der Physik, das ohne komplizierte Formeln…
0 notes
Text
Das Wetter gehaarpt?
Wer braucht schon Naturgesetze, wenn man geheime Technologien hat, die das Wetter kontrollieren können, oder? Natürlich hat die Wissenschaft hier nichts zu melden, das wahre Wissen wird ja bekanntlich auf obskuren YouTube-Kanälen und in dunklen Ecken von Telegram-Gruppen verbreitet. Und ganz vorne mit dabei: Ein Galileo-Beitrag, der diese Theorie endlich bestätigt haben soll. Nun, wenn es…

View On WordPress
0 notes
Text
+++××+++++#Die #Grenze#Teil2++××+××××+×
By#Jackie PalmerJr×××+××××+××××××××××+×+
Die Baumgrenze als Grenzziehung ist sehr interessant und wichtig, das habe ich in Teil 1 einfach und kurz dargestellt. Die Grenze als Tatsache, insgesamt Grenzen als Tatsachen oder Irrtümer werden hier von mir nun weiter veranschaulicht und überlegt. Heute möchte ich gerne das Gebiet der Schneegrenze ziehen.
Mich interessiert, was bedeuten im Sinne einer Grenze, eines Territoriums oder einer ökologischen Superkraft Systeme wie der Nord-und Südpol, Nordpol versus Südpol?. Ich setze voraus, dass ihr alle schon irgendwie und irgendwas von der Abschmelzung, der Umkehrung der Pole gehört habt, darauf kommt es aber jetzt nicht an, es soll nur zeigen, dass sich alles ändert, auch Naturgesetze und Zäune.
Die Menschen (wir alle) wissen allgemein einiges über den Nordpol und eher wenig über den Südpol weil für den Südpol eine vertragliche Verbotszone erlassen wurde, zum Schutz. Keine 4000 Menschen, angeblich alles Wissenschaftler- sind auf dem Kontinent Südpol zugelassen der 1½ mal größer ist als Europa. Das ist viel..
Mein Interesse ist es allerdings nicht, diese eiskalten Giganten geographisch zu erläutern. Hier gibt es keinen Erdkundeunterricht von mir für die Oberstufe, sondern diesbezüglich maximal einen Einführungskurs für blutige Anfänger. Philosophisch aber wird es kalt. Nun gut. Was lässt mich vermuten, dass Nordpol und Südpol insgesamt ideale "Anschauungsplaneten" sind in Hinsicht von Grenzen? Nicht wegen dem Maßstab Achse und so weiter. Auch nicht alleine wegen deren permanenter Schneegrenze.
Zunächst braucht der normale Mensch ein sichtbares Zeichen dafür, dass sein Territorium zu Ende ist. Dieses Zeichen wird beim Südpol anders selbstverständlich gemacht als beim Nordpol. Die Erde, der Kosmos, die Evolution setzen extreme Zeichen, zeigen Mensch wie Tier Grenzen auf. Der Mensch kann diese durch die "Natur" aufgezeigten Grenzen trotzdem irgendwie bezwingen, verändern aber sollte der Mensch diese kosmischen Gewalten nicht, nur schützen.
Nordpol und Südpol haben menschlich betrachtet viele gemeinsame Sinnbilder. Alle Verträge für Nordpol und Südpol haben andere Inhalte, Absichten. Niemand würde jemals auf die Idee kommen, den Weihnachtsmann am Südpol zu suchen. Selbst kleinen Kindern kommt das logisch vor. Unendliche Massen von Kälte und Eis bedeuten eben nicht automatisch "der Weihnachtsmann lebt dort", der Weihnachtsmann kann aus vielen Gründen niemals am Südpol leben. Eigentlich bedeutet es das seelige Ende der Gesamtforscherei, für den Südpol. Weil der Südpool abgesehen von minus 89,06 Grad drollig erscheint.. Weniger drollig aber sind die Reisekosten in das abgeschottete Eisparadies.
Betrachtet man sich einmal das finanzielle System, bezahlt man für einen 10 bis 12 Tage dauernden Aufenthalt in der Arktis (Nordpollage) Durchschnittlich bis 8000 US-Dollar, für die Antarktis (Südpollage) blättert man für Camps bis 151 000 US-Dollar hin, pro Person, und das ohne Sterne Comfort. Jetzt kann man erahnen wo man ist. Beiden Urlaubslandschaften gleich ist, man ist Im Prinzip nirgends. Weil nämlich tatsächlich gar nichts anerkannt wird, nur proforma. Man hält sich- besonders beim Südpol- sowohl in, unter und auf einem Kontinent, oder bei der Arktis auf einer Eisscholle auf, welche eigentlich niemandem gehören dürfen. Ein Kontinent, der niemandem gehört braucht Schutz. Wenn niemand da ist, weil es zu kalt ist, dann braucht man zunächst auch keinen Grenzschutz. Am Nordpol ist es zwar ähnlich aber anders ähnlich, die vielen Grenzen sind einzuhalten, sind aber wahrscheinlich nicht dauerhaft. Ohne Pass und Erlaubnis dagegen und einfach vor Ort: Der Eisbär. Verschwiegen, fast unsichtbar und hungrig. Eisbären, mit einer Länge bis zu 3 Metern und 500 kg schwer liegen sie wartend auf dem Bauch und beobachten Blubberblasen von abgetauchten Robben, eiskalt. Der Eisbär wartet gut getarnt so lange auf sein Mahl, bis die gute Robbe wieder auftauchen muss. Strategie und Verhaltensmuster von Jägern und Gejagten ähneln in etwa dem Menschen. Überhaupt sind Jagdgebiete der Tiere und Fanggebiete der Menschen gut erklärbar auf und in der Arktis. Die Arktis ist im Allgemeinen gut erklärt. Grundsätzlich befinden sich am Nordpol keine Pinguine. Diese gibt es nur am Südpol. Es gibt genaue Gründe. Der sicherste Grund scheint der zu sein- gebe es Eisbären am Südpol, gäbe es dort keinen einzigen Pinguin mehr. Alle wären durch Eisbären radikal gefressen worden. So intelligent ist die Manufaktur Erde, temporär Natur genannt. Der Eisbär ist ein hohes Symbol für Menschen. Wer Jagd auf Eisbären macht ist sehr mächtig und mutig. Es gibt noch ein drittes Tier im Spiel der Superpole. Den Albatros. Ein Vogel. Der Albatros hat eine riesige Gemeinsamkeit mit dem Eisbären. Der Eisbär, Herrscher am Nordpol; doch wer ist scheinbar hier tierischer Herrscher am Südpol? OK. Die Flügelspannweite des Albatros kann bis zu 3,5 Meter betragen, mehr als die Standhöhe von Eisbären. Das bedeutet, dass beide Tierarten das gleiche Erleben von Macht haben und Gelassenheit. Dagegen trumpfen Pinguine als Masse auf, begleitet von Albatrossen, den Giganten der Lüfte. Würde jetzt ein Bild gemalt werden, kann man nicht ohne Weiteres den Südpol als Kältekammer mit tausenden Metern dickem Eises erklären und einer Hand voll roter Unterkünfte. Den Südpol könnte man auch tropisch verklären mit Palmen und mit samt deren Bewohnern, den Pinguinen und Albatrossen, wäre kein Eis vorhanden. Diese Tierarten wirken doch eher tropisch- in eine bizarre Welt passend. Deswegen gehört vom Gang, dem Flug, dem Aussehen keinesfalls ein Pinguin oder Albatros in die Welt des Nordpols. Die Welt des Nordpols ist optisch komplett anders. Die Welt der Arktis ist streng, hat keine spielerischen Gesetze, wie die des Südpols. Die Welt des Südpols hat Zerwürfnisse, drollige unbeholfene Zerwürfnisse. Der Pinguin schwimmt brillant. Der Albatros fliegt königlich. Dieses System passt keinesfalls in einer Art von vereinfachter wüstenhafter Weltraumkälte. Die Tiere am Südpol haben körperlich betrachtet widersprechende Gesetze. Vielleicht verwandelte sich ein tropisches Paradies quasi blitzschnell in ein gigantisches Umfeld von Eis. Nur Eis. Es fällt fast kein Schnee am Südpol. Die Schneegrenze- und heute geht es mir hier im Text im inneren Kern um die Schneegrenze- diese liegt am Südpol bei 0 Metern, demnach Meereshöhe. Am Kilimandscharo liegt diese Schneegrenze bei 6000 Metern.
Gigantisch am Äquator und kaum zu glauben Schnee am Kilimandscharo. In Afrika. Dort wo es extrem heiss ist. Na klar schneit es dort auf 6000 Höhenmetern. Das leuchtet ein, und trotzdem wirkt es extrem bizarr wenn man unten vor Hitze schwitzt. Der Mensch ist demnach Extremlagen ausgesetzt. Die Schneegrenze in mittleren Breiten aber liegt bei 3000 Metern. Dort ist es kalt genug. Man muss sich vorstellen wie perfektioniert die Erde funkt und angefunkt wird.
Die Schneegrenze ist kalkulierbar. Sie ist wichtig. All diese Grenzen der Natur sind wichtig und extrem wirkungsvoll und wertvoll. Der Nordpol, der Südpol, Schnee am Kilimandscharo und überall fällt Schnee, auf 0 Metern, oder erst ab 6000 Metern. Diese Systeme sind immer mit naturwissenschaftlichen Gesetzen verbunden. Das überhaupt noch Schnee fällt liegt daran, dass der Mensch die Erde nicht vollkommen beherrscht. Sonst wäre bereits die ganze Welt Kilimandscharo, oben am Gipfel schneit es und unten Schnitzeljagd. Dem Menschen sind demnach durch die Schöpfung Grenzen gesetzt. Schneegrenzen, Baumgrenzen und territoriale Grenzen. Soweit zum Thema Schneegrenzen. PS. Der ausgezeichnete Film mit dem afrikanischen Berg ist hier nicht gemeint, aber er erscheint dir vielleicht als Gedächtnisanker.
Danke fürs Lesen. JackiePalmerJr
0 notes
Link
0 notes
Text
Mein ehrwürdiger Thomas,
ich danke Dir für Deinen langen und tiefgründigen Brief. Es ist mir eine Ehre, mit einem Denker von solch großem Scharfsinn und Glauben in Dialog treten zu dürfen. Dennoch, obwohl ich Deinen Worten Respekt zolle, empfinde ich mich verpflichtet, mit der gleichen Leidenschaft und Radikalität zu antworten, mit der ich jene Worte ausrief: „Gott ist tot.“ Deine Argumente mögen beeindruckend erscheinen, doch ich halte sie für nichts anderes als einen kunstvoll errichteten Bau, der auf einem Fundament ruht, das bereits zerbrochen ist.
Die Zeit des Glaubens ist vorbei
Du sprichst von Gott als der Quelle allen Seins, der ewigen Ursache und der unerschütterlichen Grundlage der Welt. Doch, Thomas, ich frage Dich: Warum ist es notwendig, eine metaphysische Instanz zu behaupten, die hinter allem steht? Diese Notwendigkeit entspringt nicht der Welt selbst, sondern der tiefen Angst des Menschen vor einem Universum ohne festen Grund. Der Mensch hat Gott erfunden – nicht Gott den Menschen. Deine Philosophie, so elegant sie ist, dient letztlich der Absicherung einer moralischen und kosmischen Ordnung, die Du als gegeben voraussetzt. Doch was, wenn diese Ordnung nichts als ein Konstrukt ist?
Ich rufe aus: Gott ist tot! – und mit diesen Worten will ich nicht sagen, dass eine metaphysische Wesenheit buchstäblich gestorben sei. Nein, ich spreche von der kulturellen, spirituellen und moralischen Realität der westlichen Welt. Gott, wie er in der christlichen Tradition verstanden wird, hat seine Macht über die Seelen der Menschen verloren. Er ist nicht mehr die Mitte ihres Denkens, Handelns und Empfindens. Der Glaube an Ihn ist verblasst, und das nicht aufgrund eines Fehlers oder eines moralischen Verfalls, sondern weil der Mensch selbst gereift ist und erkannt hat, dass er keinen Gott mehr benötigt.
Die Welt ist ohne Zweck
Deine Rede von Gott als der „ersten Ursache“ ist Teil eines überkommenen metaphysischen Denkens, das von einem Zweck und einer Ordnung im Universum ausgeht. Doch die Welt, wie sie sich dem ehrlichen Blick zeigt, ist ohne Zweck. Es gibt keine „erste Ursache“, keine absolute Notwendigkeit, die den Lauf der Dinge erklärt. Die Wissenschaft hat längst die Kausalitätskette, die Du als Grundlage Deines Arguments siehst, in Frage gestellt. Die Evolution, die Naturgesetze, die chaotische Bewegung des Kosmos – all dies verweist auf eine Welt, die sich selbst genügt und keinen Gott benötigt, um erklärt zu werden.
Der Mensch hat sich über Jahrtausende an die Illusion geklammert, dass das Universum für ihn gemacht sei, dass es einen göttlichen Plan gäbe, der alles durchdringt. Doch dieser Glaube ist nichts als eine Projektion menschlicher Wünsche. Es ist an der Zeit, die grausame Wahrheit zu akzeptieren: Die Welt ist ein Spiel des Zufalls, ein Chaos, ohne Ziel oder Sinn. Gott war der Name, den wir diesem Chaos gaben, um es zu bändigen, doch jetzt hat der Mensch die Kraft, diesem Chaos ins Gesicht zu blicken – ohne die Krücke eines göttlichen Plans.
Die Moral ohne Gott
Du fürchtest, dass der Tod Gottes die Grundlage der Moral zerstört. Doch ich sage Dir, Thomas: Eine Moral, die auf einem Gott beruht, ist eine Moral der Schwäche. Es ist eine Moral der Knechte, die nicht aus sich selbst heraus die Kraft finden, ihre Werte zu schaffen, sondern sie einem äußeren Gesetzgeber unterwerfen. Der Mensch, der an Gott glaubt, verzichtet auf seine eigene Verantwortung und sucht Zuflucht in ewigen, absoluten Geboten, die ihm von außen auferlegt werden.
Doch der Tod Gottes eröffnet dem Menschen eine neue Möglichkeit: die Möglichkeit, seine eigene Moral zu schaffen. Der Übermensch, den ich in meinen Schriften beschrieben habe, ist nicht mehr an die alten Werte gebunden. Er erkennt, dass alle Werte menschengemacht sind und dass es an ihm liegt, neue Werte zu setzen. Dies ist keine moralische Anarchie, sondern ein Ruf zur schöpferischen Freiheit. Der Tod Gottes bedeutet nicht das Ende der Moral, sondern den Beginn einer neuen Ära, in der der Mensch zum Schöpfer wird.
Die Hoffnung jenseits von Gott
Du sprichst von Gott als der Quelle der Hoffnung und des Trostes. Doch ist nicht genau dies der Beweis, dass der Glaube an Gott ein Produkt menschlicher Schwäche ist? Der Mensch hat Gott erfunden, um seine Ängste zu besänftigen, um Trost zu finden in einer kalten und gleichgültigen Welt. Doch ich frage Dich, Thomas: Ist es nicht eine größere Kraft, die Welt so zu akzeptieren, wie sie ist, ohne Illusionen, ohne falschen Trost?
Die wahre Hoffnung liegt nicht in einem Leben nach dem Tod, sondern in der Überwindung des Menschen in diesem Leben. Der Tod Gottes befreit den Menschen von der Illusion eines jenseitigen Heils und ruft ihn auf, sein Schicksal hier und jetzt zu gestalten. Es ist eine tragische Hoffnung, gewiss, doch eine, die der Größe des Menschen entspricht. Der Mensch ist dazu bestimmt, sich selbst zu übersteigen, nicht durch einen Gott, sondern durch seine eigene schöpferische Kraft.
Ein neuer Anfang
Thomas, ich respektiere Deine Weisheit und Deinen Glauben, doch ich sehe in Deiner Philosophie ein Festhalten an einem Zeitalter, das vorüber ist. Der Tod Gottes ist kein Grund zur Verzweiflung, sondern ein Aufruf zur neuen Schöpfung. Der Mensch, der Gott hinter sich lässt, gewinnt die Freiheit, sein eigenes Leben und die Welt neu zu gestalten.
Lass uns also nicht trauern um einen toten Gott, sondern uns freuen über die Möglichkeiten, die dieser Tod uns eröffnet. Die Welt ist größer, als sie je war, und der Mensch, der diese Welt ohne Gott akzeptiert, ist größer als je zuvor.
In diesem Geiste lade ich Dich ein, Deinen Blick zu weiten und den Mut zu finden, das Denken von der Last Gottes zu befreien. Der Tod Gottes ist nicht das Ende, sondern ein neuer Anfang – ein Anfang, der uns die Chance gibt, wahrhaft Mensch zu sein.
Mit radikaler Aufrichtigkeit,
Friedrich Nietzsche
0 notes
Text

Raubvogel in Kugelbaum. Dez 2024 Schwere Zeiten kommen zu auf Deutschland. Die Linksregierung hat innerhalb von 3 Jahren vollendet, was Merkel vorbereitet hatte. Die totale Zerstörung einer der größten, der wichtigsten Volkswirtschaften der Welt. Für unsere Kleinfamilie wird es eng werden. Deswegen fange ich schon jetzt an, auf Armen-Photographie umzustellen. Vulgo auf "Digital". Kost nix außer Speicherplatz und bißchen Ladestrom. Jeden Monat ne 100Fuß-Rolle Film, deren Preis sich in den letzten Jahren fast verdoppelt hat, plus die ständig sich verteuernde Chemie, das wird auf lange Sicht nicht mehr drin sein. Danke, liebe Linke*. Ihr habt mal wieder bewiesen, daß es auch in der Politik Naturgesetze gibt. Links endet immer immer immer in Hunger und Polizeistaat.
Ein Glück, daß wenigstens die Sonne keine Rechnung schreibt. -- * Unter "Links" versteh ich alles, was links der Brandmauer rumturnt. Inklusive der CDU. Bei der FDP bin ich mir nicht sicher.
0 notes
Text
Die Alpha-Greise
Manova: »Sie müssen nicht unbedingt weiß sein — aber alt und männlich sind sie dann doch meistens: unsere Führungspersönlichkeiten. Es scheint eine Art Naturgesetz zu sein, dass wir bis weit zurück in der Menschheitsgeschichte beobachten können. Und sogar in der Tierwelt, speziell auch bei unseren engsten Verwandten, den Affen. Männer dominieren Frauen, und Alte dominieren Junge. Während das erstere „Gesetz“ in modernen Zeiten schon da und dort Lücken aufweist, scheint das zweitere fast unumschränkt weiter zu gelten. Das von Testosteron angetriebene Alphatier in der Politik hat viel mit dem sich auf die Brust trommelnden dominanten Männchen einer Gorilla-Horde gemeinsam. Aber auch im privaten Bereich schwingen Patriarchen weithin das Zepter. Sie herrschen, drohen, strafen und wollen das größte Stück und möglichst alle Weibchen für sich. Auch religiöse Führer und selbst das traditionelle Bild von Göttern beziehungsweise „Gott Vater“ zeugen von einer weit verbreiteten Gerontokratie, der Herrschaft der Alten. Dabei kennt die Geschichte auch positive Gegenbeispiele, etwa den Kult um Göttinnen mit etwas größerer Sozialkompetenz. Es ist gut, sich diese Zusammenhänge bewusst zu machen, um die Herrschaft der Alpha-Greise nach Möglichkeit zu begrenzen. Dies wäre auch gut für die Etablierung einer wirklichen Demokratie. Ein Beitrag zum „Alt und Jung“-Spezial. http://dlvr.it/TGn6nG «
0 notes