#engführung
Explore tagged Tumblr posts
Text
"Years.
Years, years, a finger
fumbles downwards and upwards, fumbles
around:
seams, tangible, here
it gapes wide open, here
it grew back together - who
covered it up?"
2 notes
·
View notes
Text
Freiheitsindex 2023 - Forschungsprojekt

Den Freiheitsindex 2023 veröffentlichten das Institut für Demoskopie Allensbach und Media Tenor International - Grundgesetz im Abseits. Freiheitsindex 2023 gegen Grundgesetz Gemäß Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Art 5 soll die Meinungs- und Pressefreiheit garantiert sein. "(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt." Die Meinungs- und Pressefreiheit gehört demgemäß zu den festgeschriebenen unveräußerlichen Bürgerrechten - doch die Praxis sieht nicht nur gefühlt anders aus. Das legt zumindest erneut die Studie "Bricht die Mauer des Schweigens?" nahe. Diese veröffentlichten das Institut für Demoskopie Allensbach (IfD) und Media Tenor International Zürich im Rahmen eines Forschungsprojektes: "Zum ersten Mal, seit das Institut für Demoskopie in Allensbach die Deutschen fragt: 'Traut Ihr Euch, Eure Meinung zu sagen', antworten weniger als 40 Prozent mit 'Ja'." Gefühl der Meinungsfreiheit ist stark gesunken Die Autoren der Studie verweisen darauf, dass die Frage "Traust du dich, deine Meinung zu sagen?" von den Experten des IfD Allensbach seit 1953 regelmäßig gestellt wird. Doch: "Seit dem Fall der Mauer, als 1990 noch 78 Prozent der Deutschen diese Frage ausgesprochen zuversichtlich beantworteten, sind die Werte zunächst mit der Regierung Schröder, dann unter Merkel stetig gefallen, um nun zur Halbzeit der Ampel ihren historischen Tiefpunkt zu dokumentieren." (Ebd. S. 12) So hätten sich 2019 noch 50 Prozent der Befragten getraut "so zu sprechen, wie ich möchte" und sich dabei nichts vorschreiben zu lassen (S. 23). Im Jahr 2023 trauten sich das nur noch 33 Prozent. Nach der Analyse der Autoren haben die öffentlich-rechtlichen Medien einen nicht unbedeutenden Anteil an dieser Entwicklung. "Angesichts dieser inhaltlichen Engführung, die seit Jahrzehnten von ARD, DLF und ZDF in ihren Nachrichtenformaten angeboten wird, ist selbst an Hochschulen keine vielfältige Diskussion in Respekt des jeweils anderen zu erwarten – sofern die Menschen ihre Informatonen allein auf Basis des öffentlich-rechtlichen Angebotes beziehen." (Ebd. S. 40) Vorbei die Zeit, als die Studenten lautstark sangen: "Die Gedanken sind frei..." Keine ausgewogene Berichterstattung über wirtschaftliche Themen Doch es geht in der Studie nicht nur um Meinungen zu Freiheit im politischen Kontext. Die Berichterstattung über wirtschaftliche Themen offenbart, dass dem Umfeld der Masse der Beschäftigten und ihren unmittelbaren Erfahrungen ebenfalls nur wenig Raum eingeräumt wird. "Doch die Grafik zeigt, dass die deutschen Leitmedien den Bürgern eine andere Sicht auf das Wirtschaftsleben vermitteln: Das Gros der Berichte kreist um die Börse – eher selten wird der deutsche Mittelstand und seine erfolgreichen 'Hidden Champions' – von den 3.300 Weltmarktführern einzelner Branchen haben 1.700 ihren Ursprung und Stammsitz (noch) in Deutschland – sichtbar." Eine Quelle für eine wenig informative Berichterstattung zu wirtschaftlichen Fragen im Erfahrungsfeld der Bürger sehen die Autoren der Studie in der Kompetenz der berichtenden Journalisten. "Berichte (vor allem in Wirtschaftsressorts) mit grotesken Fehlern, weil das Lesen von Bilanzen offensichtlich manche Redaktionen vor schier unüberwindbare Schwierigkeiten stellte, weil zu wenige, die über die Wirtschaft, Wirtschaftspolitik und das Unternehmensleben berichten, sich dort auskannten." (Ebd. S. 61) Darüber hinaus verweisen die Autoren auch auf einen auffälligen Unterschied in der Wirtschaftsberichterstattung zwischen US-amerikanischen und deutschen Medien. Freie Meinungsäußerung Die Autoren schreiben, dass jahrzehntelang die große Mehrheit - zwei Drittel - der Bevölkerung der Meinung war, man könne in Deutschlnad seine politische Meinung frei äußern. Im Jahr 2021 betrug der Anteil nur noch 45 Prozent. Im Jahr 2023 sank der Wert auf ein Rekordtief von 40 Prozent. "Damit ist nun endgültig deutlich geworden, dass das überraschende Ergebnis aus dem Jahr 2021 nicht ... allein eine Folge der Sondersituation während der Corona-Pandemie war, wenn es auch durch diese mit ausgelöst worden sein kann, sondern Ausdruck eines grundsätzlichen Wandels im öffentlichen Klima." (Ebd. S. 72) Insgesamt bieten die Aussagen der Befragten und der Studienautoren sicher zahlreiche Ansatzpunkte für eine streibare Auseinandersetzung. Unbestritten dürfte jedoch sein, dass die Tendenzen nicht gerade für eine anwachsende demokratische Entwicklung in Deutschland sprechen. Lesen Sie den ganzen Artikel
0 notes
Text
Kam, kam.
Kam ein Wort, kam
kam, durch die Nacht,
wollte leuchten, wollte leuchten.
Asche.
Asche, Asche.
Nacht.
Paul Celan, Engführung
1 note
·
View note
Text

#books and libraries#deutsche poesie#gedicht#elfchen#paul celan#poetry#buch#tintenherz#cornelia funke#lieblingsbuch#asche#worte#nacht#engführung
0 notes
Photo

Erzbistum schaltet Webauftritt der Studenten ab
Vor einem halben Jahr erlaubt - heute verboten
Da schauen wir immer nach Brüssel, um zu sehen, welche bösen Zensur- und Überwachungsmaßnahmen die Staaten über die EU Kommission versuchen uns überzustülpen. Dabei gibt es die Zensurversuche bereits aus voreilendem Gehorsam oder überkommenem Obrigkeitswahn bei uns im Lande.
Nun schon zum dritten Mal können wir den AStA der Uni Köln zitieren:
Solidarisierung mit der Katholischen Hochschulgemeinde Köln
In der vergangenen Woche war der regionalen und überregionalen Presse zu entnehmen, dass das Erzbistum Köln die Internetpräsenz der Katholischen Hochschulgemeinde (KHG) Köln kurzfristig abgeschaltet und die Verbreitung deren Programms für das Wintersemester 2020/21 untersagt habe, sowie den Mitarbeiter*innen mit negativen dienstrechtlichen Konsequenzen drohe. Auslöser war ein Positionspapier zu aktuellen kirchenpolitischen Fragen, dass bereits im Mai 2019 veröffentlicht worden war. In dem Papier wendet sich die KHG unter anderem gegen mangelnde Wahrnehmung von gesellschaftlicher Verantwortung, gegen religiöse Aufladung von Macht(-strukturen), sowie gegen die Engführung kirchlicher Sexualmoral.
Die Vertretung der Studierendenschaft der Universität zu Köln blickt auf eine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der KHG zurück. Sei es bei Projekten zu Nachhaltigkeit & Ökologie, wie dem Fairteiler oder bei sozialen Projekten zum Thema Wohnen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die KHG stets ein Ort des Austausches war, auch für Studierende, welche mit Religiosität oder Kirche ansonsten überhaupt nichts anfangen können.
Für diese Offenheit und das Recht, die eigene Meinung kundtun zu können, tritt der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der Universität zu Köln mit Vehemenz ein. Er stellt sich daher ausdrücklich gegen jede Form von Zensur und solidarisiert sich mit den hauptamtlichen Mitarbeiter*innen der KHG.
AStA der Universität zu Köln Universitätsstraße 16, 50937 Köln
Wir können den Betroffenen nur den Rücken stärken - die Zensur eines Webservers ist eine Ungeheuerlichkeit. Die Inhalte haben kein Gesetz verletzt und wurde vor einem halben Jahr im Mai gleichlautend von den Studenten der KHG (wenn auch nicht auf diese Weise) verbreitet. Alle Versuche von Zensur und Maßregelung verurteilen wir aufs Schärfste.
Mehr dazu bei http://www.asta.uni-koeln.de/2020/11/27/solidarisierung-mit-der-katholischen-hochschulgemeinde-koeln/
und https://www.aktion-freiheitstattangst.org/de/articles/7466-20201128-erzbistum-schaltet-webauftritt-der-studenten-ab.htm
1 note
·
View note
Photo

Schluss mit der Markt-Idolatrie!
“Die Bildungsaufgaben werden so gestellt, dass die Studierenden so lange über sie hasten müssen, bis am Ziel alle das Gleiche denken. Es sind keine Abzweigungen vorgesehen, die kritisch hinterfragen oder andere Gedankengänge anbieten. Das ist eine Engführung, die im Unbewussten verläuft und mit unheimlichem Druck über Klausuren, Noten und die Autorität der Disziplin erzeugt wird. Mit eigenem Denken hat das rein gar nichts zu tun.”
Prof. Silia Graupe
0 notes
Text
[Kritische Dialoge üben](http://fairmuenchen.de/kritische-dialoge-ueben/ "http://fairmuenchen.de/kritische-dialoge-ueben/")
Wir haben in Täuschland eine lange Tradition von rechthaberischen Ansagen:
Der Adel, die Fürsten, die Kirchen und das Militär hatten immer Recht, sprachen die Richter, die zur gleichen Kaste gehören.
Die Mediziner haben sich dort hin vorgearbeitet, aber von der Aufklärung die wissenschaftliche Argumentation mit bekommen.
Heutige Medizin kann daraus lernen:
Gesundheitsläden und Selbsthilfe sind in ihren Unfähigkeits-Lücken der gesellschaftlichen Dialoge entstanden: Autoritäre Hierarchie und mangelndes Gespräch.
Nun haben sich die Kliniken im Kapitalismus verlaufen: Wie finden sie heraus?
Dialoge konstruktiver Kritik
sind erlernbar, sogar spielerisch, in Szenen kodiert und für Jederfrau zu dekodieren.
Die genauere Auflösung dazu kommt später, jetzt erst mal Teile der Geschichte:
von der Pädagogik der Unterdrückten von Paulo Freire
die aus Brasilien in den 1970er Jahren über kirchliche Kreise nach Deutschland kam
> Theater macht Politik, AG SPAK Verlag
und der Arbeit mit Augusto Boal und dem Theater der Unterdrückten
die über viele Jahre von 1981 an in München zu erleben war, zuletzt 1999 im Rathaus als „Legislatives Theater“
als angewandte gemeinschaftliche Forschung in Gruppen und in öffentlichen Aufführungen
zur Heilung von Erziehungs- und Autoritätsschäden
und zu den diversen, feministischen und queeren Bewegungen,
die heute dafür von reaktionären Kräften angegriffen werden, wie in der Sexualpädagogik.
Die Engführung als „marxistisch“ durch Öffnen für kritische Dialoge
> Wiesn 1980- 2020-ETöfftöff
wie mit Michail Bakunin und Rosa Luxemburg exemplarisch in die Geschichte einbringen …
Kritische Wissenschaft Heute (@KritWiss_Heute) twitterte um 10:55 AM on Sa., Dez. 05, 2020: Die Kritische Psychologie ist maßgeblich in Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse nach Freud und als Versuch ihrer Weiterentwicklung entstanden. Hier eine persönliche Sicht auf den Zugang zu beiden: <https://t.co/UANphCFWA9> (https://twitter.com/KritWiss_Heute/status/1335160736113364992?s=03)
https://fritz-letsch.blogspot.com/2020/12/heilung-von-autoritats-und.html
Originally posted at: [http://fairmuenchen.de/kritische-dialoge-ueben/](http://fairmuenchen.de/kritische-dialoge-ueben/ "Permalink")
original post
0 notes
Text
Engführung
*
VERBRACHT ins Gelände mit der untrüglichen Spur:
Gras, auseinandergeschrieben. Die Steine, weiß, mit den Schatten der Halme: Lies nicht mehr – schau! Schau nicht mehr – geh!
Geh, deine Stunde hat keine Schwestern, du bist – bist zuhause. Ein Rad, langsam, rollt aus sich selber, die Speichen klettern, klettern auf schwärzlichem Feld, die Nacht braucht keine Sterne, nirgends fragt es nach dir.
*
Nirgends fragt es nach dir –
Der Ort, wo sie lagen, er hat einen Namen – er hat keinen. Sie lagen nicht dort. Etwas lag zwischen ihnen. Sie sahn nicht hindurch.
Sahn nicht, nein, redeten von Worten. Keines erwachte, der Schlaf kam über sie.
*
Kam, kam. Nirgends fragt es –
Ich bins, ich, ich lag zwischen euch, ich war offen, war hörbar, ich tickte euch zu, euer Atem gehorchte, ich bin es noch immer, ihr schlaft ja.
*
Bin es noch immer –
Jahre. Jahre, Jahre, ein Finger tastet hinab und hinan, tastet umher: Nahtstellen, fühlbar, hier klafft es weit auseinander, hier wuchs es wieder zusammen - wer deckte es zu?
*
Deckte es zu – wer?
Kam, kam. Kam ein Wort, kam, kam durch die Nacht, wollt leuchten, wollt leuchten.
Asche. Asche, Asche. Nacht. Nacht-und-Nacht. – Zum Aug geh, zum feuchten.
*
Zum Aug geh, zum feuchten –
Orkane. Orkane, von je, Partikelgestöber, das andre, du weißts ja, wir lasens im Buche, war Meinung.
War, war Meinung. Wie faßten wir uns an – an mit diesen Händen?
Es stand auch geschrieben, daß. Wo? Wir taten ein Schweigen darüber, giftgestillt, groß, ein grünes Schweigen, ein Kelchblatt, es hing ein Gedanke an Pflanzliches dran –
grün, ja hing, ja unter hämischem Himmel.
An, ja, Pflanzliches.
Ja. Orkane, Par- tikelgestöber, es blieb Zeit, blieb, es beim Stein zu versuchen – er war gastlich, er fiel nicht ins Wort. Wie gut wir es hatten:
Körnig, körnig und faserig. Stengelig, dicht; traubig und strahlig; nierig, plattig und klumpig; locker, ver- ästelt –: er, es fiel nicht ins Wort, es sprach, sprach gerne zu trockenen Augen, eh es sie schloß.
Sprach, sprach. War, war.
Wir ließen nicht locker, standen inmitten, ein Porenbau, und es kam.
Kam auf uns zu, kam hindurch, flickte unsichtbar, flickte an der letzten Membran, und die Welt, ein Tausendkristall, schoß an, schoß an.
*
Schoß an, schoß an. Dann –
Nächte, entmischt. Kreise, grün oder blau, rote Quadrate: die Welt setzt ihr Innerstes ein im Spiel mit den neuen Stunden. – Kreise,
rot oder schwarz, helle Quadrate, kein Flugschatten, kein Meßtisch, keine Rauchseele steigt und spielt mit.
*
Steigt und spielt mit -
In der Eulenflucht, beim versteinerten Aussatz, bei unsern geflohenen Händen, in der jüngsten Verwerfung, überm Kugelfang an der verschütteten Mauer:
sichtbar, aufs neue: die Rillen, die
Chöre, damals, die Psalmen. Ho, ho- sianna.
Also stehen noch Tempel. Ein Stern hat wohl noch Licht. Nichts, nichts ist verloren.
Ho- sianna.
In der Eulenflucht, hier, die Gespräche, taggrau, der Grundwasserspuren.
*
(– – taggrau, der Grundwasserspuren –
Verbracht ins Gelände mit der untrüglichen Spur:
Gras. Gras, auseinandergeschrieben.)
Potete sentire qui la voce di Celan leggere questa meravigliosa terribile poesia, illeggibile senza singhiozzare.
0 notes
Text
Das Phänomen Karl Ove Knausgård
Ehrlichkeit und Wahrheit, das sind die Grundparameter des extremen Anspruchs des Autors Karl Ove Knausgård. Diesen Weg verfolgt er ohne Kompromisse und gibt dennoch am Ende des sechsten Bandes seiner Buchreihe „Min Kamp“ zu, dass er gescheitert sei. Am Ende des Projekts liegt sein Leben zerbrochen vor ihm. Die Ehefrau ließ sich scheiden, der Onkel bemüht sich um einen Rechtsstreit und wirft ihm vor, den Namen Knausgård zu diffamieren und von der Mutter von Kindheit an indoktriniert worden zu sein. Aber das hat den, auf den Covern seiner Bücher so grimmig drein schauenden, Norweger nicht von seiner Marschrute abgehalten.
Die Bücher tragen in der deutschen Ausgabe Verben im Infinitiv als Titel. Die norwegischen Ausgaben werden hingegen schlicht durchnummeriert. Beginnend mit der Verarbeitung des Todes seines Vaters in Sterben beschreitet Knausgård alle Stationen seines Lebens. Das Kennenlernen seiner zweiten Ehefrau inklusive ausführlich beschriebener Ängste vor einer Lebensuntüchtigkeit sind die Themen des zweiten Romans (Lieben), die Kindheit ist das Thema in Spielen, der Weg vom Schulabschluss zum ersten Job als Assistenzlehrer in der Einöde, und der in Schweden nach den Schilderungen in Kämpfen im Nachgang viel diskutierten Verliebtheit in eine seiner Schülerinnen, bildet den Rahmen des Romans Leben und in Träumen beschreibt der Autor seinen Weg zum Schriftstellerdasein (über Schreibakademie und Studium der Literaturwissenschaft) und nach Schweden. Am Ende steht der Roman Kämpfen. Thema hier ist der tägliche Lebenskampf, dessen Form aber durch das Verhalten Knausgårds teilweise bedingt ist. Er lässt bei der Beschreibung der Depression seiner Frau und ihrer beider Unfähigkeiten im Alltag keine beschönigenden Worte fallen. Aber die selbstreflexiven Passagen demonstrieren, dass ihm dies bewusst ist und es ihn täglich quält.
Eine etwas seltsame Passage und zugleich ein Beispiel für sein typisches Schreiben ist die Ausarbeitung der Gesellschaftsauffassung im Wandel zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert, ausgehend von Hitlers „Mein Kampf“. Der Titel der Reihe verpflichtet ihn (aus Sicht eines deutschen Lesers) sich zu diesem Thema zu äußern und er steigt in das Thema über eine Analyse des Gedichtes „Engführung“ von Paul Celan ein um den angesprochenen Wandel der Grundhaltung darzustellen. Und da zeigt sich der typische Knausgård -Stil. Aus einer im Handlungsblog plötzlich und unaufdringlich eingeschobenen, allgemein gehaltenen Passage in einem essay-haften Stil folgt eine beispielhafte Demonstration dieser These anhand von literarischen Beispielen. Für deutsche Leser wird hier eine Literaturszene demonstriert, deren Hierarchien und Namen ihnen weniger geläufig sind. Interessant ist dann auch die Auswahl der zum Vergleich herangezogenen Literatur und die darin demonstrierte weitreichende humanistische Bildung des Autors. Dieses Können ist heute nicht mehr unbedingt von Literaten zu erwarten. Knausgård fühlt sich hier einem Autorenbild verpflichtet, dass leider keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit mehr hat. Als Person wird er dabei aber nicht zwangsläufig sympathisch. Insbesondere der Tonfall des zu Beginn über alle Maßen selbstbewussten Jugendlichen in Leben stellt ihn in ein negatives Licht und zeigt ihn als sicherlich anstrengenden Menschen. Der Fall des Selbstbewusstseins ist aber vorprogrammiert, die aus dem Drama bekannte Fallhöhe der Eigenwahrnehmung auf jeden Fall ausreichend hoch.
Für den Leser bietet diese, in ihrem Entstehungsprozess eruptive, Schreibtechnik wechselnde Lesemomente. Wenn das Familienleben beschrieben wird und die großen Ängste Knausgårds im Alltag ausgebreitet werden kann man in diesen Textflächen verschwinden, innerhalb kürzester Zeit hunderte Seiten verschlingen. Die essayhaften Passagen hingegen verlangen volle Konzentration und können einen Eindruck von Länge hervorrufen. Insbesondere trifft dies auf die Passage der Jugend und der Anfänge Hitlers zu. Umrahmt von der sehr ausführlichen Analyse und Interpretation- nicht nur hier macht sich dann das literaturwissenschaftliche Studium des Autoren bemerkbar- des Gedichts von Paul Celan. Was genau das Ziel des Abschnittes über Hitler ist bleibt unklar.
Neben dieser Vielfalt an Lesemomenten innerhalb der einzelnen Romane bieten auch die Romane in der Folge unterschiedliche Eindrücke. Der eingeschränkte Wortschatz des Kindes weicht stark von den komplexen, vielgliedrigen Satzstrukturen der übrigen Romane ab, auch wieder ein Anklang alter Standards in der Literatur, an die großen Romanciers des 19.- und 20. Jahrhunderts. Die moderne Literatur setzt sich mit den neuen Phänomenen der Kürze auseinander und so lässt sich auch die gegensätzliche Kritik erklären. Auf der einen Seite die großen Befürworter und auf der anderen Seite diejenigen, denen jedes Interesse unmöglich zu sein scheint.
Aber zentral bleibt die Zielsetzung eine solche Ehrlichkeit nicht nur als ideellen Traum, sondern als grundlegendes Formkonzept einer ganzen Romanreihe umzusetzen. Ein ambitioniertes, und nach eigener Aussage gescheitertes Projekt mit Nachwirkung. Ob es das wert war? Verlust von Familie, ein in das kulturelle Gedächtnis eingehämmertes Bild all seiner Bekannten und Verwandten mit dem Drang zur negativen Darstellung, durch die Beibehaltung der Namen die direkte Zuordnung zu Personen. Der familieninterne Rechtsstreit wird wohl nur der Gipfel des Eisberges sein. Nicht anzuzweifeln ist die literarische Klasse des Autors. In diesem Fall nicht aufgrund der besonders spektakulären Handlung, sondern einfach aufgrund der Sprachqualität und dem demonstrierten Bildungsstandard nach einem scheinbar überholten Autorenbild. Wer aber dies anhand der Anzahl von Kaffeetassen und Zigaretten misst (wie etwa in der Neuauflage des literarischen Quartetts im letzten Jahr) trifft den Kern des Ganzen nicht.
Knausgård bleibt uns als Schriftsteller erhalten. Auch wenn er in Kämpfen im letzten Absatz davon spricht, sich nun darauf zu freuen nicht mehr Schriftsteller sein zu müssen sind nach seiner Autobiographie-Reihe, erschienen zwischen 2009 und 2011 in Norwegen und zwischen 2011 und 2017 in Deutschland, in der Folge zum Einen die Kurzgeschichtensammlung Das Amerika der Seele und zum Anderen die Sammlungen unter dem Motto der vier Jahreszeiten erschienen. Seine Ex-Frau Linda Boström Knausgård hat ebenfalls einen Roman veröffentlicht. Zu danken ist auch den beiden Übersetzern Paul Berf und Ulrich Sonnenberg, ohne deren Arbeit uns deutschen Lesern diese Lektüre nicht möglich gewesen wäre.
1 note
·
View note
Text
2019年度音楽文芸公開研究発表会のお知らせ
※中止となりました
今年も以下の要領で公開研究発表会を行います。
どなたでもご参加いただけますのでぜひご来聴ください。
東京藝術大学大学院音楽研究科 音楽文化学専攻 音楽文芸研究室 2019年度 公開研究発表会
2020年3月16日(月) 14:00~17:00
東京藝術大学音楽学部5号館401教室
本間 千尋 (博士4年) P.-A.-A. ド・ピイスのシャンソン創作と 「カヴォー・モデルヌ」への関与 髙島 登美枝 (博士2年) ロマンティック・バレエの再構築 ―マリウス・プティパによる《ジゼル》改訂をめぐって 内藤 瑠梨 (修士1年) パーシー・シェリーの短詩と付曲の比較検討 ―晩年の作品を中心に 山下 絢子 (研究生) 詩におけるストレッタ ―パウル・ツェランの詩「Engführung」の考察 服部 葉子 (研究生) 日本語の詩に曲を付けるということ ―山田耕筰の作曲観の考察
〒110-8714 東京都台東区上野公園12-8 (上野校地) お問い合わせ:東京藝術大学大学院音楽研究科 音楽文芸研究室 URL: https://ongakubungei.geidai.ac.jp/ask1 (問い合わせフォーム)

0 notes
Text
Nichts genaues weiß man nicht: Kinder von Alleinerziehenden in der Bremer Erziehungshilfe
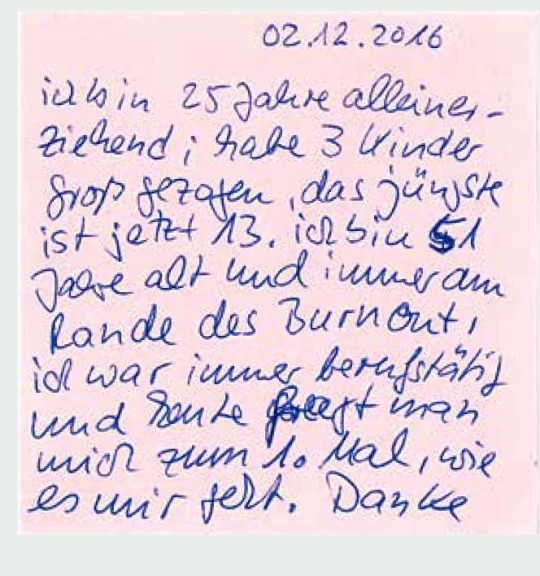
Offener Brief an die Verantwortlichen des Senatsprogramms „Alleinerziehende“ und an die Akteure der Bremer Jugendhilfe
Bremen, Anfang Februar 2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit diesem Offenen Brief wende ich mich an Sie, weil ich mir Sorgen darüber mache, dass ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen die Armut in Bremen, im Konzept des Senatsprogramms „Alleinerziehende“, nicht die nötige Aufmerksamkeit bekommt. Es geht darum, neben den von Ihnen richtigerweise aufgeführten Themenfeldern „Ausbildung“, „Arbeitsmarkt“, „bezahlbarer Wohnraum“, „Kita-Plätze“ den Fokus auch auf die „Hilfen zur Erziehung“ zu richten.
Ich gehe davon aus, dass Sie alle wissen, dass 40% der in den erzieherischen Hilfen betreuten Kinder und Jugendlichen aus den 14.000 Haushalten mit alleinerziehendem Elternteil kommen. Und sicherlich ist Ihnen bekannt, dass 80% der alleinerziehenden Mütter mit zwei und mehr Kindern von Transferleistungen des SGB II abhängig sind.
Hilfen für alleinerziehende junge Mütter und ihre Kinder – die in 2020 unter drei Jahre alt sind, die aber bis zur Volljährigkeit und in manchen Fällen auch darüber hinaus Hilfen zur Erziehung bekommen - müssen darauf abzielen, alle Familienmitglieder zu stärken. Die Mütter und die Geschwister müssen einbezogen und unterstützt werden. Längerfristige Herausnahmen, erst recht dauerhafte „Fremdplatzierungen“, sind kontra-indiziert.
Wenn Sie einen vertiefenden Blick auf die Hilfen nach §§ 27 ff SGB VIII werfen – wozu ich Sie als verantwortliche Politikerinnen (die männlichen Vertreter sind inkludiert) und als Akteure der Bremer Jugendhilfe ermuntere und auffordere – dann müssen Sie ins Grübeln kommen. Jedes vierte Kind, das stationär in einer Wohngruppe betreut wird, kommt aus einem Alleinerziehenden-Haushalt. Jedes zweite Kind in der Vollzeitpflege hat eine alleinerziehende Mutter. Und eines von zehn Kindern, das sich vorübergehend in einer Notaufnahme-Einrichtung (Inobhutnahme) befindet, kommt ebenfalls aus einer solchen Familienkonstellation. Das sind besorgniserregende Zahlen, die einer sorgfältigen Prüfung bedürfen. Mehr dazu in der Anlage zu diesem Brief.
Drei kritische Punkte möchte ich Ihnen vorab und in aller Kürze nennen:
1. Die Tatsache, dass die erzieherischen Hilfen im Zusammenhang mit dem Senatsprogramm „Alleinerziehende“ überhaupt nicht auftauchen, ist ein Armutszeugnis der Politik. Um es Ihnen einmal über das Kostenvolumen näherzubringen: Es geht bei den 2.500 Kindern und Jugendlichen von Alleinerziehenden, die Hilfen zur Erziehung erhalten, um geschätzte 67 Millionen Euro pro Jahr. Mir geht es aber nicht um das Geld, sondern darum, dass den 2.500 Minderjährigen und ihren Familien Hilfe zuteil wird. Mir geht es darum, dass die eingesetzten Mittel eine Wirksamkeit entfalten. Lassen Sie sich nicht einreden, dass man in der Erziehungshilfe die Wirksamkeit der Maßnahmen nicht messen kann. Man kann. Und zwar allein dadurch, dass in jedem Einzelfall, bei jeder Familie, dokumentiert wird, wann Transferleistungen nach SGB II teilweise oder ganz wegfallen, ob und wann die jungen Mütter einen Ausbildungsabschluss schaffen, ob sie eine Berufstätigkeit beginnen, von der die Familie wenigstens überwiegend leben kann. Wenn die Erziehungshilfe gleichzeitig die Kinder in ihren Potenzialen stärkt (Schule, Ich-Stärke, soziale und emotionale Kompetenzen), dann ist dies auch in Form detaillierter Berichterstattung nachweisbar.
2. Das Jugendamt ist im Rahmen seines derzeit laufenden internen Qualitätsentwicklungsprogramms Jugendamt weiterentwickeln („JuWe“) zu sehr mit sich selbst beschäftigt, im Wesentlichen mit der systematischen Erfassung aller Arbeitsabläufe (Kernprozesse). Außerdem steht es unter hohem Legitimationsdruck, was die Entwicklung der Ausgaben betrifft. Bei dem Bemühen, mittels Kennzahlen die Relationen von Fallaufkommen und Ausgaben pro Fall zu ermitteln und beim durchaus erfolgreichen Versuch, die Kosten pro Fall zu drosseln, wird der alles entscheidende Faktor ausgeblendet: die Wirksamkeit der HzE, im Einzelfall wie in der Gesamtheit.
Kernprobleme – wie die Lage der Kinder von Alleinerziehenden in den HzE-Maßnahmen – werden konzeptionell überhaupt nicht (oder für interessierte Außenstehende nicht erkennbar) thematisiert. Ich habe keine systematische und kontinuierliche Datenanalyse entdecken können. Fallverläufe werden offensichtlich nicht regelmäßig überprüft. Konzepte für überschaubare und eigentlich relativ leicht zu definierende Zielgruppen wie z.B. alleinerziehende
junge Mütter, die mit Kindern im Alter von unter drei Jahren ins System der Hilfen zur Erziehung gelangen, die dann für viele Jahre im System bleiben, liegen nicht vor.
3. Das statistische Material ist fehlerhaft. Was die Berichterstattung für das Jahr 2017 angeht, stimmen die Daten, die an das Statistische Landesamt übermittelt wurden, nicht mit denen des internen Controllings überein. Das gilt für die Anzahl der HzE-Fälle wie für die Ausgaben. Verschärft werden die Diskrepanzen durch eine völlig unterschiedliche Systematik der Hilfearten. Hierzu mehr in der Anlage.
Welche Konsequenzen dies für Politik und Jugendhilfeplanung hat, wenn das Zahlenwerk nicht stimmt, wissen Sie besser als ich.
Ich möchte betonen, dass ich mit meinen kritischen Anmerkungen keine Bewertung über die Qualität der Arbeit der Casemanagerinnen und Betreuerinnen vornehme. Im Gegenteil. Die Fachkräfte im Sozialdienst Junge Menschen, die Sozialpädagoginnen und Erzieherinnen in der aufsuchenden Familienhilfe, in den Mutter-Kind-Einrichtungen, in den Wohngruppen, sie sind mit Engagement bei der Sache, sie machen einen guten Job. Was fehlt, ist der rote Faden, ein Gesamtkonzept für die Gruppe der alleinerziehenden Mütter und deren Kinder. Meine Intervention zielt darauf ab, dass wir aus dem Stadium des „Nichts-Genaues-weiß-man-nicht“ heraus gelangen, Kriterien für eine kontinuierliche Bewertung der 2.500 Hilfen zur Erziehung entwickeln.
Meine Damen und Herren, überdenken Sie noch einmal Ihre bisherigen Pläne. Auch und vor allem was die Frage betrifft, wer die Koordinierung der verschiedenen Hilfen, die Federführung bzw. die Verantwortung für den gesamten Prozess übernehmen soll. Ich plädiere für ein Casemanagement, so wie es im Sozialdienst Junge Menschen praktiziert wird. Bei der Zielgruppe, die das ressortübergreifende Projekt „Alleinerziehende“ richtigerweise ins Auge gefasst hat, geht es um junge Mütter und um deren kleine Kinder. Und diese Kinder müssen bis zum Ende der HzE, ja auch darüber hinaus bis zur Volljährigkeit, und manchmal auch noch darüber hinaus bis ins junge Erwachsenenalter im Zentrum der Aufmerksamkeit bleiben. Ein so geartetes Casemanagement kann je nach Situation im Stand-by-Modus erfolgen, also mit halbjährlichen Gesprächen, an denen alle Familienmitglieder – und bei Bedarf auch andere Fachkräfte – beteiligt sind. In Fällen, wo eine Destabilisierung des Familiensystems droht, ist eine angemessene professionelle Unterstützung nötig.
Eine Engführung auf die arbeitslose, unzureichend qualifizierte junge Mutter sollte vermieden werden. Das Projekt steht und fällt damit, ob die ergänzenden Hilfen für die Kinder eine Wirksamkeit entfalten oder nicht. Und das kann deshalb frühestens in 15 Jahren festgestellt werden.
Erlauben Sie mir eine letzte Bemerkung: Ich habe zum ersten Mal seit langen Jahren, eigentlich seit meinem Einstieg in die Bremer Jugendhilfe (1976), den Eindruck, dass sich ernsthaft und konkret etwas bewegt in Sachen Armutsbekämpfung. Ernsthaft, weil Sie sich um eine wirkliche ressortübergreifende Kooperation im Einzelfall bemühen. Konkret, weil Sie sich auf eine der ganz wichtigen Gruppen der von anhaltendender Armut bedrohten Menschen in Bremen konzentrieren. Um so wichtiger ist, dass die Erziehungshilfe ihren Part übernimmt.
Mit besten Grüßen
(Detlev Busche)
Anlage: Gibt es auf Nachfrage
#Alleinerziehende#junge alleinerziehende Mütter#Senatsprogramm Alleinerziehende#Bremer Erziehungshilfe
0 notes
Quote
How did we touch each other - each other with these hands?
Paul Celan, “The Straitening” (‘Engführung’, Selected poems, translated by Michael Hamburger)
#paul celan#poetry#famous poets#quote about love#skin#hands#these violent delights#king midas#quote#m
1K notes
·
View notes
Text
Finanziers in Sehnsuchtsräumen: Europäische Banken und Griechenland im 19. Jahrhundert
Frau Dr. Korinna Schönhärl ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Sozial-, Kultur- und Wirtschaftsgeschichte der Universität Duisburg-Essen. Am 2. Oktober 2017 erschien in der Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften ihr neues finanzgeschichtliches Fachbuch „Finanziers in Sehnsuchtsräumen: Europäische Banken und Griechenland im 19. Jahrhundert“:
Wie treffen Bankiers ihre Entscheidungen? Wie identifizieren und managen sie Risiken? Wie funktioniert der Aufbau von Vertrauen im Bankgewerbe? Die Studie untersucht diese Fragen am Fallbeispiel Griechenlands und zeichnet die Integration dieses peripheren Finanzmarktes in den europäischen Ländern zwischen 1820 und 1914 nach.
Ausgehend von methodischen Anregungen der „Behavioral Finance“ analysiert sie in neun Fallbeispielen (u.a. Auslandsanleihen, die Gründung der Nationalbank, die Trockenlegung von Sumpfgebieten, der Kanal von Korinth, die internationale Finanzkommission, der Handel) die Risikoperzeption und das Investitionsverhalten britischer, französischer, deutscher und schweizerischer Bankiers.

Griechenland im Zeitalter des Philhellenismus erscheint dabei als „Sehnsuchtsraum“, wo jeder Investor vor dem Hintergrund bestimmter, polarisierender Stereotype seine Entscheidungen zu fällen hatte, die oft auf die Antike rekurrierten und stark emotional aufgeladen waren.
Durch die Engführung von Kultur-, politischer und Finanzgeschichte rückt die Vielschichtigkeit der Risikoperzeption in den Blick, bei der Netzwerke oder der Einfluss der Politik ebenso Entscheidungen bedingen konnten wie der unbedingte Glaube an wissenschaftliche Expertise oder nationale Selbstüberschätzung. Die Studie gibt Auskunft darüber, wie sich die Risikoeinschätzung und das Risikomanagement von Bankiers im Laufe des 19. Jahrhunderts veränderten.
Finanziers in Sehnsuchtsräumen: Europäische Banken und Griechenland im 19. Jahrhundert, 1. Auflage 2017, 505 Seiten mit 4 farbigen Abbildungen, 18 schwarz/weiß-Abbildungen, gebunden, ISBN 978-3-525-36090-3, 80,- Euro, Verlag Vandenhoeck & Ruprecht
-
Hans-Georg Glasemann
Ich bin für Sammler Historischer Wertpapiere aktiv im EDHAC. Unterstützen Sie uns, werden Sie Mitglied …
Wenn Sie diesen Blog abonnieren wollen, klicken Sie oben rechts „RSS-Feed“. Ältere Beiträge des Blogs finden Sie, wenn Sie „Archiv“ klicken!
Bild: Vandenhoeck & Ruprecht (F11/21-10/2017)
1 note
·
View note
Text
Kabarettist Uwe Steimle in seiner Paraderolle Erich H. und der Virus aus den Friedenslaboren der KP Chinas
PI: Von JOHANN FELIX BALDIG | Angela Merkel ist Honeckers letzte Rache. Längst ist dies Binsenweisheit, rhetorische Grundausstattung all jener, die das schlechte Bestehende beklagen. Bei aller Engführung der Gedankenfreiheit, die den alternativlosen Wahnsinn der letzten Jahre absichern sollte, blieb die kapitalistische Warenwelt freilich eine heile. Die Läden waren weiter voll. Mehr noch: zügellose Zuwanderung wurde […] http://dlvr.it/RY5X46
0 notes
Text
Glaube und Vernunft
Glaube und Verstand hängen zusammen. Glaube bedarf des Verstandes. Aber dennoch hat Glaube etwas, das über den so genannten logischen Verstand hinausgeht. Beide gehören zur Vernunft. Denn Vernunft ist mehr als Verstand. Vernunft bezieht Lebenserfahrungen, Weltbilder, Interpretationen des Erfahrenen mit ein. Der Verstand sucht nur das Nachvollziehbare nachzuvollziehen. Gegenüber dem Verstand hat der Glaube also hinausgehende, weiterführende Bedeutung. Er fragt nach dem Woher des Menschen, dem Wohin, dem Sinn des Lebens. Anders gesagt: Warum lebe ich als Mensch? Wie sieht meine Zukunft aus? Wie will ich mein Leben gestalten? Was ist die Grundlage meines Lebens – wer hat sie gesetzt? Ich bin mehr als ein Zufallsprodukt der Natur – das sieht man daran, dass ich strebe, auf Zukunft hin ausgerichtet bin, von der Vergangenheit lernen kann, eingebunden bin in ein frei zu gestaltendes soziales Netzwerk, verletzlich bin, leiden und froh sein kann. Alles ist auf Zufall, auf chemische Reaktionen usw. zu reduzieren? Es gibt wohl keinen Menschen der mit dieser materialistisch-biologistischen Antwort zufrieden ist. Warum? Eine Reduzierung des Weltbildes auf den Verstand ist eine selbstgewählte Engführung, die nicht nur dem Menschen als offenes Wesen widerspricht, sondern auch der Grundlage der Wissenschaft.
Glaube im Verein mit Vernunft bedeutet, dass man zur gesamten Wirklichkeit Zugang hat und nicht nur zu einem Teilaspekt. Warum? Weil der Glaube den Menschen an den zurückbindet, von dem alles ausgegangen ist, der der Ursprung der gesamten Wirklichkeit ist – und der ist: Gott. Es geht dabei jedoch nicht nur um Theorie, sondern auch, dass das eigene Leben an Gott gebunden ist, von ihm her seine Zielsetzung erfährt.
0 notes
Text
Interview: Wie der Heilige Geist handelt
Der Heilige Geist – eine fast unbekannte Größe, so zumindest scheint es im Glaubensvollzug vieler Katholiken in unseren Breitengraden. Wir bekennen ihn (im Glaubensbekenntnis), aber wir wissen kaum etwas über ihn. Auch in der Theologie durchläuft der Heilige Geist bestimmte Aufmerksamkeitszyklen, derzeit gilt der „dritten Kraft“ der Dreifaltigkeit wieder mehr Interesse.
Wie wirkt der Heilige Geist, und was meinen wir eigentlich, wenn wir sagen, dass er gegenwärtig ist? Der in Wuppertal lehrende katholische Theologe Michael Böhnke hat in seinem jüngst erschienenen Buch „Gottes Geist im Handeln der Menschen: Praktische Pneumatologie“ eine Analyse vorgelegt. Seine zentrale These: Der Heilige Geist ist für die, die ihn herbeirufen, „die verheißene Gewissheit der göttlichen Gegenwart“. Gudrun Sailer sprach mit Michael Böhnke.
Radio Vatikan: Der Heilige Geist ist von der Schrift an im Glauben der Kirche angelegt, man kann ihn also weder wegdiskutieren noch schief ansehen: er ist ein Unruhestifter, aber er gehört zum Glaubensgut, das alle Christen bekennen. Zugleich ist der Begriff Heiliger Geist offen für eine gewisse Bandbreite an Deutungen. Welche Musik liegt darin für die heutige Theologie?
Michael Böhnke: „Ein wenig problematisch finde ich es, dass durch bestimmte Theoriedefizite der Heilige Geist heute weitgehend in den Bereich des Subjektiven und der Spiritualität und der Innerlichkeit abgewandert ist. Ich mache mich dafür stark, den Heiligen Geist im Handeln der Menschen zu entdecken. So wie wir es aus Formulierungen kennen, dass Gespräche im Geist der Freundschaft stattgefunden haben oder dass Spiele im Geist der Fairness stattgefunden haben. So etwas meint Paulus, wenn er im Galaterbrief vom Wandeln im Geist spricht, dass man sich friedliebend, sanftmütig, freundschaftlich und so weiter begegnet: dann wird dieser Geist Gottes konkret benennbar, etwa an einer Geste wie einem Händedruck, einer zärtlichen Geste, dass man den Geist Gottes dann weiterträgt, wenn man sich in seinem Handeln so (von ihm) ausrichten lässt.“
Radio Vatikan: Woran liegt es denn, dass der Heilige Geist in die Innerlichkeit abgeschoben wurde und nicht mehr als handlungsleitend wahrgenommen wird?
Michael Böhnke: Ich glaube, dass dieses Abschieben des Heiligen Geistes in die Innerlichkeit bedingt ist durch eine Engführung auch im Handlungsbegriff der Moderne. Das kommt nämlich dazu, dass Handlung versucht wird allein durch Kausalität zu erklären, während für die Handlungssituation doch noch ganz anderes bestimmend ist, eben die Frage, wie ich ausgerichtet bin in einer Handlung. Der Züricher Sozialethiker Johannes Fischer hat in diese Richtung bahnbrechend gearbeitet, und er orientiert sich immer am Gleichnis vom barmherzigen Samariter: was bewegt mich dazu, in dieser Situation, den Fremden als Nächsten anzusehen. Das ist ja nicht unbedingt durch Vernunftmotive zu begründen, sondern durch eine bestimmte szenische Gerichtetheit der Handlung, wie er es nennt.“
Radio Vatikan: Auffallend stark ist der Platz des Heiligen Geistes bei den Liturgien und Zeremonien einer Papstwahl. Das ist – wie sonst nur Pfingsten - ein Moment des kirchlichen Lebens, in dem die Gläubigen dem Heiligen Geist einen sichtbareren und hörbareren Platz einräumen als den beiden anderen Komponenten der Dreifaltigkeit, Gott Vater und Gott Sohn. Warum gerade beim Konklave?
Michael Böhnke: „Nicht nur beim Konklave: In der Konzilsliturgie spielt die Herabrufung oder das Herbeirufen des Heiligen Geists eine ebenso entscheidende Rolle. Gerade die Festlichkeit, in der das geschieht, legitimiert dieses Handeln als kirchliches Handeln.“
Radio Vatikan: Und beim Konklave?
Michael Böhnke: „Auch für das Konklave gilt: Wer den Geist anruft, kann sich der Treue Gottes gewiss sein. Und es sind nicht nur die Kardinäle, die den Geist anrufen, sondern die ganze Kirche ist dazu aufgerufen, gemäß der Ordnung von Papst Johannes Paul II, Universi Dominici Gregis, den Geist im Konklave anzurufen. Ein Konklave ist also nicht einfach nur ein säkularer Wahlakt, weil die Kirche nicht nur eine weltliche Größe ist. Der Geist wirkt nicht, indem er das Handeln der Kardinäle ersetzt, wählen müssen diese schon selber, aber er richtet das Handeln der Kardinäle auf diesen bevorstehenden Wahlakt aus, also ich würde sagen, er ist zumindest atmosphärisch präsent.“
Radio Vatikan: Und was bewirkt er in dieser atmosphärischen Präsenz?
Michael Böhnke: „Es macht einen Unterschied, ob ich freundschaftlich oder misstrauisch auf jemanden zugehe. In einer Atmosphäre, in der Neid und Missgunst herrschen, ist es schwerer, ruhig und friedlich zu bleiben. Die Prozession und das Gebet stimmen auf die Papstwahl ein, wenn Sie so wollen, zeigt sich in dieser atmosphärischen Präsenz, dass der Geist ein Geist der Einheit ist, und ein Geist, dem es um das Wohl der Kirche geht.“
Radio Vatikan: Papst Franziskus betont am Heiligen Geist, über den er oft spricht, den dynamisierenden Effekt auf die Kirche und den einzelnen Gläubigen. Für Franziskus ist der Heilige Geist ein Quälgeist: einer, der uns aus der Behaglichkeit der alten Antworten aufschreckt, uns auf unbequeme Wege führt, hinein ins Unfertige. Was kann das bewirken?
Michael Böhnke: „Ich glaube für Franzskus steht noch nicht fest, wie die Zukunft der Kirche aussieht. Die Zukunft der Kirche ist aus seiner Sicht für das formende Wirken des Heiligen Geistes offen. Er hat nicht nur in seinem Schreiben „Evangelii Gaudium“, sondern auch andernorts immer wieder die Bedeutung der Parrhesia betont, der freien Rede, der prophetischen Dimension des Geistwirkens, auch das ist eine Ausrichtung des Handelns, dass man etwas mit Freimut gegen alle Ängstlichkeit vorträgt. Das funktioniert aber nur, wenn nicht immer schon festgelegt ist, wie die Kirche der Zukunft aussieht. Deshalb die synodalen Prozesse, deshalb das Befragen der Jugendlichen vor der Jugendsynode. Es geht darum, dass die Kirche sich aus dem Geist der Barmherzigkeit erneuert und ihren Weg findet. Und nicht der Geist – um die Gegenposition zu benennen, in das fertige Gefüge der Kirche mit ihren Lehren, Normen, Gesetzen eingefügt wird und dort den Platz einnehmen soll, dass alles, was institutionell schon festliegt, von den Gläubigen auch akzeptiert wird.“
(rv 27.10.2017 gs)
from Radio Vatikan http://ift.tt/2yZBxEk
0 notes