#Gleichnis
Explore tagged Tumblr posts
Text

Freche Witze & liebe Sprüche / Facebook
#spruch#sprüche#sinnspruch#sinnsprüche#parabel#gleichnis#sich selbst verlieren#es anderen recht machen#freche witze & liebe sprüche#sprüche zum nachdenken
2 notes
·
View notes
Text
Gleichnis vom verlorenen Sohn

Gleichnis vom verlorenen Sohn · Interpretation und Lehre
Ein Vater hatte zwei Söhne, denen er sein ganzes Geld vererben wollte, sobald er stirbt. Doch der jüngere Sohn wollte nicht warten: Er bat seinen Vater schon vorher um seinen Anteil. Der Vater gab ihm das Geld und der jüngere Sohn verließ sein Zuhause. Er reiste in ferne Länder und gab sein Geld für all seine sündhaften Begierden aus. So lebte er ein derart ausschweifendes Leben, bis sein ganzes Geld verschwendet war. Als schließlich eine schwere Hungersnot ausbrach, hatte der jüngere Sohn überhaupt kein Geld mehr für Essen und musste hungern. Dann bat er einen Mann um Hilfe, der ihn als Schweinehirten einstellte. Da Schweine ja als unreine Tiere gelten, war diese Arbeit eine besonders schlimme Erniedrigung für den Sohn. Doch sein Hunger plagte ihn so sehr, dass er dann sogar bereit war, das Schweinefutter zu essen. Dabei musste er auch immer daran denken, dass die Bediensteten im Hause seines Vaters viel Besseres zu essen bekamen. Deshalb beschloss er, nach Hause zurückzukehren. Ihm war bewusst, dass er gesündigt hatte und er hoffte deshalb nur auf eine niedrige Stelle als Bediensteter im Hause seines Vaters. Er erwartete, dass seinen Vater über ihn sehr enttäuscht und zornig sein würde. Doch es kam alles ganz anders. Als der barmherzige Vater seinen Sohn erblickte, war er nicht wütend. Im Gegenteil, er freute sich über die Rückkehr seines verlorenen Sohnes, umarmte und küsste ihn. Der jüngere Sohn erzählte seinem Vater von seinen Sünden und dass er es nicht verdiente, Sohn seines Vaters genannt zu werden. Doch der Vater widersprach ihm und befahl seinen Knechten, die besten Gewänder für seinen Sohn zu holen und ein Festmahl vorzubereiten. »Wir wollen Mahlzeit halten und feiern, und alle sollen sich freuen. Denn mein Kind hier war tot und ist wieder lebendig geworden; es war verloren und ist wiedergefunden«, sagte der Vater. Der ältere Sohn, der auf dem Feld bei der Arbeit war, hörte von Ferne die Musik der Feier. Ein Knecht erzählte ihm von der Rückkehr seines Bruders und davon, dass sein Vater zum Feiern aufgerufen hätte. Der ältere Sohn war darüber sehr verärgert und beschwerte sich bei seinem Vater. Er war all die Jahre bei ihm geblieben, während sein jüngerer Bruder all sein Geld verschwendet und gesündigt hatte. Der Vater beruhigte aber seinen älteren Sohn und versicherte ihm, dass alles, was er besaß, nach seinem Tod ihm gehören würde. Doch er sagte ihm auch, dass es Grund zum Feiern gäbe. Auch wenn der jüngere Sohn gesündigt hatte, war er doch wieder nach Hause zurückgekehrt. Interpretation: Der Vater: Er steht für Güte und Barmherzigkeit Gottes gegenüber allen. Gott liebt alle Menschen: Nicht nur die, die ihm gehorchen. Sondern auch die, die gesündigt haben und ihre Sünden bereuen. Sie sollen zu ihm zurückkehren, wie der jüngere Sohn zu seinem barmherzigen Vater zurückgekehrt ist. Der jüngere Sohn: Er ist der Sündige, der seine Fehler einsieht und bereut. Er kehrt mit Reue zu seinem Vater zurück und wird deshalb trotz seiner Fehler liebevoll empfangen. Der ältere Sohn: Er spiegelt all die Menschen wider, die eifersüchtig sind und anderen nicht verzeihen können. Sie arbeiten hart und halten sich an die allgemein gültigen Regeln. Deshalb fällt es ihnen auch besonders schwer, anderen Menschen zu verzeihen, die diese Regeln gebrochen haben. Lehre: Für alle Menschen soll dieses Gleichnis ein Aufruf dazu sein, immer ihre Denkweise auch infrage zu stellen. Gleichnis vom verlorenen Sohn · Interpretation und Lehre Read the full article
0 notes
Text
Auf einer Interpretationsebene würde ich halt sagen, dass die Räuber ein “moderner” twist von Gleichnis des verloren Sohns (Lukasevangelium (15,11–32) ist. Da is so oder so schon eine sozial geschichtliche Historie hat. Wahrscheinlich, wurde dass auch schon 1000 x mal durchdiskutiert aber mir ist das erst jetzt aufgefallen.
11 notes
·
View notes
Text

had our first rehearsal with the orchestra tonight and this movement had me in shambles. the ewig! ewig! had me nearly in tears i love music i love mahler i love singing
2 notes
·
View notes
Text
Sich hineinversetzen. Von Empathie, Spiegelneuronen und der Goldenen Regel
Wer erinnert sich nicht? An das legendäre ZDF-Interview von Boris Büchler mit Per Mertesacker nach dem WM-Achtelfinale Deutschland gegen Algerien (2:1 n.V.) am 30. Juni 2014, also vor zehn Jahren. Der Reporter Büchler nimmt den sichtlich erschöpften Spieler Mertesacker hart ran, sucht trotz des Sieges nach Kritikpunkten. Mertesacker reagiert gereizt, Büchler lässt nicht locker.
Das Ganze schaukelt sich hoch, die Kontrahenten überbieten sich in Sachen Sticheleien und Pampigkeit, lassen Fingerspitzengefühl und Professionalität vermissen. Gerade deswegen ist dieser Schlagabtausch so legendär: Boris Büchler und Per Mertesacker sind offen und ehrlich. Ein Interview ohne Filter.
Danach versuchen Moderator Oliver Welke und Experte Oliver Kahn die Wogen zu glätten, ergreifen jedoch für die jeweils eigene Seite Partei. Kahn verteidigt Mertesacker mit den Worten „Man muss sich aber auch mal ein bisschen in den Spieler reindenken“.
Welke kontert: „Man muss sich auch mal in den Reporter reindenken“. Unentschieden. Und doch gibt es einen Sieger dieses Schlagabtauschs: die Empathie, das Einfühlungsvermögen, die Fähigkeit, sich in Andere hineinzuversetzen. Doch was ist das eigentlich: Mitgefühl?
Die Biologie des Einfühlungsvermögens
Zunächst ist es die Fähigkeit, den Anderen mit seinen Bedürfnissen wahrzunehmen. Hierzu erkannte die Hirnforschung, dass es eine neuronale Anlage von Einfühlungsvermögen gibt. Die Entdeckung der Spiegelneuronen durch den Italiener Giacomo Rizzolatti und sein Team,* die insbesondere Joachim Bauer im deutschen Sprachraum popularisiert hat, geben Aufschluss über die neurobiologischen Korrelate eines grundlegenden moralischen Phänomens.
Kernkonzepte sind dabei die „Ähnlichkeit“ und die „Absicht“: Wir reagieren auf das, was uns bekannt vorkommt und von dem wir ahnen, wie es sich entwickeln wird, qua natura empathisch, das heißt, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, feuern die Spiegelneuronen automatisch. Damit wird, so könnte man etwas lax sagen, unkontrolliert Empathie freigesetzt. Die Bildung von Spiegelneuronen erfolgt, auch das ist ein Befund der Empathieforschung, in den ersten drei Lebensjahren im Rahmen der Mutter-Kind-Beziehung, die damit grundlegend für die Ausbildung moralischen Verhaltens ist.
Das heißt: Gibt es in dieser Beziehung Probleme, so gibt es später Probleme mit der Empathie, denn es fehlt schlicht die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. Dass diese Erkenntnis von Rizzolatti nicht viel breiter rezipiert wird, mag auch daran liegen, dass die besondere Bedeutung der Mutterrolle aktuellen Familienkonzepten querliegt.
Der Wille zur Perspektivenübernahme
Die Frage, die sich weiterhin stellt, wenn man denn von der Bedeutung der Spiegelneuronen für unser Verhalten überzeugt ist, lautet wie folgt: Wie kann dieser Vorgang des Sich-Hineinversetzens „gesteuert“ werden, um unsere Einfühlung sinnvoll zu kanalisieren?
Eine Antwort könnte, vor allem in komplexen Situationen, die über eine spontane Mitleid-Hilfe-Reaktion hinausgehen, in der Bereitschaft liegen, den Anderen mit seinen Bedürfnissen wahrzunehmen, sich auf ihn tiefer einzulassen.
Das Stichwort, das uns hier weiterbringt, ist die Perspektivenübernahme, ein Begriff aus der Psychologie, der allerdings auch für die Agape-Ethik Jesu maßgebend ist. Wir sollen aus dem Blickwinkel des Nächsten schauen, seine Perspektive einnehmen und so erkennen, welcher Unterstützung er bedarf. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk 10,30-37), unmittelbar im Anschluss an das Liebesgebot überliefert, erläutert diesen Umstand und zeigt uns damit das Wesen der Liebe: Handeln aus Mitgefühl, das am Notleidenden Maß nimmt, empathisches Handeln.
Agape – der Andere sagt „Stopp!“
Jesus berichtet in dem Gleichnis von einem Überfall und der Hilfeleistung durch einen Nicht-Juden. Er erzählt die Gegebenheit zunächst aus Sicht des Opfers und sprengt damit die „legalistische Enge der Gesetzeskasuistik“ (Schockenhoff), auf die der Gesetzeslehrer mit der Frage „Wer ist mein Nächster?“ (Lk 10,29) abzielt.
Der Gesetzeslehrer möchte eine Antwort, die als Definition, also Abgrenzung, dienen kann und so die Handlungssphäre des Einzelnen prinzipiell limitiert. Jesus macht durch den Perspektivenwechsel aber deutlich, dass sich die Agape – die als Handlungsdisposition grundsätzlich grenzenlos ist – im konkreten Fall nur an dem zu Liebenden bemessen lässt.
Erst wenn man dessen Sicht eingenommen hat und aus dessen Sicht keinen Handlungsbedarf mehr erkennen kann, ist die Liebe an ein Ende gelangt. Sie bemisst sich also immer am Bedürfnis dessen, der Liebe braucht, nicht an dem, der sie gibt.
So sagt der barmherzige Samariter zum Wirt der Herberge, in die er das Opfer gebracht hat: „Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme.“ (Lk 10,35).
Das ist der Clou der Agape-Ethik Jesu, der als „supererogatorischer Ansatz“ bekannt wurde: Es gibt kein: „Genug!“ aus meiner Sicht, sondern nur aus der des Anderen. So betrachtet gibt es schließlich keine Situation mehr, die und keinen Menschen mehr, der von unserem Mitgefühl prinzipiell ausgenommen ist. Und die Bereitschaft zu dieser Haltung des Einfühlens, die in der tätigen Liebe mündet, erwächst mit der Perspektivenübernahme.
Die Goldene Regel als empathische Norm
Die Goldene Regel muss in dieser Weise gelesen werden. Nicht: „Behandele den Anderen so, wie er Dich behandelt hat“ oder „Behandele den Anderen so, wie Du gerne vom Anderen behandelt werden möchtest“, sondern „Versetze Dich in den Anderen hinein und behandele ihn dann so, wie Du an seiner Stelle, mit seinen Eigenschaften und mit seinen Bedürfnissen wünschtest behandelt zu werden.“
Um dem Anderen gerecht zu werden, muss man zunächst einmal von sich absehen und den Anderen in seiner Andersartigkeit in den Blick nehmen. Man muss sich als Reporter also mal in einen Spieler hineinversetzen, nach so einem Spiel. Und man muss sich mal in den Reporter hineinversetzen, als Spieler.
Anmerkung:
* Giacomo Rizzolatti: / Corrado Sinigaglia: So Quel che fai. Il cervello che agisce e i neuroni specchi. Milano 2006 (deutsch: Empathie und Spiegelneurone. Die biologische Basis des Mitgefühls. Frankfurt a.M. 2008).
2 notes
·
View notes
Text
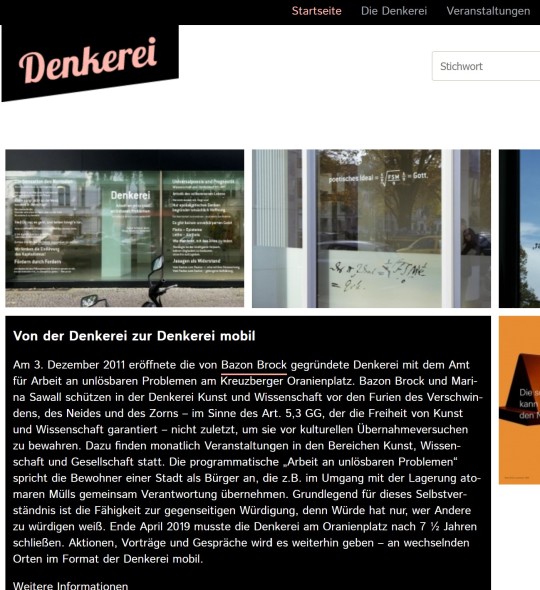
Amt für die Arbeit an unlösbaren Problemen
1.
Diese Skizze [...] zeigt, wie wenig der juridische Optimismus angebracht ist, man werde mit rechtsdogmatischen
Mitteln das Menschenrechtsproblem schon lösen können. Bereits die institutionellen Grundrechte konfrontieren das Recht mit den Grenzen zu anderen gesellschaftlichen Teilsystemen. Kann ein Diskurs dem anderen gerecht werden? Ein Problem, dessen
Dilemmata Lyotard analysiert hat.
Aber immerhin ein innergesellschaftliches Problem, auf das Luhmann mit dem Konzept von Gerechtigkeit als gesellschaftsadäquater Komplexität zu reagieren versucht hat. Dramatischer noch ist die Situation von Menschenrechten, die an der Grenze zwischen Kommunikation
und Leib-Seele angesiedelt sind.
Alle tastenden Versuche einer Juridifizierung von Menschenrechten können nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich um ein im strengen Sinne unmögliches Projekt handelt. Wie kann jemals die Gesellschaft den Menschen „gerecht“ werden, wenn die Menschen nicht ihre Teile sind, sondern außerhalb der Kommunikation stehen, wenn die Gesellschaft nicht mit ihnen kommunizieren kann, allenfalls über sie, ja sie nicht einmal erreichen, sondern bloß entweder irritieren oder zerstören kann? Angesichts unmenschlicher gesellschaftlicher Praktiken ist die Gerechtigkeit der Menschenrechte ein brennendes Problem - aber ein Problem ohne jede Aussicht auf Lösung.
Das sollte in aller Härte ausgesprochen werden. Wenn die positive Herstellung von Gerechtigkeit im Verhältnis von Kommunikation zum Menschen definitiv unmöglich, dann bleibt, wenn man sich nicht auf einem poststrukturalistischen Quietismus einlassen will, nur ein second best. Man wird sich in der Rechtskommunikation damit zufrieden geben müssen, dass das System/Umwelt-Problem nur über die unzulänglichen Sensoren von Irritation, Rekonstruktion und re-entry erfahrbar ist. Die Tiefendimension von kommunikativ-menschlichen Konflikten kann vom Recht allenfalls erahnt werden. Und als Richtungsangabe bleibt nur das juridische Verbot, mit dessen Hilfe eine Selbstbegrenzung der Kommunikation möglich erscheint. Aber auch dieses Verbot kann die Transzendenz des anderen nur als Gleichnis beschreiben. Dies ist ein letztlich zum Scheitern verurteiltes Gerechtigkeitsprogramm, das sich gerade nicht mit Derrida damit trösten kann, dass es „im Kommen“ ist, sondern wissen muss, dass es prinzipiell unmöglich ist. Die Gerechtigkeit der Menschenrechte kann dann allenfalls negativ formuliert werden. Sie ist auf Beseitigung ungerechter Zustände, nicht auf Perfektion gerechter Zustände, gerichtet. Sie ist nur als Gegenprinzip zur kommunikativen Verletzung von Leib und Seele, Protest gegen Unmenschlichkeiten der Kommunikation möglich, ohne dass jemals positiv gesagt werden könnte, was die Bedingungen einer „menschengerechten“ Kommunikation wären.
Gunther Teubner, Die anonyme Matrix
2.
Das Amt für die Arbeit an unlösbaren Problemen wurde vor einigen Jahre in der Denkerei in Berlin-Kreuzberg eingerichtet. Das war Teil des Werkes eines weiteren, mir vorbildlich arbeitenden Vorbildes, von Bazon Brock, der damals sagte, er habe sich inzwischen vom Sorgenkind zum Wundergreis entwickelt.
Brock rief eines Tages in Weimar an und wollte, dass ich mitmache. Alles was Brock macht, mache ich mit, egal wie. Alles. Der war mein erster Chef, nach dem zweiten Staatsexamen und schnellvergehenden Jahren in einer cheflosen Anwaltskanzlei ist der mein erster Chef geworden. Alles Ein- und Ausbgebrockte mache ich seitdem mit. Entweder sage ich nämlich ja und mache dann aktiviert und passioniert mit (weil Brock in der Teamarbeit ein suprematistischer Maximalbrocken ist) mit oder ich sage nein und mache das dann aktiviert und passioniert mit. So oder so werde ich aktiviert und passioniert, Brock möchte ganz gerne als Chef und Amtsleiter, dass man das aktiviert und passioniert mitmacht und dann aktiv einsteigt. Er hat dann eine von sommerlichem Charme bis nachdrücklicher Bestimmung, die noch fern anrollende Gewitter erinnert, schwingende Stimme, zählt viele Vorteile des Mitmachens auf, die an die Möglichkeit grenzen sollen, dann die Welt regieren zu können. Es kommen machmal sogar dazu Angebote, die man nicht ablehnen kann. Also habe ich, bevor es dazu kam, gleich ja gesagt, schwupps. Ich mache dann im Unterlassen das Mitmachen mit. Das Amt in Kreuzberg, die Denkerei, habe ich nicht einmal betreten, immer nach Möglichkeit verfolgt was passierte, immer aktiviert und passioniert dabei, aus der Ferne, aus der Distanz - und alles unterlassen.
Für die Denkerei, für alles, was da passierte, übernehme ich jetzt nicht persönlich die Haftung und stehe dafür beruflich ein, das habe ich bereits durch Unterlassen getan. Brock rief an, ich sagte ja, bekam eine Zuständigkeit und habe alles weiter unterlassen.
3.
Vorbilder sind mimetische Instanzen. So jemand ist einem Vorbild, zu dem es so oder so Resonanz gibt. Die Resonanz läuft nicht nicht auf Einbahnstraßen, nicht auf Zweibahnstraßen, nicht auf Dreibahnstraßen, eher wie am Place d'Etoile. Bazon Brock ist mir vorbildlich, weil sehr sehr viel von dem, was mir vorbildich ist, sich in ihm phasen- und stellenweise bündelt und bricht, dort verkehrt und verdreht. Als würde einem in der Wüste ein oszillierender Wassertropfen vor die Nase gehängt, man könnte ihn durchschauen und sehe dann ziemlich viel von dem Licht in der Wüste, die Wüste auch klein und verkehrt in diesem Wassertropfen. Vor der Nase ist der Wassertropfen riesig, was man drin sieht riesig, im Durst gigantisch.
Brock ist mit ein vorbildlich arbeitendes Vorbild, weil das, was in anderen Vorbildern vorkommt, durch ihn vorkommt. Der ist mir kein vorbildliches Vorbild, weil er ich glauben würde, dass er ideal wäre, ein Wahrsprecher wäre, der alles so macht, dass es dann schön und gut ist. Wohl kaum. Der ist mir ein Vorbild, aber kein Gott, kein Meister. Dem Brock entfolge ich anhänglich, alltäglich. dem bin ich folgenloses Gefolge.
Väter sind vermutlich schwierige Vorbilder, weil die Beziehung zu direkt und gradlinig verläuft und zu stark von den Konditionen des Erbens, des Erblassens und Erbnehmens bestimmt wird. Onkel, Onkel Donald, Onkel Bazon - in schrägen und diagonalen Linien ist es leichter, Vorbilder zu sehen.
Brock, der, so muss man das sagen, derjenige ist, der immer noch am besten oder intensivsten sagen kann, wer er ist, der alles Sagen über ihn und jede Beschreibung von ihm, jede Analyse und Kritik seiner schon vorweggenommen hat, damit auch einige in seiner Umgebung zum Schweigen gebracht hat, ist mir ein Vorbild, weil durch ihn andere Vorbilder vorkommen. Zum Beispiel Onkel Gunther. Der eine bricht sich im anderen. Onkel Gunther arbeitete zwar nicht offiziell im Amt für die Arbeit an unlösbaren Problemen, der fortunöse Gunther wurde von Onkel Bazon nicht angerufen. Er ist aber ein Zulieferer, vor allem mit seinen immer durchgehend durchdachten Arbeiten zum juristischen Negativismus, siehe oben.
Onkel Bazon und Onkel Gunther, zwei entenhausenartige Onkel derjenigen Ticks, Tricks und Tracks, die in meiner Brust wohnen, sind Kritische Theorie Frankfurter Schule, da wiederum aus unterschiedlichen Abteilungen. Brock Abteilung Benjamin, da aber auf wackelndem Stuhl, sogar die anderen aus der Abteilung Benjamin haben den Eindruck, wenn er die Abteilung betrete, könnten sie eigentlich Feierabend machen, der übernehme jetzt ja ohnehin die ganze Arbeit (bis auf den Kalender und die Reisekostenabrechung). Gunther ist Abteilung Nichtbenjamin, leider, in die Abteilung Benjamin hätte ich ihn gerne hin versetzt, aber er hat auch einmal versucht, mich in die Abteilung Nichtbenjamin, Unterabteilug Deutscher Professor zu versetzen, da gab es dann nur Reibereien. Schade, dass wir in unterschiedlichen Abteilungen sitzen, aber besser so.
3 notes
·
View notes
Text

Kommt, denn schon ist alles bereit. Lukas 14,17
Aus www.gute-saat.de
Wenn wir eingeladen werden, freuen wir uns, dass der Gastgeber an uns gedacht hat, freuen uns auf ein leckeres Essen und Gemeinschaft. Gern halten wir uns den Termin frei, damit nichts dazwischenkommt.
Jesus erzählt ein Gleichnis über eine Einladung. Ein Mensch möchte ein Gastmahl ausrichten und lädt viele dazu ein. Dann bereitet er alles für das große Fest vor. Als alles fertig ist, schickt er seinen Diener, der die Gäste zu Tisch lädt: „Kommt, denn schon ist alles bereit!“ Der Gastgeber rechnet fest damit, dass alle kommen, denn niemand von denen, die er eingeladen hat, hat bei der Einladung abgesagt. Doch nun kommt eine Absage nach der anderen: „Sie fingen alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen“ (V. 18). Warum? Der Termin für das Fest stand doch schon lange fest. Hätten die Eingeladenen ihre Vorhaben nicht dementsprechend planen können? War ihnen anderes wichtiger, als an diesem großen Fest teilzunehmen?
Jesus beendet das Gleichnis mit den ernsten Worten: „Ich sage euch, dass keiner jener Männer, die geladen waren, mein Gastmahl schmecken wird“ (V. 24).
Vielleicht erschreckt uns diese schroffe Aussage. Sie will nicht dazu passen, dass Gott als „langmütig“ beschrieben wird (2. Petrus 3,9). Ja, Gott ist geduldig, aber Gottes Geduld kennt auch Grenzen, wie das Gleichnis vom großen Gastmahl zeigt. Damit ist es zugleich eine ernste Warnung an uns: Wie steht es um uns, wenn Gott uns herzlich einlädt zu kommen? Sind wir so sehr beschäftigt, dass wir zu Gott gewissermaßen sagen: „Halte mich für entschuldigt …, ich kann nicht kommen“ (Lukas 14,18.20)? Ist uns alles andere wichtiger als die Einladung Gottes?
Gott möchte uns gern bei sich haben, doch um an seinem Fest teilzunehmen, müssen wir die Einladung auch annehmen.
Mehr unter www.gute-saat.de
0 notes
Text
04.04.25 07:30 - aufblauen
aufblauen. schatten auf sonnenfassade. leichte unruhe beim gedanken an den abend. auch freude. unruhige freude. soll man die geschichte erzählen, die einem gestern erzählt wurde. als gleichnis. will man diese tür öffnen?
0 notes
Text

Joachim Wtewael - Küchenstück mit dem Gleichnis vom Großen Gastmahl
0 notes
Text
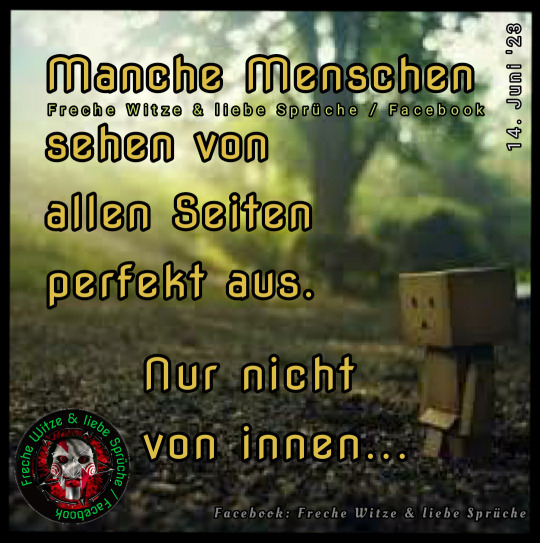
Freche Witze & liebe Sprüche / Facebook
#sprüche#spruch#sinnspruch#sinnsprüche#lebensweisheit#lebensweisheiten#parabel#gleichnis#freche witze & liebe sprüche
2 notes
·
View notes
Text
Der Topf

Der Topf · Hodscha Nasreddin · Parabel Erzählung Gleichnis
Einmal ging Hodscha Nasreddin zu seinem Nachbarn und fragte: »Kannst du mir einen Topf leihen?« Darauf antwortete der Nachbar: »Selbstverständlich!« Am nächsten Tag gab Nasreddin seinem Nachbarn den Topf wieder zurück und bedankte sich bei ihm dafür. Er hatte aber zusätzlich in den Topf noch einen kleinen Topf gestellt. An einem anderen Tag sagte der Nachbar: »Nasreddin, du hast einen kleinen Topf in meinem Topf vergessen.« Mit ernstem Ton sprach Nasreddin: »Der Topf war schwanger und hat bei mir ein Baby bekommen.« Als sich Nasreddin später wieder einmal einen Topf bei dem Nachbarn leihen wollte, gab dieser ihm den größten, den er im Hause hatte. Mehrere Tage vergingen, aber Nasreddin brachte den Topf nicht zurück. Schließlich fragte der Nachbar: »Wo ist mein Topf?« Nasreddin sprach ihm sein Beileid aus: »Er ist leider gestorben.« »So ein Unsinn«, erwiderte der Nachbar, »Wie kann ein Topf denn sterben?« »Wenn Töpfe Junge bekommen können, dann können sie auch sterben«, antwortete Nasreddin. Der Topf · Hodscha Nasreddin · Parabel Erzählung Gleichnis Read the full article
0 notes
Text
Matthäus 24,32-35
Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis: Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, daß der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, daß er nahe vor der Türe ist. Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.
0 notes
Text
Die Lehre bleibt aktuell Weihnachten 2024 – Arbeiten wir am Guten!
Die JF schreibt: »Weihnachten am Ende der Geschichte? Das Abendland mag verblassen, doch das Gleichnis von den Arbeitern der elften Stunde lehrt, daß auch heute das Streben nach göttlicher Nähe Sinn und Hoffnung gibt. Von David Engels. Dieser Beitrag Die Lehre bleibt aktuell Weihnachten 2024 – Arbeiten wir am Guten! wurde veröffentlich auf JUNGE FREIHEIT. http://dlvr.it/TGzdqz «
0 notes
Text
Buchtipp bei Angststörung: Menaris – ein Fantasy-Angst-Roman
Rezension zu „MENARIS – UNTERGANG EINE HELDEN“ von Jessica Oswald
„MENARIS“ ist ein Fantasy-Angst-Roman mit fesselnden Einblicken in die Komplexität der Psyche. Der Autorin gelingt es auf 222 Seiten, eine packende Geschichte zu erzählen, die Fantasie mit tiefgehenden Reflexionen über Wahrnehmung und Realität kombiniert.
Das Buch ist ab dem 12. Dezember 2024 überall im Handel (Taschenbuch und E-Book) erhältlich.
youtube
Über die Autorin
Jessica Oswald ist ein Pseudonym, über die Autorin ist kaum etwas bekannt. Sie wurde 1993 in München geboren und leidet im realen Leben ebenfalls an Angststörungen, inwieweit sie ihre persönlichen Erfahrungen in den Roman einfließen lässt, ist nicht ganz klar.
"Auf jeden Fall kann man auf eine gewisse Art auch frei sein, wenn man Angst hat. Wenn man nämlich weiß, dass jede Wahrheit nur eine Konstruktion ist. Das weiß fast keiner. Wahnsinnige wissen es. Zumindest die intelligenten. Die Normalos streiten dauernd darüber, was wahr ist, ohne zu checken, dass entweder alles oder nichts wahr ist, zumindest für einen Menschen." -- Denise, Seite 25
Hintergrund
Das Buch schafft es, Realität und Fantasie fast unauflösbar miteinander zu verweben. Dadurch betritt die Story ein Feld voller hoch philosophischer Fragen.
Deutlich wird das durch das berühmte Gleichnis des chinesischen Philosophen Zhuangzi, in welchem die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit hinterfragt werden.
“Einst träumte Zhuang Zhou (d. i. Zhuangzi), daß er ein Schmetterling wurde, der beschwingt umherflatterte. Er hatte Freude an sich und folgte allen seinen Regungen.
Dabei wußte er nicht, daß er Zhuang Zhou war. Plötzlich wurde er wach; da war er Zhuang Zhou – ganz eindeutig nur dieser. Nun weiß man nicht, ob es Zhuang Zhou war, der geträumt hat, er sei ein Schmetterling geworden, oder ob es ein Schmetterling war, der geträumt hat, er sei Zhuang geworden.” (Quelle: Henrik Jäger)
Die Protagonistin Denise erkennt für sich, dass Wirklichkeit nichts anderes als eine Konstruktion ist – etwas, das nur dann als wahr gilt, wenn viele Menschen daran glauben.
"Okay, ich weiß, das ist Paranoia. Ich glaube es auch nicht immer. Nur manchmal. (…) Die Tage, an denen ich all das nicht glaube, an denen ich weiß, dass ich eine armselige, nutzlose Geisteskranke bin, die sich grundlos in einer Wohnung versteckt und vor sich hinvegetiert – das sind die schlimmsten! Deswegen glaube ich lieber dran. Genau wie die mit ihrem Jesus." -- Denise, Seite 18 f.
Dieser Gedanke schmeckt nach Freiheit – genauer gesagt, sie fühlt sich dadurch (in Teilen) frei, ihre Realität selbst zu wählen und zu gestalten. Denise möchte sich bewusst an den Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit verlieren. Und damit ist sie nicht allein:
"Auf der anderen Seite dieses Baches soll es, so sagt man, eine andere Welt geben. (...) Ich habe sie oft gesehen. In meinen Träumen. Ich spreche dort mit den Tieren, genau wie hier. Aber sie antworten nicht. Das macht mich traurig. Und dann denke ich, dass ich, Menaris, vielleicht gar nicht der Träumer bin. Sondern der Traum." -- Menaris, Seite 91
Handlung
Die Geschichte dreht sich um Denise, die unter schweren Angststörungen und Depressionen leidet. Eine gute Portion Größenwahn, Psychose oder Borderline sind ebenfalls zu erkennen. Jedenfalls hat sie eine traumatische Kindheit und Jugend erlebt, die sie nur bruchstückhaft (verteilt über den ganzen Roman) erwähnt.
In einem verzweifelten Suizidversuch springt sie ins Löwengehege eines Zoos – wird allerdings vom Tierpfleger Nils gerettet. Das ist der Start für eine Fantasy-Geschichte, die es in sich hat. Denise verliebt sich in Nils, besser gesagt, sie ist besessen von ihm. Jedenfalls betritt sie die Welt eines Live-Rollenspiels, in der sie zur Kriegerin wird.
Was sich anfangs für Denise als Flucht oder Selbstfindung oder beides gleichzeitig darstellt, entpuppt sich im Laufe der Handlung als zweischneidig: Ihr Sprung in die Fantasiewelt hilft ihr zwar, zeitweise bzw. in einem bestimmten Kontext ihre Ängste zu überwinden, konfrontiert sie letztlich jedoch mit neuen Herausforderungen und Problemen.
Je mehr sie versucht, ihr “Schicksal” in die Hand zu nehmen und die Dinge nach ihren Wünschen zu lenken, desto mehr misslingen ihre Pläne. Letztlich ist die Geschichte von Denise so spannend wie auch tragisch.
"Was mich interessiert, ist diese Grenzüberschreitung (...) Ich will Wirkung. Das ist es. Ich will, dass meine Existenz nicht lautlos vorbeizieht wie eine Wolke. Ich will Narben hinterlassen." -- Denise, Seite 181
ÜBER DEN VERLAG
Monolith Film produziert und verleiht Independent-Filme. Eine Verfilmung von Menaris ist für das Jahr 2026 geplant. Im Buchtrailer zu Menaris spielen die Schauspieler, welche auch im Film die Hauptrollen übernehmen sollen: Sophia Schober und Saladin Dellers.
Fazit
„MENARIS – UNTERGANG EINE HELDEN“ von Jessica Oswald ist kein gewöhnlicher Fantasy-Roman oder Betroffenen-Bericht über Angststörungen; und letztlich bleibt die Frage offen, was von der ganzen Geschichte Wirklichkeit ist und was Fantasie.
Wichtig zu wissen: Das ist kein Philosophie-Buch, sondern ein Roman im umgangssprachlichen Stil, der am Rande das Thema Wirklichkeit berührt. Wer hier philosophische Ergüsse erwartet, wird sicherlich enttäuscht werden. Wer sich jedoch für individuelle Wahrnehmung in der Krankheit interessiert, der oder die findet hier Erfahrungswerte und Denkanstöße.
In jedem Fall ist das Buch fesselnd und erfrischend anders geschrieben. Ich persönlich fand es spannend zu lesen, denn die Geschichte entwickelt eine atemraubende Dynamik. Aufgrund der Klappen-Info hatte ich mit einer Art Liebesgeschichte von einer angstkranken Frau gerechnet.
Umso begeisterter war ich, dass sich auf den ersten Seiten ein ganz anderer Plot entwickelte.
0 notes
Text

Wie nutzt du die Talente, die Gott dir anvertraut hat, um sein Reich zu fördern?
In Matthäus 25,14-30 gibt Jesus ein Gleichnis, in dem ein Herr seinen Dienern Talente (eine Währungseinheit) gibt, bevor er auf Reisen geht. Jeder Diener erhält eine unterschiedliche Anzahl von Talenten, und sie werden danach beurteilt, wie sie diese Talente nutzen.
Die Talente, die in der Bibel erwähnt werden, sind ein Beispiel Besitz und Gaben, die Gott uns anvertraut.
Matthäus 25,16-18 heisst es: "Da ging der hin, welcher die fünf Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann fünf weitere Talente. Und ebenso der, welcher die zwei Talente [empfangen hatte], auch er gewann zwei weitere. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn."
Die Talente stehen symbolisch für alles, was Gott uns gibt – sei es Zeit, Fähigkeiten, Geld oder andere Ressourcen. Die Botschaft des Gleichnisses ist, dass wir diese Gaben treu und weise nutzen sollen, um Gottes Reich zu fördern. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen und das Beste aus dem zu machen, was uns anvertraut wurde.
Diejenigen die ihr Talente vermehrt haben empfangen Lob vom Herrn. Matthäus 25,20-21 Da trat herzu, der fünf Talente empfangen hatte, und legte weitere fünf Talente dazu und sprach: Herr, du hast mir fünf Talente anvertraut; siehe da, ich habe fünf Talente dazugewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen; geh hinein zu deines Herrn Freude!
Sehnst du dich auch danach, dass Jesus dich im Himmel empfängt mit diesen Worten?
Es gibt auch ein Knecht der sein Talent nicht vermehrt hat. Matthäus 25,24 Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte, und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist; du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast; 25 und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde; siehe, da hast du das Deine. 26 Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Böser und fauler Knecht! Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? 27 So solltest du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben, und wenn ich kam, hätte ich das Meine mit Zinsen erhalten. 28 Nehmt ihm nun das Talent weg, und gebt es dem, der die zehn Talente hat! 29 Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden; von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. 30 Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis; da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein.
Ich hoffe du gehörst nicht zu diesen Jüngern, die ihre anvertrautes Talent nicht einsetzen dadurch Gott untreu sind.
Mehr unter www.fitundheil.ch/treu
0 notes