#es scheint ihm wirklich ein inneres bedürfnis zu sein
Explore tagged Tumblr posts
Note
Nina, wie Klaas sich da förmlich in Jokos Arme geschmissen hat / ihn an sich gezogen hat. Konkurrenten who?! 😭
Ich hab’s bei Twitter schon gesagt, aber ich liebe diese Umarmungen von Klaas, die so euphorisch und ehrlich und von Herzen kommen, dass er Joko damit überrumpelt und der einen Schritt zurückgehen muss, um die Balance zu halten <3
Ich erinnere auch gerne an die U-Bahn Maz, als Klaas sich einfach gegen Joko hat fallen lassen.

Oder diese Umarmung.

Oder das Joko anspringen
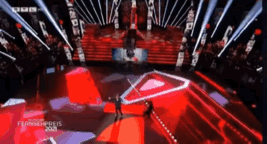
Oder… ach, ihr wisst schon.
#jk ask#joko und klaas#joko winterscheidt#klaas heufer-umlauf#dudw#jkvsp7#soft klaas ist der beste klaas#primetime soulmates#ich liebe es wenn klaas sich so freut und er es sofort mit joko teilen will#es scheint ihm wirklich ein inneres bedürfnis zu sein#und jokos überraschung/überforderung wäre so witzig wenn er es nicht ernst meinen würde#aber ich glaube der meint das wirklich ernst#weil die verrückt sind#anonymous#answered
40 notes
·
View notes
Text
Cetologie, Gehirnphosphor, Bleistift, Codes und Striche.
Die neuzeitliche Geschichte der Kulturtechniken Europas lässt sich entlang der Bekämpfung der Pest sowie der Durchsetzung grundlegender technischer Errungenschaften (Indienstnahme der Elektrizität zur Verschaltung von Reihen, Zündung des Verbrennungsmotors) und logistischer Verfahrensweisen – Etablierung der Doppelten Buchführung, Einführung des bibliothekarischen Systems, Stratifizierung von Administration im System ›Aktenlauf‹ – schreiben. Die Anschlussfähigkeiten und kreativen Dynamiken dieser Fertigkeiten stehen je am Beginn von Handlungslinien, deren Enden nun im 21. Jahrhundert zum kaum noch aufzulösenden Knoten geschürzt sind, der sich als auf Dauer gestellte Krise einschließlich Unsicherheit und ›Kontrollverlustangst‹ darstellt: irgendwann kam es zu einer etwas irrlichternden, jedenfalls kategorialen Dialektik der Innovation, Kommunikation und Prothetik; im Zuge der diversen Kriege, transzendentalen Herbergssuchen, Kopf- und Massenbewegungen, kapitalistischen Systembrüche und sozialen Aufstände – einer »Reise vom Hundertsten ins Tausendste« [1] – griff Robert Musils Diktum aus 1922: »Greif immer bis auf den Stein!« nicht wirklich. Und die Nacht der Unschärfen ist nicht einfach nur (mit einer von Dylan Thomas über King Crimson auf Azzo Kittler gekommenen Sentenz) »starless and bibleblack«. Da glimmen statt dem bestirnten Himmel über und dem moralischen Gesetz in uns oxidierende Phosphordämpfe, Blendgranaten, Bildschirme von Nachtsichtgeräten, glühende Serverfarmen, modernde Bäume im Moor und Feldspate im Widerschein.
Die alte Ordnung
Grund und Tiefenschichten der neuen Ordnungen lassen sich nachlesen, denn am Anfang von all dem stand der letternweise Buchdruck zur Schaffung von Originalkopien, und das Buch war beim Satz, und der Satz hatte fortlaufende Seitenzahlen. [2] Die materielle Serie ist der Beginn der Instanzen und Referenzsysteme zur Etablierung und Verbreitung der genannten Techniken; deren Ordnungsmuster eröffnen wiederum Scharnierfunktionen und Möglichkeiten der Korrespondenz, denn jede Serie verlangt nach Anschlussfähigkeit. Das Buch steht zwingend für Grenzziehungen und zugleich bereits im Singular aufgrund serieller Gesetzlichkeiten für seinen Plural. Sogar die Buchvolumina hatten einmal bis nach Amerika und auf Hoher See Signalwirkung, wenn etwa im »Cetology«-Kapitel von Melvilles »Moby-Dick« die Folio-, Oktav- und Duodezformate der Walkunde dienen: »The classification of the constituents of a chaos, nothing less is here essayed. […] But I have swam through libraries and sailed through oceans; I have had to do with whales with these visible hands; I am in earnest; and I will try [to] to boldly sort them that way. And this ist he Bibliographical system here adopted; and this is the only one that can possibly succeed, for it alone is practicable.« (MD Filet № 32; passim) Unter den Augen des Lesers überleben folgerichtig auch nur zwei: der weiße Wal, Objekt aller Zuschreibungen und Projektionsfläche, und des Leviathans kluger Erzähler. Dieser weiß um die Überlebenstechnik des Weiterschreibens und lässt sich deshalb manche Körperstelle (noch) nicht tätowieren: »to remain a blank page for a poem I was then composing« (MD Filet № 102). Wenn doch einmal alles mit Zeichen bedeckt sein sollte, sind beim Abflensen zum strahlend weißen Wunderblock avant la lettre die medial stets versierten Geister nicht mehr weit (MD Filet № 69) und – wird weiter beschrieben. »[T]he Geat American Novel […] was always imagined to be as solitary and omniseminous as the Great White Whale.« [3] So entwickelt sich der zutiefst materielle Gedanke vom Buch entlang der Linien und Abfolgen und ließe sich, ausgehend von Walter Benjamins Gedanken: »Geschichte schreiben heißt, Jahreszahlen ihre Physiognomie geben«, [4] für die wesentlichste Serienschaltung der sich irgendwie noch mitmachenden Kulturgeschichte formulieren: Buch lesen heißt, Seitenzahlen ihre Physiognomie zu geben; im Umblättern, in der Handhabung. Doch so strikt diese Ordnung ist, lässt sich in das gedruckte Buch auch schreiben (Das Einschreiben in den Stein, die Rinde, die Haut, das Buch ist wie das Einritzen stets auch Korrespondenz), hier lässt sich annotieren, unterstreichen; manche Palimpseste entstehen.
Verzettelter Gehirnphosphor
Generalstäbler Stumm von Bordwehr, [5] der weder Harpune noch Federkiel, aber dafür »angefangen [hatte], wissenschaftlich Taschenmesser zu sammeln« (MoE I.80), erhält 1913 den Auftrag, Informationen über eine ominöse Parallelaktion zu sammeln, Teil derselben zu werden. Die himmelblaue Weltkugel, ��bestehend aus Glück, aus Bedeutsamkeit, aus dem geheimnisvollen Gehirnphosphor innerer Erleuchtung«, (MoE I.80) bedarf der militärischen Intervention, auch wenn das weite Feld der k.u.k. Parallelwelt, auf das der »kleine General« reiten soll, nichts mit einem aus der Erzengel-Prüfung zu tun hat und ihm folglich so fremd ist wie die hier anzuwendenden Strategien. Immerhin steht an der Spitze des Unternehmens Diotima, »diese Antike mit einem wienerischen Plus« (MoE I.46), die alsbald auf seinem Herzen steht »wie Maria auf dem Kopf der Schlange« (MoE I.80). Um sich ihr auf Augenhöhe nähern zu können, denn eine »der wichtigsten Bedingungen der Feldherrenkunst ist es, sich über die Stärke des Gegners Klarheit zu verschaffen« (MoE I.100), dringt Stumm von Bordwehr in die Staatsbibliothek ein. Diese ist in ihrer schieren Quantität an Büchern nicht auszulesen, doch er gelangt in das Katalogzimmer, ins »Allerheiligste der Bibliothek«, wo es nichts gibt »wie Kataloge und Bibliographien, so der ganze Succus des Wissens, […] nur Bücher über Bücher: es hat ordentlich nach Gehirnphosphor gerochen« (ibid.) [6] Die Ratlosigkeit wächst, bis ihn ein alter Bibliotheksdiener mit »vom Bücherstaub oder vom Trinkgeldgeschmack« milder Stimme über die geheimen Techniken perfekter Ordnung aufklärt und sein deus ex machina wird: er besorgt ihm jene Bücher, die Diotima sich bestellt hat, bevor sie selbst diese in die Hand bekommt; der General kann fortan mit dem Bleistift in der Hand der Angebeteten Gedanken beiwohnen: »[W]enn ich jetzt in die Bibliothek komme, ist das geradezu wie eine heimliche geistige Hochzeit, und hie und da mach ich vorsichtig mit dem Blei an den Rand einer Seite ein Zeichen oder ein Wort und weiß, daß sie es am nächsten Tag finden wird, ohne eine Ahnung zu haben, wer da in ihrem Kopf drinnen ist, wenn sie darüber nachdenkt, was das heißen soll!« Stumms schreibt sich mittels Marginalia in die Matrix des Unterfangens Parallelaktion ein, das nach der einen großen, zündenden Idee sucht und im Weltbrand enden wird. [7] Was der eine anhand derselben vorweg durcharbeitet, denkt die andere nach. Die Liebes- und Gedankensteganographie auf der Material- respektive Zeichenbasis des je vorgefundenen, gedruckten Buches bedient sich eines public key; der notwendige private key eines derart asymmetrischen Verfahrens funktioniert nur unter dem imaginierten Bedingungsgefüge der Parallelaktion und ist somit für Dritte wie den Bibliotheksdiener nicht restlos zugänglich. Zu den vielfältigen und a.a.O. bereits dargelegten »anderen Verwendungsformen des Buches« [8] kommt so noch die des Kassiberformulars; die Wirksamkeit des Vorgehens entscheidet sich über die gebundene Ordnung (ähnlich der terroristischen Zelle, die mit einer Ausgabe des »Moby-Dick« kommunizierte). Musils Stumm beachtet schließlich auch Techniken der Aufmerksamkeitsökonomie: nur »hie und da« wird (unter der – zwingend zu setzenden – Annahme einer vollständigen Lektüre aller Seiten) markiert oder eine Anmerkung gesetzt. Würde viel oder gar alles unterstrichen, wäre die Relevanz suspendiert und der Weg der Gedanken erneut dem Zufall überlassen. [9] Dies aber würde, wie der Generalstäbler in Weiterführung einer Sentenz Ulrichs (»Geist ist Ordnung, und wo gibt es mehr Ordnung als beim Militär?«, MoE I.85) deutlich macht, ein gewisses Risiko bergen: »Irgendwie geht Ordnung in das Bedürfnis nach Totschlag über.« (MoE I.100) Gehirnphosphor scheint ausgesprochen instabil zu sein.
Ordnung, Spuren & – ein Gedankenstrich
Jede folgende kulturelle Leistung, die mit dem – wesentlich: dreidimensional zu begreifenden Objekt – Buch zusammenhängt (lesen, schreiben, annotieren, kommentieren oder zeichnen und nicht zuletzt der Satz), wird vom medientheoretisch relevanten Ausgang ›Fertigungszusammenhang‹ her geprägt. Unserem heutigen Zustand ist eine Jahrhunderte alte analoge Kulturgeschichte und -technik vorgeordnet. Bindung, fixierte Seitenabfolge, Festlegung von recto und verso, sorgfältige Anwendung von Cetologie und Typografie [10] stehen für das ›Ordnungsprinzip Buch‹. Ähnlich stellt sich die Organisation des Plurals dar: wie schon das notwendige »Beiwerk« der Bücher – Listen, Zettelkästen, [11] Datenbanken, Kataloge, Bibliografien u.a. (der »Gehirnphosphor«) – stellt auch die architektonische Umsetzung in Form einer Bibliothek oder bloß eines Bücherregals auf eine Vorstellung von ›Einheit‹ ab. In einer derart institutionalisierten Ordnung ergeben Druck bzw. erste Einschreibung in Verbindung mit der zweiten Einschreibung ein eigenes Amalgam der Zeichen und Bedeutungen: »Du kannst die Sätze, durchstrichen, lesen. Nicht so die Gedankenstriche.« [12] Bereits der 17-jährige Arthur Schnitzler notierte: »Ich möchte alle Philosophie zum Fenster hinausschmeißen, wenn dafür – Ein Gedankenstrich ist nie zu verachten.– ’s war übrigens mehr ein Gefühlsstrich. […].« (08.04.1880) Wie wesentlich eine solche Spur ist (wir lassen Kleists Gedankenstrich aus der »Marquise von O....« draußen), zeigt sich in Freuds Beschreibung des »Moses des Michelangelo«, wenn dessen »Hand in sehr eigentümlicher, gezwungener, Erklärung heischender Weise zwischen den Tafeln und dem – Bart des zürnenden Helden vermittelt.« [13] Nach Marianne Schuller ist hierbei eine Leerstelle markiert: »Nicht ein Gewesenes blitzt auf, sondern der Hinweis, daß es vergangen ist. Oder: daß es fehlt.« [14] Der Gedankenstrich ist – pars pro toto – nur eine von vielen möglichen Spuren, die man im Text manchmal nur in Umkehrung der Spuren zu lesen hat, als wäre der Autor rückwärtsgegangen (Das lernt man im Western, bei Sherlock und auch bei Freud): Auf derselben Seite wie ebenjener Gedankenstrich, im Absatz davor, kommt Freud auf Ivan Lermolieff aka Giovanni Morelli zu sprechen und findet in seiner Lektüre die Psychoanalyse begründet (in einer Bibliothek des Warburgschen Systems stehen die Detektivromane am selben Regal). Freud publizierte seinen Essay 1914 anonym; in ebendiesem Jahr hätte der an einem Augusttag 1913 mit einem Verkehrsunfall einsetzende »Mann ohne Eigenschaften« in der Eröffnung des Realschießens enden sollen und beginnen »Die letzten Tage der Menschheit« mit der Ausrufung einer »Extraausgabee ―!«. Diese Anheischung wird in der Bürokratie der Kriegspressequartiere Teil eines Medienverbunds völlig neuer und immer schnellerer Zuschnitte; in diesen Tagen und Jahren gelangt der Prolog der immer umfassenderen digitalen Revolution zur Aufführung, die zwar die meisten Möglichkeiten des gedruckten Buches nicht transformieren wird – aber neue Spielräume schaffen sollte.
[1] Robert Musil: Das hilflose Europa oder Reise vom Hundertsten ins Tausendste. In: Ders.: Gesammelte Werke Bd. 8. Hg. v. Adolf Frisé. Reinbek 1978, S. 1075–1094. (Folgezitat S. 1085.) [2] Darum geht es unter dem Strich: ohne materieller medialer Grundlage ist systematisiertes Wissen, sind Korrespondenzen und folglich Kulturerscheinungen kaum zu denken. (Cf. etwa Peter Burke: Papier und Marktgeschrei. Die Geburt der Wissensgesellschaft. Aus d. Engl. v. Matthias Wolf. Berlin 2001 / Ders.: Die Explosion des Wissens. Von der Encyclopédie bis Wikipedia. Aus d. Engl. v. Matthias Wolf unter Mitarbeit von Sebastian Wohlfeil. Berlin 2014.) [3] Lionel Trilling: Art and Fortune, 1948 [zit. nach: Carlos Spoerhase: Linie, Fläche, Raum. Die drei Dimensionen des Buches in der Diskussion der Gegenwart und der Moderne (Valéry, Benjamin, Moholy-Nagy). Göttingen 2016, S. 56; S. 57ff. handelt dann mehrfach von der Analogie des Walfischs in Bezug auf umfangreiche Bücher mit Totalitätsanspruch. [4] Walter Benjamin: Das Passagen-Werk. Gesammelte Schriften Bd. V.1. Hg. v. Rolf Tiedemann. Frankfurt/Main 1991, S. 595. [5] Musils Stumm von Bordwehr, dem Karl Kraus in den »Letzten Tagen der Menschheit« die Figur des Generalobersten und Blutsäufers (vornehmlich anvertrauter Mannschaften) Pflanzer-Baltin widmete; jener Pflanzer-Baltin, der nach 1918 beim prominent besetzten Armeleuteessen à la bonne heure der Eugenie Schwarzwald, neben Robert Musil zu sitzen kam, damit er nicht neben dem Rotgardisten Egon Erwin Kisch Platz nehmen muss. Ein Pflanzer-Baltin, dem das heitere »Rrtsch – obidraht!« ebenso leicht von der Zunge ging wie den meisten anderen Hyänen Kraus’. (Grundlegend zur Frage von Enthauptungen cf. Michael Rohrwasser: Danton’s Tod, Moskau 1937 und die Guillotine. In: Enttäuschung und Engagement. Zur ästhetischen Radikalität Georg Büchners. Hg. v. Hans Richard Brittnacher u. Irmela von der Lühe. Bielefeld 2014, S. 83–112.) [6] Als Militär wird Stumm von Bordwehr mit den giftigen weißen Phosphor gemeint haben, dessen Dämpfe bei Oxidation zur Chemolumineszenz neigen, dem Leibniz ein Gedicht widmete und der sich hervorragend für Brandbomben eignet; cf. Stefan Rieger: Phosphor. In: Bunte Steine. Ein Lapidarium des Wissens. Hg. v. Benjamin Bühler u. Stefan Rieger. Berlin 2014, S. 140–153. [7] Zu deren Endspiel cf. Walter Fanta: Krieg. Wahn. Sex. Liebe. Das Finale des Romas »Der Mann ohne Eigenschaften« von Robert Musil. Klagenfurt 2016. [8] Cf. Michael Rohrwasser: Kleines Lexikon der anderen Verwendungsformen des Buches. In: Thomas Eder, Samo Kobenter, Peter Plener: Seitenweise. Was das Buch ist. Wien 2010, S. 53–78. [9] Camus notiert im April 1939 eine Warnung vor allzu dicht gesetzten Markierungen: »… Wie jene Bücher, in denen zu viele Stellen mit Bleistift angestrichen sind, als daß man vom Geschmack und dem Geist des Lesers eine gute Meinung haben könnte.« (Albert Camus: Tagebücher 1935–1951. Reinbek: 1989, S. 80). [10] Roland Reuß: Die Mitarbeit des Schriftbildes am Sinn. Das Buch und seine Typografie in Zeiten der Hypnose. In: Neue Zürcher Zeitung v. 3.2.2011, S. 17. Cf. weiters: Roland Reuß: Die perfekte Lesemaschine. Zur Ergonomie des Buches. Göttingen 2014. [11] Der Zettelkatalog ist eine der Ordnung des Buches (Arno Schmidt, Walter Kempwski et al.) vorangestellte Strukturierungsleistung. Der Zettelkatalog präformiert mit seinem schier unendlichen Angebot an Ordnungsvarianten, aus denen sich auch die je eigene, neue bilden lässt, jenen Ordnungszusammenhang, der die Nutzung eines Buch vorbildet. Cf. grundsätzlich Markus Krajewski: Zettelwirtschaft. Die Geburt der Kartei aus dem Geist der Bibliothek. Berlin 2002; cf. weiters: Hans Petschar, Ernst Strouhal, Heimo Zobernig: Der Zettelkatalog. Ein historisches System geistiger Ordnung. Wien, New York 1999. [12] Roland Reuß: Lesen, was gestrichen wurde. Für eine historisch-kritische Kafka-Ausgabe. In: Frank Kafka. Historisch-Kritische Ausgabe sämtlicher Handschriften, Drucke und Typoskripte. Einleitung. Hg. v. Roland Reuß unter Mitarbeit v. Peter Staengle, Michael Leiner u. KD Wolff. Frankfurt/M. 1995, S. 9–21, hier S. 21. [13] Sigmund Freud: Der Moses des Michelangelo. In: Ders.: Gesammelte Werke Bd. 10: Werke aus den Jahren 1913–1917. Frankfurt/M. 1999, S. 171–201, hier S. 185. [14] Marianne Schuller: Bilder – Schrift – Gedächtnis. Freud, Warburg, Benjamin. In: Raum und Verfahren. Interventionen v. Aleida Assmann u.a. Hg. v. Jörg Huber u. Alois Martin Müller. Basel, Frankfurt/M. 1993, S. 105–125, hier S. 109.
3 notes
·
View notes
Text
Vom Mangel in die Fülle
Nach 25 Tagen mit Waschlappen und Wasser, haben wir gestern das erste Mal wieder geduscht.
Während das Wasser nicht nur den Schmutz, sondern auch die Emotionen der letzten Tage und Wochen mit sich weggespült hat, kam tiefe Wertschätzung in mir auf. Ein erfüllendes Gefühl der Dankbarkeit für alles was ich habe und das Leben, das wir uns in jedem Moment erschaffen. Für eine warme Dusche, die vor ein paar Monaten noch so selbstverständlich war und jetzt zu einem absoluten Highlight wird.
Die meisten von uns leben in einem ständigen Gefühl von Mangel!
Das das Wort Mangel viele triggert und häufig zu vergleichen mit Menschen führt, die “wirklich” im Mangel leben, weil es ihnen an den grundlegendsten Dingen, wie beispielsweise Sicherheit, Nahrung oder auch Bildung fehlt, liegt meiner Meinung nach daran, dass die meisten von uns innerlich irgendeine Art von Mangel empfinden, den wir uns im Hinblick auf die globalen Umstände und Ungerechtigkeiten nicht ein- oder zugestehen wollen. Unbewusst oder bewusst glauben wir vielleicht, dass es uns an Liebe, Geld, Ressourcen, Fähigkeiten, Menschen oder Erfahrungen mangelt.
Das Gefühl von Mangel ist für viele eine Realität.
Die Betonung liegt hierbei auf “Gefühl” und “Realität”. Unsere Gefühle sind Wegweiser, ein Kompass, der uns anzeigt, was wir brauchen, was sich gut anfühlt und was sich für uns nicht gut anfühlt. Unsere Realität erschaffen wir durch unseren Geist, sie ist somit extrem subjektiv und abhängig von unserer Fähigkeit gleichzeitig Erschaffer und Beobachter zu sein. Das ist Bewusstsein. Mit der Zeit haben wir vergessen, was und wer wir wirklich sind und haben eine, wie Deepak Chopra es nennt, virtuelle Realität konstruiert, die auf Identitäten, Geschichten, Mythologien, Glaubenssätzen und Konditionen fundiert, die wir individuell und gemeinschaftlich als wahr anerkennen.
Wo kommt das Gefühl von Mangel überhaupt her?
Als Erwachsene entsteht dieses Gefühl im Ego, dass sich ständig vergleicht, auf sich bezieht und um das “Überleben” kämpft. Überleben bedeutet in diesem Fall der virtuellen Realität, von der oben die Rede war, gerecht zu werden, um reinzupassen.
Das Gefühl von Mangel entsteht aus unserem grundlegendsten Bedürfnis nach Ganzheit und unserer Wahrnehmung, dass uns zur Ganzheit etwas fehlt, dass wir nicht gut genug, nicht liebenswert genug, nicht schön oder schlau genug sind. Diese Glaubenssätze haben ihren Ursprung häufig in unserer frühsten Kindheit. Die Erfahrungen reichen von Momenten, in denen wir als Baby von unserer Mutter getrennt wurden, bis zu Erfahrungen, in denen unsere engsten Bezugspersonen uns das Gefühl vermittelt haben, dass etwas mit uns nicht stimmt und wir noch nicht in der Lage waren, ihre Aussagen und Handlungen in einen größeren Kontext zu setzen und zu reflektieren. Studien zeigen, dass Säuglinge, die wenig gestreichelt und geschmust werden, in ihrer Entwicklung viel langsamer und eingeschränkter sind, als Babys, die viel Körperkontakt, Wärme und Zuneigung erleben.
Wir müssen lernen kritisch zu hinterfragen, was wir bisher für “real” und “wahr” gehalten haben.
Nur so können wir als erwachsene Menschen über das Gefühl von Mangel hinaus gehen. Durch diese Fragen fällt das Konstrukt unserer virtuellen Realität nach und nach in sich zusammen und wir erkennen das Leben, wie es wirklich ist und damit unsere Ganzheit. Ein tolles Beispiel ist unser Körper. Er ist das reinste Wunder und erschafft sich in jeder Sekunde neu, alles ist in Bewegung und Veränderung. Kein Knochen ist so hart, wie er scheint. Die Härte ist eine Illusion, die unser Geist fabriziert, um mit der Fülle an Informationen umzugehen, die unsere Sinne in jedem Moment aufnehmen. Alle Prozesse sind präzise aufeinander abgestimmt, jede Zelle arbeitet im Sinne des Ganzen.
Wir fühlen uns in einer sehr luxuriösen und privilegierten Situation in unserer Zeit.
Eine weiße Frau und ein weißer Mann aus gutem Haus, geboren in einem der mächtigsten Länder der Welt, mit Zugang zu großartiger Bildung und einer Fülle an Möglichkeiten. Es ist nicht nur so, dass sich tief in unserem Inneren etwas nach Ganzheit sehnt und uns antreibt, sie in uns selbst zu finden. Wir empfinden auch eine gewisse Verantwortung, unser Leben in die Hand zu nehmen und zurück nach Hause zu kommen. Aufzuwachen!
Denn solange wir schlafwandeln, unsere Gefühle unterdrücken und uns selbst und damit auch einander verurteilen, werden wir immer ein Gefühl von Mangel verspüren. Wenn wir diesem Gefühl in unserer Realität keine Berechtigung einräumen, uns erlauben es zu fühlen und von ihm zu lernen, wird sich Mangel in unserer gemeinsamen virtuellen Realität immer wieder manifestieren.
Es ist genug für uns alle da!
Das Menschen im Mangel leben und es ihnen an Dingen fehlt, die die meisten, die diesen Zeilen lesen, im Überfluss haben, liegt nicht etwa daran, dass nicht genug für alle da wäre, sondern daran, dass diejenigen mit Macht und Einfluss (jede*r einzeln*e von uns), immer mehr brauchen, um unseren gefühlten Mangel zu befriedigen. Was Menschen, die in “echtem” Mangel leben, wirklich brauchen, ist, dass wir Verantwortung für uns selbst übernehmen, dass wir bei uns anfangen und uns heilen, denn damit heilen wir auch unsere Umwelt.
Mit dem Leben im Van haben wir uns in mancher Hinsicht künstlich in eine Art Mangel versetzt.
Unser Leben hat sich vereinfacht und damit ist der Lärm unserer Gedanken leiser geworden. Wir leben bewusster und spüren mehr und mehr einen ganz natürlichen Wunsch, aus vollem Herzen zu geben, weil unsere Gedanken nicht mehr ständig nur um uns selbst und unseren gefühlten Mangel kreisen. Wir empfinden Wertschätzung und Dankbarkeit für alles, was wir haben. Die kleinen, wie die großen Dinge.
Es braucht kein Leben im Van, um Bewusstsein zu schaffen. Wir alle können dort anfangen, wo wir gerade stehen, indem wir ein wenig Einfachheit in unseren Alltag bringen, Hintergrundgeräusche minimieren, um unsere innere Stimme wahrzunehmen und lernen, wieder über die Wunder des Seins zu staunen. Wir können Hier & Jetzt unseren Gefühlen mehr Raum geben und einen Teil unseres Selbst einladen und umarmen, der so lange abgeschnitten war.
Du kannst jetzt damit anfangen und dich selbst für Fülle öffnen:
Was fühle ich gerade?
Was brauche ich gerade?
Wofür bin ich heute dankbar?
Josefine ♥
Fotos © Stefan Weichand
0 notes
Text
Halt mich fest
Lesedauer: 6min
Was ist denn überhaupt wahr?!
Was, wenn sich die Welt im freien Fall befände und drohe unaufhaltbar abzustürzen? Was, wenn kein Superheld zur Stelle wäre, der sich kümmern würde? Wenn der Mensch sich selbst überlassen bliebe, weil er sich selbst überlassen sein wollte? Und damit erst für das ganze Ducheinander verantwortlich wäre?
Hey du,
ich fühle mich abgeschnitten vom Rest der Welt! Schuld ist eine Baustelle. Maschinen zerfräsen den erneuerungsbedürftigen Asphalt einer der Hauptverkehrsstraßen unseres Nachbarortes, die uns mit der nächsten größeren Stadt und mich mit einigen meiner Freunde (und dem IKEA, den ich vor meinem Umzug nächste Woche gerade regelmäßig besuche), verbindet.
Eine Umleitung ist eingerichtet. Ungefähr zehn Minuten mehr sollte man jetzt einplanen. Das ist ärgerlich, aber machbar. Man muss sich nur darauf einstellen. Andere scheinen das anders zu sehen. Auf halbem Weg der Umleitung gibt es eine schmale Anliegerstraße, die durch das Wohngebiet um die Baustelle herumführt. Für Anlieger ist sie freigegeben, doch in den ersten Tagen nutzen auch viele andere Verkehrsteilnehmer diesen Weg um der längeren Umleitung zu entgehen. Schon am ersten Tag muss ein Streifenwagen angefordert werden, um Strafzettel zu verteilen.
Also wird doch die Umleitung gefahren. Aber nicht die ganze. Bei der nächstbesten Möglichkeit sieht man den Großteil der Autos in der nächsten Siedlung verschwinden, deren Anwohner eigentlich vor dem Durchgangsverkehr geschützt werden sollten. Bis die Polizei auch diese Straße sperrt. Natürlich: Zeit ist kostbar. Und manchmal auch knapp. Da ärgert man sich über jeden Umweg und jede Umleitung. Aber darf man deswegen die Regelungen der Polizei und die Ruhe der Anwohner ignorieren? Die Wahrheit der Situation einfach für sich passend zurechtbiegen. Wie kommen wir dazu, unser Wohl über das der Allgemeinheit zu stellen oder für unsere Zwecke Gesetze zu missachten? Ist das nicht unverhältnismäßig?
Halt! Wir verlieren ihn
Für die Bewertung von Grenzüberschreitungen und das Anerkennen von Wahrheiten ist unser Gewissen verantwortlich. Wenn wir uns bei schwierigen Entscheidungen an irgendetwas halten wollen, dann hören wir in uns hinein, auf unsere innere Stimme. Doch unser Gewissen existiert nicht etwa im luftleeren Raum. Es ist ein fein geeichtes Instrument, das durch die Kultur, in der wir leben, die Grundsätze, an die wir glauben und unser Verhalten eingestellt wird. Ob es uns gut und richtig führt - oder in die Irre - entscheiden demnach letztlich zu einem großen Teil auch wir selbst.
Das, was wir für uns zum Maßstab erheben, wird zu unserem Maß aller Dinge.
In diesem Zusammenhang interessant: Barak Obama sprach vor Kurzem öffentlichkeitswirksam davon, dass ein Großteil der heutigen Politik die Idee einer objektiven Wahrheit nicht mehr anzuerkennen scheine.
"Heutzutage scheint die Politik das Konzept einer objektiven Wahrheit abzulehnen. Leute erfinden schlicht und einfach Dinge um selbst besser dazustehen. Stichwort: Fake news. Aber weshalb regt es uns so auf, wenn wir feststellen, dass wir von den Lenkern unseres Landes, Wirtschaftsbossen oder Weltpolitikern belogen werden? Wir sehen uns nach Wahrheit
Ich glaube, dass wir Menschen grundsätzlich ein tiefsitzendes Bedürfnis nach richtig und falsch, wahr und unwahr haben. Wir brauchen feste Wahrheiten und Unwahrheiten. Mit ihnen eichen wir unseren inneren Kopass. Sie geben uns Halt im Meer der Möglichkeiten. Und diesen Halt verlieren wir mehr und mehr, weil wir die Kategorien richtig und falsch immer wieder neu füllen. Die Zeiten seien "merkwürdig und unsicher", sagte Obama in derselben Rede. Jeder Tag bringe neue, atemberaubende und verstörende Schlagzeilen mit sich^.
Wir spüren diese stärker werdende Verunsicherung. Was heute noch gilt, kann morgen schon irrelevant sein. Ich frage mich: War das nicht schon immer so? Waren wir nicht schon immer uns selbst überlassen im Ringen um die Wahrheit, um Werte und Normen? Kann sein. Und doch unterscheidet sich unser Denken heute radikal vom Denken der vergangenen Jahrhunderte. Me, myself and I Vom Apfelsnack im Garten Eden, über den Turmbau zu Babel und die Aufklärung bis hin zu der berühmten Aussage des Philisophen Nietzsches: "Gott ist tot!" - Seit es uns Menschen gibt, streben wir danach, wie Gott zu sein. Selbst Schöpfer und Bestimmer zu sein. Bis zur Aufklärung vor ca. 200 Jahren war jedem Menschen klar, dass es eine Macht außerhalb der Erde geben musste. Selbst wer nicht an Gott glaubte, wusste, dass es höhere Mächte geben musste. Er unterstellte sich und seine Sicht der Welt diesen höheren Wesen und bezog daraus nicht nur seine Identität, sondern auch zum Teil sein Wissen und auf jeden Fall seine Werte. Richtig und Falsch wurden außerhalb der Menschen definiert.
Heute wollen viele ohne Gott leben. Sie haben ihn wegrationalisiert und definieren selbst, was richtig und was falsch ist. Gott wird "abgeschafft". Und mit ihm auch unsere einzige externe Quelle von Wahrheit. Die Menschen stehen jetzt allein und definieren Wahrheit und Recht nur noch aus der eigenen Weltsicht. Und so wird Wahrheit zur Verhandlungssache und die Meinung der Mehrheit zu einer trügerischen Sicherheit. Jeder biegt sich die Situation eben so hin, dass sie in sein/ihr Weltbild passt. Frieden, Wahrheit, Recht und Unrecht sind Ansichtssache geworden.
Von wegen tolerant
Noch nie zuvor hatten Toleranz und "den anderen so stehen lassen" in unserer Gesellschaft einen so hohen Stellenwert wie heute. Heutzutage ist eigentlich alles erlaubt, nur eines nicht: zu behaupten, man hätte die alleinige Wahrheit gefunden. "Der eine sieht es eben so und der andere so. Manche glauben eben an einen Gott, andere nicht." Das stimmt sicherlich. Aber wenn der eine sagt: "1+1 = 2" und der andere sagt: "1+1 = 3", dann sehen es beide anders, aber ist auch dann beides wahr? Spätestens seit Donald Trumps zum Präsidenten der USA gewählt wurde reden Zeitungen und Journalisten vom "postfaktischen Zeitalter". Also von der Zeit nach den Fakten. Objektive Wahrheit sind Vergangenheit. Wahrheit ist jetzt das, was jemand zur Wahrheit erklärt. Es scheint verrückt, aber wir akzeptieren sogar Präsidenten, die so handeln. Wir akzeptieren, dass jemand lügt und manipuliert und trotzdem sein Amt behält.
Schluss mit Eierkuchen
Aber warum? Welche Sehnsucht treibt die Menschen über ihre Grenzen hinaus? Welches ungestillte Verlangen ist so groß, dass die Gesellschaft sich wissentlich selbst schadet? Ich glaube, um diese Frage beantworten zu können, müssen wir an den Anfang zurück gehen. Also ganz an den Anfang. In den Garten Eden. Wo die Menschen im Überfluss und in enger Gemeinschaft mit Gott lebten. Friede, Freude, Eierkuchen... Bis auf diesen einen Baum, der da war. Dieser Baum von dem Gott gesagt hat: "Esst nicht von seinen Früchten, ja- berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben! (1. Mose 3,3) Bullshit meinte die Schlange! "Ihr werdet nicht sterben. Aber Gott weiß: Wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet - ihr werdet sein wie Gott und wissen, was Gut und Böse ist." Und der Mensch glaubte die Lüge. Glaubt sie bis heute. Wir glauben es besser zu wissen, was gut für uns ist. Wir glauben zu wissen, dass man keinen Gott mehr braucht. Die Menschheit ist größer geworden, aber nicht reifer. Sie benimmt sich immer noch wie ein Kind. Einfältig und leichtgläubig. Wie ein Kind probiert der Mensch nach jedem Fehlschlag erneut, auf dieselbe Weise seine Ziele zu erreichen. Und scheitert. Lost dimension
Dabei weiß er von Gott. In der Bibel steht: "Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar; er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung." (Römer 1, 19-20)
Gott hat das Wissen um ihn und die Ewigkeit ins Herz des Menschen gelegt. Und trotzdem haben die Menschen ihn aus ihren Leben entfernt. Eine tragische Konsequenz dvon ist der Verlust ewiger Werte und Leitbilder für das gemeinsame Zusammenleben kann. Eine andere ist die unstillbare Sehnsucht, dass es da mehr geben muss als das, was wir kennen. Unser Leben ist begrenzter geworden. Zweidimensional. Es fehlt ihm an Tiefe und Bedeutung.
Wir haben ein Loch in unserem Herzen ein Loch, so groß wie ein Gott.
Wir sehnen uns nach mehr
Was sagt uns dieses Gefühl? Diese Sehnsucht nach mehr? Man kann nur etwas begehren, was man schon kennt. Wir können nur vermissen, was wir schon einmal hatten.
Mal angenommen, dieser Hunger, diese Sehnsucht - sie sind Signale aus einer anderen Dimension. Einer Dimension, in der die Menschheit mal gelebt hat ner Dimension, in der wir innerlich satt und zufrieden waren. Dieses Gefühl sagt uns: du warst schon einmal da. Es ist ein ähnliches Gefühl wie das, das uns bei Umleitungen frustriert, weil wir wissen, dass es mal anders war. Der Weg war kürzer, vorher kamen wir schneller zum Ziel. Das vermissen wir. Wir wollen es gerne wieder anders haben.
Und die meisten haben - ähnlich wie die Umfahrer der offiziellen Umleitungsstrecke - eigenmächtig kürzere Wege zum Ziel gesucht. Doch aus eigener Kraft stoßen wir Menschen immer an Grenzen. Egal wie sehr wir uns auch anstrengen, wir werden trotzdem in Situationen kommen, in denen wir andere verletzen oder selsbt verletzt werden. In denen wir nicht mehr weiterwissen. Wir rennen gegen eine Wand an.
Was uns wirklich hält
Und genau hierein spricht Jesus in Johannes 4,16. Er behauptet von sich selbst: "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich."
Die Wahrheit ist also kein Gedanke, sondem eine Person. Jesus macht Wahrheit damit zu mehr als einer Verhandlungssache.
Jesus gibt uns den Halt, nach dem wir verzweifelt suchen. Er ist die fehlende Dimension, die wir so schmerzlich vermissen. Er will unser innerer Kompass sein, die Konstante in all unseren Fragen und Entscheidungen. Er lässt uns nicht allein, sondern er will sich mit uns freuen und an unserer Seite die Kämpfe unseres Lebens mitkämpfen. Das habe ich erlebt. Wenn ich mich an ihn halte, verändert er mein Denken und Verhalten - und damit auf direktem Weg die Welt. Das, was ich tun muss, ist, zu ihm zu sagen: "Jesus, halt mich fest."
Für mich bedeutet das, dass Jesus nach und nach die Baustellen meines Lebens schließt und mir den direkten Weg zu Freiheit, Wahrheit und Bestimmung freimacht. Und da, wo ich noch Umleitungen fahren soll, da fahre ich sie - ob mit dem Auto, mit dem Kopf oder mit dem Herzen. Ich will dem vertrauen, der mich und das Leben erfunden hat und der die Wahrheiten für mein Leben kennt. An diesen Wahrheiten will ich mich orientieren. Jeden Tag neu. Mich von Gott leiten lassen und Schritte gehen in das Leben, zu dem Gott mich bestimmt hat. Das ist die Kraft der Wahrheit. The power of truth.
Be blessed
Manuel
Bildquelle: https://ift.tt/2ttfEfw
from Blogger https://ift.tt/2ma4MQr via IFTTT
0 notes
Text
18. Eintrag (13.6.)
Wie geht’s uns denn heute? Im Gegensatz zu gestern ist die Schwere heute etwas weniger spürbar. Die Horizontale ist eine Lage, die innerhalb eines Tages nicht zu lange eingenommen werden sollte. In den alten Bauernhäusern in Freilichtmuseen wurde gesessen im Schlaf, wie an den Schlafkammern ersichtlich ist. “Flach liegen” bedeutete krank oder tot sein. Stehe heute bewusst früher auf und stelle mir vor, ich entfalte mich wie die zerknautschten Schmetterlinge, nachdem sie ihrer Puppenhülle entschlüpft sind. Ja, so eine Metarmorphose zu einem Schwärmer, das würde mir gefallen. Womöglich werde ich noch zu einem Psychopathen wie in “Das Schweigen der Lämmer”, aber dazu bedarf es einer gewissen körperlichen Fitness. So einen innere Verwandlung findet ja auch tatsächlich in mir statt, ich fürchte aber, das Ergebnis ist keine der Mutationen, die einen Selektionsvorteil mit sich brächte. Mit der körperlichen Fitness ist es nicht weit her. Aber immerhin, ich betreibe mit C. etwas Yoga, kommentiere das zwar ausgiebig (”Scheiße!, “Das geht jetzt nicht! ...), ziehe das Programm aber durch, wenn auch in einer eigenwilligen Interpretation. Danach versuche es sogar mal wieder mit McFit. Krafttraining mit kleinen Gewichten ist möglich, beim Ausdauertraining wird’s aber schwierig. Stelle den Widerstand immer kleiner ein, aber ein dauerhaft erhöhter Puls fühlt sich nicht richtig an, das Pochen wird mir unheimlich. Nach dem Duschen habe ich ein unwiderstehliches Verlangen, mich hinzulegen, doch ich widerstehe und gehe mit M. einkaufen. Merke beim Wandeln durch die Hallen des Konsums, daß Essen ein immer komplizierteres Thema zu werden scheint, eine wahrlich neue Erfahrung. Früher gab es im Grunde nichts, was ich nicht gerne essen würde. Ich gehe zu den Stätten früherer Appetitanregung (Räucherfisch, Käse...), aber kein Speichelfluss will aufkommen, höchstens als Zeichen von Übelkeit. Dabei habe ich heute noch gar nichts gegessen. Das Zusammensein mit M. macht mir aber Freude. Ich habe rechtzeitig einen Sohn in die Welt gesetzt, der sich prächtig entwickelt hat und das Schleppen der Wasserkisten übernimmt. Ich habe immer wieder das Bedürfnis, ihn zu umarmen (er sagt, es wäre ihm nicht peinlich), er fühlt sich einfach zu gut an. Nicht mehr so wie früher, aber für mich jetzt besser, so fest, kräftig und gesund. Die Lebensgeister, in Form von Appetitengeln, kommen dann doch noch. Die Türken wandeln zwar politisch zur Zeit auf Irrwegen, vom Essen verstehen sie aber was. Habe Lust auf Auberginencreme, Oliven, eingelegte Artischocken, Fladenbrot und dergleichen. Meine Mutter sagte immer, ich sei ein Esser, das hat wahrscheinlich ein tiefes physiologisches Fundament.
Stelle mir zwischendurch vor, die ganze Geschichte wäre eine Nummer aus “Verstehen Sie Spaß?” mit versteckter Kamera. Brillant in der schauspielerischen Umsetzung und sehr lang ausgedehnt. Vielleicht wie in der “Truman-Show” als dauerhafte Sendung angelegt ohne finale Aufklärung. Alle wissen Bescheid, nur ich nicht. Das ist so perfekt inszeniert, daß mein Körper gar nicht anders kann, als die Beschwerden psychosomatisch zu ergänzen. Wenn ich darüber nachdenke, die CT-Bilder habe ich nie gesehen und auf dem Ultraschall hätten sie mir auch Luftblasen oder so für Metastasen verkaufen können. Diese Schlingel haben mir da aber einen schönen Streich gespielt, von mir aus kann das jetzt aufgelöst werden. Interessante Frage: Was wäre dann anders? Würde ich wieder zur Tagesordnung übergehen und nahtlos in mein altes Leben eintauchen? Womöglich würde sich wirklich nicht viel ändern. Was wichtig war und jetzt wichtig ist, wird auch weiterhin wichtig sein, ein platonischer Gedanke. Was schön war (Musik, Freundschaft, Reisen, Essen ...), wird ... Wahrscheinlich würde die Dringlichkeit des Wichtigen und Schönen präsenter und “drückender” sein. Das Bedürfnis, die Zeit dichter zu gestalten, wäre stärker, aber wie nachhaltig? und was heißt das überhaupt? Ich glaube, Strawinsky hat mal gesagt, daß Musik die beste Art sei, eine Dauer zu gestalten bzw. zu erleben. Irgendwo muss das Bewusstsein ja hin, irgendwas muss man immer “machen”, sofern wir uns nicht ganz einer vollständigen Instinktsteuerung oder eines durchgetakteten Automatismus hingeben können. Ich glaube, unsere Katze z.B. macht sich keinen Stress mit der Frage, wie sie ihre Zeit verbringen soll. Musik ist sicher ein heißer Anwärter, wenn es darum geht, wie Zeit in der höchsten Intensität gebunden werden kann. Nachdenken, Meditieren, reden, lesen, schauen, essen, kochen, Gartenarbeit, “game of thrones” gucken, shoppen und was weiß ich sind andere Konkurrenten. Das Konzentrierteste, was man machen kann, ist aber ohne Frage Sex. Nicht, daß ich jetzt ein Mr. Bombastic wäre und auch auf die Gefahr hin, daß es jetzt irgendwie schmierig wird, aber sexuelle Aktivität ist an Effizienz wohl nicht zu überbieten. Da muß man gar nicht Psychoanalyse oder Evolutionsbiologie heranziehen, nach denen Sexualität allem Streben letztlich zugrunde liegt bzw. diese die Antriebskraft der Entwicklung alles Lebendigen ist. Dieser besondere Augenblick, den die meisten gerne und oft anstreben, bringt eine Möglichkeit mit sich, sich zu entgrenzen, seinem “lästigem” Ich zu entkommen und für einen Moment eine Verbindung zu etwas Überpersönlichem, Zeitlosem herzustellen. Das befreit wie sonst vielleicht nur der Tod, nur nicht so dauerhaft. Das ist vielleicht eine peinliche Männerfantasie, aber ich muss das noch loswerden: Ich stelle mir manchmal vor, mich in einem finalem Höhepunkt vollständig zu ergießen und das Konzentrat meiner selbst mit dem unendlichem Ozean zu vereinen, so daß “Ich” nur noch in einer verschwindend kleinen homöopathischen Dosis in der Welt vorhanden wäre bzw. so radikal verdünnt, daß es einer völligen Auflösung gleichkommt.
0 notes
Text
Robinson und das gesellschaftliche Bedürfnis
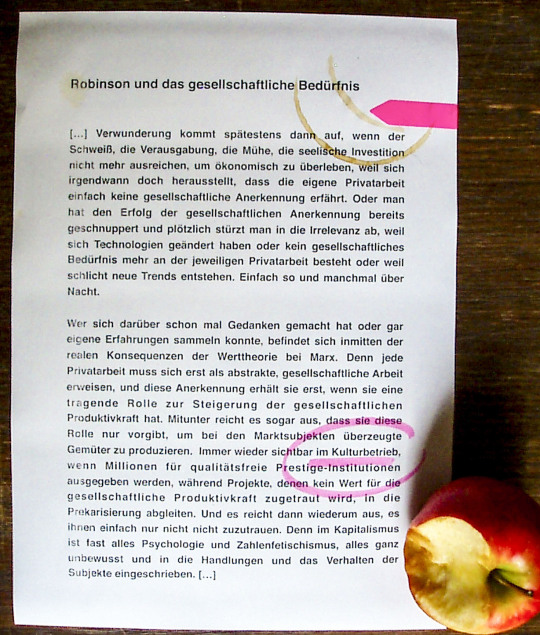
Es ist einsam geworden.
Zumindest für Marx und die, die ihn für heute noch für bedeutend halten. Außer flüchtigen Lippenbekenntnissen oder dem üblich wiederkehrenden und kurzfristigen Hype um ihn gibt es außerhalb der einschlägigen akademischen Szene kaum Zuspruch für eine zeitgenössische Lesart seiner Theorie.
Denn seine Kritik der politischen Ökonomie und ihrer methodischen Nutzung der Robinsonaden des 18. Jahrhunderts zur Analyse von Arbeit und Gesellschaft aus den Triebfedern jedes einzelnen Individuums scheint es heute schwerer zu haben denn je.
Die Annahme der klassischen ökonomischen Theorien, dass ein einzelner Produzent zur Befriedigung eines gesellschaftlichen Bedürfnisses jederzeit auf der Platform der Zirkulationssphäre auftreten könne, und alle heißen einen begierig willkommen, spiegelt auf den ersten Blick tatsächlich das wider, was wir tagtäglich beobachten können und was auch irgendwie zu funktionieren scheint. Schließlich zeigen uns zahlreiche Beispiele, dass es niemals einfacher war, mit der Behauptung und Bereitstellung eines neuartigen Bedürfnisses, Begehrlichkeiten zu wecken, die das eigene Produkt oder eine Dienstleistung jederzeit zum Kassenschlager machen können.
Und nicht nur das.
Kaum eine Zeit hat uns deutlicher vorgeführt, wie schnell es sich mit oder wahlweise auch ohne Talent, dafür aber mit ordentlicher Penetranz zum Matador der lokalen Kulturszene oder gar zum Star der gesamten Republik aufsteigen lässt.
Die grundsätzliche Änderung gesellschaftlicher Arbeit in westlichen Industrieländern von der rationalisierten Fabrikarbeit hin zu innovativeren Formen innerhalb der Kreativwirtschaft scheint somit auf den ersten Blick dem klassischen Liberalismus völlig entgegenzukommen und Marx dagegen auf eine Theorie der industriellen Arbeit des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, resp. auf eine Theorie zum Verstehen gesellschaftlicher und politischer Konsequenzen in industrialisierten und verelendeten Schwellenländern zu reduzieren, in welche wir die hässlichen Seiten des Kapitalismus längst ausgelagert haben.
Deshalb scheint die Frage angebracht, wie das nun ist mit all den Robinsons: den Selfmade–People, den Gründern, Szenegastronomen und Clubbesitzern, den Handwerkskünstlern, Designern und Kreativen und all denen, die in Großstädten wie Pilze aus dem Boden sprießen, und auf die sich der zeitgenössische Konsument regelrecht stürzt, um ihnen ihre Waren aus den Händen zu reißen. Sind sie die wirklich wahr gewordenen Erfolgsversprechen klassischer Ökonomietheorien und hat sich Marx doch mit seiner Kritik am destruktiven Potential moderner Arbeits- und Produktionsverhältnisse erledigt?
* * *
Die Einsamkeit um Marx gründet in seiner Werttheorie, welche, grandios missverstanden, das Los alles Missverstandenen teilt: Es hat sich eine Meinung über sie verfestigt und die aus den Köpfen rauszubekommen, ist schwierig. Und so denken alle Angepassten, Erfolgsverwöhnten und die, die mit sich im Reinen sind, dass Marx in eine andere Zeit gehört oder zumindest in eine Welt, die uns nicht mehr betrifft. Schließlich hat uns der Kapitalismus längst von seinen angenehmen Seiten überzeugt. Seine Unzulänglichkeiten lassen sich jederzeit hinfortkonsumieren. Kaufglück lässt uns alles vergessen. Es belohnt, entschädigt, zerstreut und berauscht. Unangenehmes wird plötzlich irrelevant. Und wenn es uns doch einmal unwohl wird beim Anblick unseres eigenen Wohlbefindens, dann leisten wir uns einfach Fairtrade-Produkte, und schon ist alles bereinigt. Unsere Einstellung zum Kapitalismus hat viel mit unserem persönlichen Wohlgefühl zu tun. Fühlen wir uns wohl, dann gibt es zumeist auch keinen Grund für Kritik.
Kommen wir allerdings doch mal in Verlegenheit, Stellung zu beziehen, um unser Bekenntnis zu untermauern, doch irgendwie auf der richtigen Seite zu stehen – man will ja schließlich nicht als das gelackte Arschloch gelten, das man ist –, dann sind wir oftmals, ohne es zu merken, inmitten der Marx’schen Theorie. Denn all die Unzulänglichkeiten des Kapitalismus spiegeln das wider, was Marx zwischen seinem Frühwerk, die »Entfremdete Arbeit«, und seinem Spätwerk, dem »Kapital«, längst analysiert hat: die Abstiegsgesellschaft (über die tendenzielle Verarmung durch die abhängige Lohnarbeit im Kapitalismus und aufgrund dessen hohlen Versprechen der vermeintlichen Partizipation an seinen Möglichkeiten), die menschenunwürdigen Hartz-Gesetze (über die Reduktion des Menschen auf seine tierischen Funktionen), das Verderben der Arbeitsverhältnisse (über die entfremdete Arbeit als Interesse- und Beziehungslosigkeit zu dem, womit man im Grunde genommen sein Leben verbringt), die Ausbeutung so genannter Arbeitssklaven (über die Einrichtung einer Reservearmee), die Verselbständigung des Geldes im Finanzsektor (durch die Analyse des Geldes als Ware, die vom Tausch zurückgehalten werden kann, zu Spar- und Spekulationszwecken) oder die prekarisierten Arbeitskraftunternehmer (über den Verkauf der Ware Arbeitskraft und die Möglichkeit ihrer extensiven Nutzung). Selbst das Vokabular Marx’ verbirgt sich in unserem Sprachgebrauch: Aus der Reservearmee wird die Manövriermasse, aus Entfremdung werden die innere Kündigung und Machtlosigkeit gegenüber unserer Arbeitsexistenz; wir fühlen uns beherrscht von Systemen, wir sprechen von Arbeitsarmut und Prekarisierung, wir erfinden den Job des Arbeitskraftunternehmers, wir installieren moderne Tagelöhner und Arbeitssklaven und der Kapitalismus erscheint uns als etwas Natürliches und nicht historisch Entstandenes.
Und vieles davon zeigt wiederum die Werttheorie.
Marx tut uns natürlich nicht den Gefallen, sich über all die Schweinereien moralisch zu empören, sondern zeigt uns vielmehr, wie das System »Kapitalismus« funktioniert, und dass all die Schweinereien einfach dazugehören, um den Betrieb am Laufen zu halten. Darüber erklärt sich dann auch das inhärent destruktive Potential des Kapitalismus, denn die Aufrechterhaltung des Betriebs ist notwendigerweise bedingungslos.
Und so ist die Werttheorie die Grundlage zum differenzierten Verständnis von Arbeit und Produktion in kapitalistischen Gesellschaften. Und dass auch jenseits der Fabriken gearbeitet und produziert wird, scheint eine Binsenweisheit zu sein. Doch genau gesehen liegt darin das Problem, dass die Binse eigentlich gar keine Binse ist. Schließlich wird Marx nach wie vor auf eine Theorie der Fabrikarbeit reduziert, die der zeitgenössischen Geschmeidigkeit nichts mehr entgegenzusetzen habe – so zumindest aus Perspektive derjenigen, die sich mit den Möglichkeiten des Kapitalismus arrangiert haben und dessen destruktive Realität lieber der Verantwortung menschlicher Maßlosigkeit zurechnen.
Verwunderung kommt spätestens dann auf, wenn der Schweiß, die Verausgabung, die Mühe, die seelische Investition nicht mehr ausreichen, um ökonomisch zu überleben, weil sich irgendwann doch herausstellt, dass die eigene Privatarbeit einfach keine gesellschaftliche Anerkennung erfährt. Oder man hat den Erfolg der gesellschaftlichen Anerkennung bereits geschnuppert und plötzlich stürzt man in die Irrelevanz ab, weil sich Technologien geändert haben oder kein gesellschaftliches Bedürfnis mehr an der jeweiligen Privatarbeit besteht oder weil schlicht neue Trends entstehen. Einfach so und manchmal über Nacht.
Wer sich darüber schon mal Gedanken gemacht hat oder gar eigene Erfahrungen sammeln konnte, befindet sich inmitten der realen Konsequenzen der Werttheorie bei Marx. Denn jede Privatarbeit muss sich erst als abstrakte, gesellschaftliche Arbeit erweisen, und diese Anerkennung erhält sie erst, wenn sie eine tragende Rolle zur Steigerung gesellschaftlicher Produktivkraft hat. Mitunter reicht es sogar aus, dass sie diese Rolle nur vorgibt, um bei den Marktsubjekten überzeugte Gemüter zu produzieren. Immer wieder sichtbar im Kulturbetrieb, wenn Millionen für qualitätsfreie Prestige-Institutionen ausgegeben werden, während Projekte, denen kein Wert für die gesellschaftliche Produktivkraft zugetraut wird, in die Prekarisierung abgleiten. Und es reicht dann wiederum aus, es ihnen einfach nur nicht zuzutrauen. Denn im Kapitalismus ist fast alles Psychologie und Zahlenfetischismus, alles ganz unbewusst und in die Handlungen und das Verhalten der Subjekte eingeschrieben.
Nun kann man sagen, gut, dann mach ich eben etwas anderes, wenn das nicht klappt, schließlich ermöglicht mir der Liberalismus all dieses Freiheiten, doch man ist niemals der Robinson, der man zu sein glaubt, denn in jedem Betrieb hängen Arbeitsplätze, die bei gescheiterten Geschäftsideen auf der Strecke bleiben.
Und so ist die Werttheorie nicht einfach nur der Beweis, dass sich Arbeitsmengen in ein Produkt verausgaben, damit Wert stiften und gleichzeitig schon Gesellschaftlichkeit imitieren. Marx präzisiert nicht die Ricardo’sche Vorlage, wie viele ihm unterstellen.
Die Voraussetzung für Gesellschaftlichkeit ist zuallererst, dass die Verausgabung als gesellschaftlich notwendig anerkannt ist und nicht einfach nur ein gut gemeintes Vorhaben, das letztlich kein Schwein interessiert. Und dass diese gesellschaftliche Notwendigkeit eine riesige Hürde ist, nicht einfach nur eine strategische Entscheidung, sich mit einer Geschäftsidee in der Produktions- oder Zirkulationssphäre zu verabreden und alle heißen sich gegenseitig willkommen – wie es die politische Ökonomie zu meinen glaubt –, sondern eine Hürde von zahlreichen und schmerzhaften Störungen, all das zeigt die Werttheorie bei Marx.
Über seine Kritik an der politischen Ökonomie leistet Marx somit nicht nur die Analyse der Funktion des Kapitalismus und seiner Möglichkeiten, sondern zeigt – in Abgrenzung zur politischen Ökonomie – dessen grundsätzlichen Widersprüche sowie seine inhärenten und notwendigen Störungen. Störungen, die all das eben genannte verursachen.
Dagegen versuchen die klassischen ökonomischen Theorien, die bis heute nicht nur theoretischen Eingang in die Wirtschaftswissenschaften haben, sondern auch das Unterbewusstsein der Marktsubjekte besiedeln, den Kapitalismus in x-ter Gedanken–Generation gegen jegliche Realität als harmonisches, störungsfreies und rationales Zusammenspiel zwischen Bedürfnisbefriedigung, Nutzen und objektivem Reichtum für die Gesellschaft, Profit für den Geldbesitzer sowie adäquate Bezahlung für den Arbeitsaufwand des einzelnen Arbeiters darzustellen. Die realen Disharmonien, die Phänomene von Verelendung, die implizit notwendige und legitimierte Ausbeutung des Arbeiters sowie die regelmäßigen Krisen sind in klassischen ökonomischen Theorien, wie beispielsweise bei Adam Smith oder David Ricardo nicht enthalten.
Die Widersprüche des Kapitalismus bewegen sich bei Marx demnach zwischen der Ermöglichung eines objektiven gesellschaftlichen Reichtums und der realen Verarmung eines Großteils der Gesellschaft, zwischen der Behauptung, dass vertragliche Arbeit die Quelle von Reichtum für alle sei und deren reale Kehrseite der Lohn- und Wertarbeit, die Ausbeutung (als nicht-moralische Kategorie) über die unbezahlte Abschöpfung der Mehrarbeit legitimiert, und darüber hinaus auch noch den systemimmanenten Zwang produziert, sich an der allgemeinen Reichtumsproduktion über Arbeit zu beteiligen.
Tatsächlich – so Marx – bringt der Kapitalismus alle Selbstverständnisse der politischen Ökonomie, die ewigen Zusammenhänge und Naturannahmen zum Wanken, worüber erst seine implizite Krisenhaftigkeit verstanden werden kann: Kauf und Verkauf, Bedürfnis und Produktion, Gebrauchswert und Wert, Ware und Geld sowie Produktion und Zirkulation fallen vielmehr auseinander und verselbständigen sich jeweils.
Erstmals wird es historisch möglich, lediglich bedürfnissuggerierenden über bedürfnisunabhängigen, bis hin zu völlig funktionslosem Waren–Müll zu produzieren (nutzlose Staubfänger, unsinnige Geschenkartikel, Kartoffelsalat aus der Tube, schwedische Regale ohne Belastbarkeit), die Produktion nur um ihrer selbst willen aufrechtzuerhalten (VW produziert dann Curry-Würste statt Autos), den Arbeiter produktionsnotwendig über die Einrichtung einer menschlichen Manövriermasse verarmen zu lassen, und das Geld verselbstständigt sich zu einer eigenen Ware, die vom Tausch zurückgehalten werden kann, im Sparstrumpf oder zu Spekulationszwecken.
Störungen kommen – so Ingo Elbe – in klassischen ökonomischen Theorien nur als externe Zutat ins Spiel: entweder über den Staat, der in unnötiger Weise eingreift, oder durch einzelne Individuen, die über das rechte Maß hinaus Ansprüche stellen, (siehe Ingo Elbe: 2001). Insofern ist die typische und wenig originelle Kritik am »raffgierigen« Banker eine durch und durch bourgeoise Kapitalismuskritik.
Versteht man die Werttheorie von Marx somit lediglich als Weiterführung der klassischen Arbeitswerttheorie von David Ricardo, einer simplen Arbeitsmengentheorie, die den Wert einer Ware nach ihrer darin verausgabten Arbeitsmenge bemisst (die Menge der Verausgabung zur Herstellung eines Produktes), und lässt man sie darüber aus heutiger Sicht scheitern, so kann man nicht erklären, wie auch andere gesellschaftliche Arbeit, die keine dinglichen Fabrikwaren produziert, aber trotzdem aus kapitalistischer Sicht höchst produktiv ist, in die gesellschaftliche Gesamtproduktion eingeht. Alle immaterielle Arbeit, in der sich Verausgabungsmengen nicht eindeutig zuordnen lassen, wäre dann auf einen Schlag irrelevant, weshalb nicht zuletzt auch Negri/Hardt die Werttheorie Marx’ daran scheitern ließen, dass immaterielle Arbeit immer wichtiger ist innerhalb der kapitalistischen Gesamtproduktion (siehe dazu auch Philipp Metzger). Implizit geht man damit von der Annahme aus, dass der Kapitalismus bereinigt sei. Schäbig ist er nur noch in den Fabriken der Schwellenländer oder dann, wenn seine Akteure über die Stränge schlagen.
Nach dieser Vorstellung darf sich der zeitgenössische Networker lässig zurücklehnen. Sein Arsenal aus Laptop und Smartphone, hergestellt in asiatischen Fabriken zu Centlöhnen, kann er in chicen Cafés einsetzen, während er seine Biolimonade schlürft und mit »like« und »tweet« die immer richtigen Bekenntnisse zu einem vermeintlich neuen Kapitalismus bekundet. All seine Handlungen sind dann umgehend bereinigt: »Alles super, wenn man’s nur richtig macht.« Explizit unterstellt man Marx damit die Übernahme des Substanzbegriffes aus der politischen Ökonomie, der Verausgabungsgrößen als messbar und Wert als materiell Greifbares versteht oder als etwas, das sich nach dem Einsatz entsprechender Mühe ernten lasse: »Schaff was, dann wird was aus dir!« oder noch einfacher: »Gold ist wertvoll, weil’s glänzt. Und krisenfest ist es noch dazu.« Jede produzierende Arbeit schaffe darüber hinaus unmittelbar Wert.
Immaterielle Arbeit dagegen sei emanzipatorisch, auch deshalb, weil sie sich über ihre kommunikative Form des Austausches mit anderen immateriellen Arbeitern und Arbeiterinnen der im Kapitalismus zählenden Messbarkeit von Arbeitsentäußerungen entziehe. Es geht jetzt – so die Vorstellung – herrschaftsfreier, gleichberechtigter und diskursorientierter zu; eine Vorstellung, die die Postoperaisten auch zur Annahme geführt hat, dass in Technologien, wie der weltweiten Vernetzung, schon Formen eines potentiellen Kommunismus enthalten seien; die Entstehung einer Multitude und deren Schaffung eines General Intellects, unter Berufung auf Marx’ »allgemeines gesellschaftliches Wissen« (MEW 42, 602), seien die maßgeblichen Anzeichen dafür (siehe dazu auch Philipp Metzger). Aus heutiger Sicht eine naive Vorstellung, nachdem man weiß, dass das Internet und seine Vernetzungsdienste längst zum weltweiten Stammtisch verkommen sind, den die Gegner von Emanzipation und Aufklärung besser zu nutzen wissen, als uns lieb sein kann. Nicht zuletzt auch in der Informationskriegsführung durch so genannte Bots und Fake-News. Und eine wirklich absurde Interpretation der Werttheorie noch dazu, denn sie zeigt, welche Arbeitsformen damit analytisch irrelevant seien: Der komplette Dienstleistungssektor, das Gesundheitswesen sowie sämtliche Kopfarbeit, die die Grundlage für technologische Neuerungen und Entwicklungen und den Fortschritt von Gesellschaften bildet, fallen somit aus der Wertanalyse heraus. Auch der Banken- und Finanzsektor und dessen Potential zur Krise spiele dann keine Rolle. Und man stelle sich zudem vor, welche konkreten Arbeiten ebenfalls immateriell sind und damit wiederum emanzipatorisch seien: Sexarbeit, Hausarbeit, Pflegearbeit oder alle Formen von Dienstleistung.
Genauso wenig ließe sich damit die grundlegende Änderung gesellschaftlicher Arbeit analysieren, nämlich die durch die Agenda 2010 eingeführte prekäre Selbstständigkeit über die Erfindung so genannter »Arbeitskraftunternehmer«. Diese Änderung hat aber erst dazu geführt, dass eine neue Form von Arbeitsarmut entstand; die eigenverantwortliche Armut, die lediglich die Arbeitslosenzahlen beschönigen konnte und die Folgen des neoliberalen Kapitalismus für gesellschaftliche Arbeit insgesamt auf das Individuum abwälzte.
Insofern müsse man Marx heutzutage tatsächlich als erledigt ansehen und er spiele nur noch eine Rolle, wenn es um die nach wie vor relevante Fabrikarbeit und deren produktionsinhärente, legitime Ausbeutung (Mehrwertabschöpfung) menschlicher Arbeitskraft geht. Bestenfalls lasse sich seine Theorie noch so anwenden, dass sie in heutige Überlegungen zum Leid tierischer Produktionsarbeit und zur extensiven Nutzung natürlicher Ressourcen einfließen könne.
Lässt man die Marx’sche Werttheorie an der unter Volkswirtschaftlern heute immer noch relevanten Grenznutzentheorie scheitern, so verkenne man die Bedeutung gesellschaftlicher Arbeit insgesamt für die Stabilität von Gesellschaften sowie den realen Zynismus dieser Theorie, die nicht nur Wert und Preis gleichsetzt, sondern auch die Höhe des Preises über den realen Nutzen einer Ware bestimmt.
Die Grenznutzentheorie aus dem 19. Jahrhundert, auch subjektive Werttheorie genannt, bemisst den Nutzen genau jener Waren als besonders hoch und ihren Handel damit als entsprechend gewinnbringend, die von besonders vielen Menschen dringend gebraucht werden. Dabei nimmt der Nutzen kongruent mit der Befriedigung eines Bedürfnisses ab und lässt den Preis ebenfalls kongruent dazu fallen, bis zum völligen Verlust seiner Marktchance, dem Moment, wo der Markt gesättigt ist und die Bereitschaft für ein Produkt zu zahlen gegen Null geht.
Der Zynismus dieser Theorie entsteht durch das, was sie implizit bedeutet, denn die Grenznutzentheorie vertritt nichts anderes als die Perspektive derjenigen, die sich auf ungestillte Bedürfnisse stürzen und im Idealfall diese Bedürfnisse niemals sättigen, denn andernfalls berauben sie sich ja ihrer eigenen Einnahme- und Profitquelle (siehe dazu auch Pfreundschuh). Ein beliebtes Beispiel, das diesen Zynismus aufdeckt, ist das Bedürfnis nach Nahrungsmitteln: Bei besonders großem Hunger und Durst erweisen sich das erste Stück Brot und das erste Glas Wasser als besonders hoher Nutzen, der mit stetigem Stillen von Hunger und Durst abnimmt. Kongruent dazu fällt die Bereitschaft, einen hohen Preis für Brot und Wasser zu bezahlen.
Wie bei allem positivistischen Theoriemüll lesen sich die wirklichen Schweinereien erst zwischen den Zeilen, denn das Interesse derer, die über Brot und Wasser verfügen, kann ja nur darin bestehen, Hunger und Durst konstant hoch zu halten oder zumindest dafür zu sorgen, dass Hungernde und Dürstende niemals ausgehen.
Als Nachfolgerin der einfachen Nutzentheorie ignoriert sie den von Adam Smith aufgedeckten Widerspruch ihrer Vorgängerin, dass eine Ware, die von besonders hohem Nutzen ist – beispielsweise Wasser – billiger ist als eine Ware, die von gänzlich geringem Nutzen ist – beispielsweise Diamanten oder Gold –, (siehe Smith: 27) indem sie nicht den Wert eines Produktes, sondern die Zahl der Bedürfenden in die Preisregulierung einrechnet.
Eine Ware wird dann umso teurer, je höher ihr realer Nutzen und je größer die Anzahl derer ist, die Bedürfnisse haben, zu deren Befriedigung sich diese Ware als besonders nützlich erweist. Der Preis dafür kann jetzt ins Unermeßliche steigen, denn er bemisst sich nicht mehr über die darin verausgabte gesellschaftlich notwendige Arbeit (wie in der Arbeitswerttheorie), sondern kann vom Produzenten oder Warenbesitzer nach Gutdünken festgelegt werden. Das Ausmaß dieses Gutdünkens regelt allein die Dringlichkeit zur Befriedigung dieses Bedürfnisses und das Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Je höher die Nachfrage, desto höher der Nutzen, desto höher sein Preis.
Theoretisch geht aber noch mehr. Wenn der Nutzen einer Ware bis aufs Letzte, bis zu seiner Grenze erschöpft ist, ist ein Bedürfnis gestillt und der Markt gesättigt. Jetzt zeigt sich die gedankliche Verselbständigung dieser Theorie erst recht, denn um nun weiteren Profit zu machen, muss zwangsläufig zum nächsten Desiderat einer Gesellschaft oder auf dem Markt weitergegangen werden, weshalb diese Theorie sich implizit auch nicht weiter darum zu kümmern hat, was nach dem Erschöpfen eines Nutzens mit der jeweiligen Ware, ihrer Produktion oder der Spekulation mit ihr passiert. Es bedarf also rein gar keiner Produktionsethik mehr; vielmehr lassen sich die Trümmer des ausgeschöpften Nutzens jederzeit problemlos hinterlassen, was sich anschaulich an spekulationsbedingten Hungersnöten, zerstörten Binnenmärkten und Volkswirtschaften, etc. feststellen lässt.
Irgendjemand kommt dann schon, um aufzuräumen – oder auch nicht.
Der Zynismus ergibt sich aber auch dadurch, dass die Befriedigung von Bedürfnissen, wie Wohnraum in Großstädten oder Lebensmittel in Gesellschaften mit großer Verknappung, von besonders hohem Nutzen ist und insofern die Preise kongruent dazu – bis ins Absurde – steigen können. Aber auch der Begriff des Bedürfnisses selbst erhält hier eine zynische Umkehr, denn tatsächlich geht es gar nicht um eine Bedürfnisbefriedigung, sondern um das Ausnutzen eines gesellschaftlichen Elementarbedürfnisses, das nutzennützlich aufrechterhalten wird. Je mehr Menschen etwas bedürfen, umso nützlicher die Ware zur Befriedigung des Bedürfnisses, umso höher ihr Preis.
In unserem oben genannten Beispiel aus der Befriedigung von Hunger und Durst ist – so die reale Konsequenz aus dieser Theorie – nur für eine hungernde und dürstende Gesellschaft der Nutzen der Waren Brot und Wasser als besonders hoch zu bewerten, womit der subjektive Preis dafür vom Verkäufer dieser Waren entsprechend hoch bemessen werden kann. Eine Gesellschaft wiederum, in der Überproduktion herrscht, darf sich über günstige Fleischlappen, Butterberge und Milchbäder freuen. Die Leidtragenden dagegen sind die Arbeiter und Nutztiere; denn bei zunehmender Sättigung fallen nicht nur die Preise, sondern im Normalfall auch die Bereitschaft zur Investition in beispielsweise verbesserte Produktionsbedingungen. Hat jeder erst mal seinen Fleischlappen auf dem Mittagstisch, kann das Schwein getrost im Stall verrecken und die Leiharbeiter noch mehr in die legitime Arbeitssklaverei gedrängt werden. Wen interessieren schon Arbeitsverhältnisse, wen interessiert schon Tierschutz? Mietwucher, Lebensmittelpreis–Spekulationen und die Privatisierung von Wasser – anything goes, da daraus besonders viel Gewinn für den einzelnen Warenbesitzer gezogen werden kann. Die Grenznutzentheorie wird so zur theoretischen Legitimation der realen Perversion des neoliberalen Kapitalismus und seiner schier absurden Möglichkeiten (siehe Pfreundschuh). Sie versteht sich nicht als Theorie kapitalistischer Produktion und Zirkulation und deren selbstbehaupteten Anspruchs eines Gesamtnutzens für die Gesellschaft, sondern rechtfertigt lediglich das Interesse des einzelnen Geldbesitzers. Sie wendet sich gegen die Arbeitswerttheorie, indem sie rechtfertigen kann, warum Preise von besonders nützlichen Waren geradezu übertrieben über ihren eigentlichen Produktionskosten liegen können.
Und nicht nur das. Für ihre eigene Theoriebildung braucht sie weder gesellschaftliche Arbeit und ihre Bedeutung für den Menschen noch einen Begriff von Gesellschaft überhaupt, und sie zeigt damit einmal mehr, worum es hier überhaupt geht, nämlich einzig und allein um die neoliberale Rechtfertigung des willkürlichen Umgangs mit gesellschaftlicher Arbeit, dem einzelnen Arbeiter, seiner Bezahlung, seiner Kündigung sowie die willkürliche Definition von produktionsimmanent notwendiger oder nicht-notwendiger Arbeit.
Der Umgang mit Arbeit entlarvt sich in diesem Modell aber auch anderweitig: Denn auch die Investitionen in Bildung werden hier direkt ökonomisch bewertet (siehe dazu auch Gess: 2005). Der gesamte Bologna–Prozess und die Bachelorisierung des Universitätsstudiums fügen sich reibungslos in dieses Modell ein: Sie hinterlassen den zugerichteten, affirmativen Uniabsolventen, der fleißig Klassifikationen auswendig gelernt hat und darin gedanklich und intellektuell steckenbleibt. Damit trägt er genau die kritik- und störungsfreie Arbeitnehmermaske, die sich ein Neoliberaler nur wünschen kann.
Beide Theorien können somit mit der Marx’schen Werttheorie im Folgenden kritisiert werden, indem nochmals klargestellt wird, dass der Wert bei Marx ein gesellschaftliches Verhältnis beschreibt, das darüber entscheidet, ob und warum eine Privatarbeit überhaupt erst zu gesellschaftlicher Arbeit wird und warum der Kapitalismus reihenweise gegen seine eigenen Versprechen verstößt. Und vor allem, wie es in den Köpfen der Marktsubjekte zugeht, ohne, dass sie es selbst durchschauen.
Die Marx’sche Werttheorie – und das ist alles entscheidend – ist keine Arbeitswert- oder Arbeitsmengentheorie. Ebenfalls ist Marx kein Ökonom, sondern ein Kritiker klassischer Ökonomietheorien, der die Funktion des Kapitalismus und dessen zwangsläufige Grenzen zu analysieren versucht (siehe Heinrich 2005: 31; sowie 2001). Die Marx’sche Werttheorie ist ein Modell der analytischen Gesellschafts- und Kapitalismuskritik, indem sie zeigen kann, dass die kapitalistische Produktion eine Reihe von Verselbständigungen entfesselt, die dem rationalen Handlungsrahmen der Subjekte zwangsläufig entgleiten; sie tilgt alle natürlichen Beziehungen, die in der klassischen politischen Ökonomie vorausgesetzt werden; darüber hinaus erklärt sie erstmals überhaupt, was gesellschaftliche Arbeit ist, und zwar sowohl aus kapitalistischer als auch aus post-kapitalistischer Sicht, indem sie zeigt, dass diese über das schlichte Produktionsverhältnis zwischen Arbeiter und Geldbesitzer und dem Zirkulationsverhältnis zwischen verschiedenen Privatarbeiten weit hinausgeht.
Entscheidend ist darüber hinaus, dass der Kapitalismus nicht als moralisches Versagen kritisiert wird, sondern seine inhärenten Widersprüchen aufgezeigt und verstanden werden sollen, eine Produktionsweise, die nach heutiger Sicht endlich ist, denn die Möglichkeiten und Ressourcen sind zwangsläufig irgendwann erschöpft. Marx selbst spricht im »Kapital« nicht von einer produktionsimmanenten Selbstzerstörung des Kapitalismus, da ihm dazu das politisierte Proletariat als historisches Subjekt methodisch und – zumindest zu seiner Zeit – auch real zu Hilfe kommt. Bekanntlich hat es dieses nur bis zum Sozialismus als reale Kopie des Kapitalismus geschafft hat, mit dem Unterschied, dass jetzt die Bestimmung des Arbeiters auf alle ausgedehnt ist, wie Marx selbst kritisch einwendet (MEW 40: 534). Sein geschichtsphilosophisches Konzept der freien Gesellschaft, in der ausschließlich bedürfnisbefriedigende Produktion stattfindet, das, was Marx als »Kommunismus« bezeichnet, hat mit dem realen Kommunismus – nur so am Rande – nicht das Geringste zu tun. Insofern wurde Marx von verschiedenen Produktions- und Gesellschaftsentwürfen eindeutig missbraucht und instrumentalisiert und mitnichten verstanden. All das kann hier aber nicht weiter verfolgt werden.
Auf das Proletariat ist ja bekanntlich kein Verlass mehr, wenn es um den Übergang in die freie Gesellschaft geht. Dieses hat sich längst als Bestandteil der AFD–Wählerschaft enttarnt, um sein eigenes Elend auf Geflüchtete zu projizieren oder es mischt sich unter die neuerdings beliebten Querfronten, die Kapitalismus mit dem Einfluss irgendwelcher »raffender« und nicht-greifbarer Finanzgruppen gleichzusetzen versucht – dem Ursprung der typisch antisemitischen Kapitalismuskritik.
Über die Analyse und Kritik der klassischen Werttheorie kann Marx nun zeigen, dass die freie Vertragsarbeit tatsächlich nur als Verkauf ihres Gebrauchswertes, als Verkauf der Ware Arbeitskraft, das Prinzip des objektiven Reichtums moderner Gesellschaften ist und damit als grundlegender Stabilisator unmittelbar ausscheidet, da realiter mit ihr Armut und Verelendung erzeugt werden. Scheitert jedoch die freie Vertragsarbeit an ihren eigenen Prinzipien, ihren Versprechen, auch dem einzelnen Arbeiter die Teilhabe am gesamtgesellschaftlichen Reichtum und seinen Möglichkeiten zu öffnen (Bildung, politische Teilhabe, individuelle und politische Freiheit, Selbstverwirklichung), dann scheitert die Gesellschaft als Ganzes. Genau das aber ist es, was wird derzeit über die so genannte »Abstiegsgesellschaft« erleben. Insofern ist Marx einer der zeitgenössischsten Theoretiker, der uns heute mehr denn je zeigen kann, wohin eine Gesellschaft abdriften kann, die die Prinzipien ihrer eigenen Produktion nicht versteht.
Im Folgenden werden wir nun sehen, dass die Marx’sche Werttheorie die klassische Arbeitswerttheorie tilgt, denn diese scheitert insgesamt an ihrem Verständnis von gesellschaftlicher Arbeit. Arbeit ist hier allein gesellschaftlich, weil sie Wert stiftet. Es genügt die nötige Verausgabungsmenge zur Produktion einer Ware, um ihren Wert zu bestimmen. Arbeit wird damit selbst unmittelbar wertgebend, ohne die entscheidende Vorbedingung, dass sie erst einmal gesellschaftlich anerkannt sein muss. Denn wie soll es jetzt zur kapitalistischen Realität kommen, dass es auch produktionsinhärent nicht-notwendige Arbeit gibt? Wie wird Privatarbeit überhaupt gesellschaftlich? Und wie kann erklärt werden, warum eine gesellschaftliche Arbeit urplötzlich wieder in die Privatarbeit abstürzen kann? Darüber hinaus regelt sich in der Arbeitswerttheorie die Produktion über Angebot und Nachfrage zur Befriedigung gesellschaftlicher Bedürfnisse. Es bleibt jedoch unklar, wie Bedürfnisse überhaupt entstehen und vor allem, wie und warum sie wieder verschwinden. Die Arbeitswerttheorie verkennt darüber hinaus die Bedeutung des Unterschiedes zwischen Arbeit und Arbeitskraft und kann deshalb ebenso wenig verstehen, warum der Arbeiter trotz Arbeit verarmt. Nicht allein ein niedriger Lohn – wie politische Ökonomen bereits warnen – sondern erst der extensive und effiziente Gebrauch seiner Arbeitskraft lässt den empörten und sich politisierenden Arbeiter entstehen. Denn jetzt erst passiert Entscheidendes: Die notwendige Steigerung der Produktivkräfte wirkt unmittelbar auf die Arbeitskraft selbst ein. Ihre Brauchbarkeit kongruiert mit der realen Qualität des Selbsterhalts der Produktion, die mal einfach so, mal von Krisen gebeutelt, mal einfach nur die Krise als Vorstellung im Kopf habend (denn im Kapitalismus ist fast alles Psychologie), Arbeit bedarfsabhängig abrufbar macht. Sie wird nun austauschbar durch die Errichtung einer Reservearmee, auf die der Arbeitgeber nach Bedarf zurückgreifen kann, und die wiederum allein durch ihre Existenz auf die Verschärfung der Arbeitsverhältnisse einwirkt. Es geht hier also nicht nur ums Geld, um eine vermeintlich gerechte Bezahlung – der typische Lösungsansatz einer Sozialdemokratie –, es geht darum, dass der Kapitalismus ein durch und durch menschenverachtendes System ist. Und dieses System verachtet ebenso die Tiere und die Umwelt.
Darüber hinaus fehlt in der Arbeitsmengentheorie die Analyse der Geldform als sich verselbständigende Ware. Geld ist hier einfach eine externe Zutat, ein Zahlungsmittel. Wie aber kann sich Geld verselbständigen und dadurch Krisen auslösen? Empörte oder sich politisierende Arbeiter sowie sich verselbständigendes Geld sind aber die bedeutenden Störungen im Kapitalismus, deren Entstehung erstmals Marx analysiert.
Die Marx’sche Werttheorie tilgt aus heutiger Sicht die Grenznutzentheorie (subjektive Werttheorie), da diese einen völlig depravierten Begriff von Arbeit und Gesellschaft hat (Marx selbst hat sich mit dieser Theorie nicht befasst. Sie soll deshalb nur mithilfe seiner Analyse kritisiert werden). Sie setzt Wert und Preis über die Existenz besonders dringender Bedürfnisse gleich und zieht damit ihren Profit aus der realen Verknappung zur Steigerung eines gesellschaftlichen Bedürfnisses. Sie zeigt, was realiter passiert, wenn Geld als externe Größe nur zum Zwecke der Spekulation und somit investitionshemmend eingesetzt wird, ein Umstand, den Marx bereits über die Kritik der krisenfreien Arbeitsmengentheorie aufgezeigt hat: Erst »[d]urch das Auseinanderfallen des Produktionsprozesses (unmittelbaren) und Zirkulationsprozesses ist wieder und weiter entwickelt die Möglichkeit der Krise, die sich bei der bloßen Metamorphose der Ware (Verkauf und Kauf) zeigte. Sobald sie nicht flüssig ineinander übergehen, sondern sich gegenseitig verselbständigen, ist die Krise da« (MEW 26.2, 508). Das beweist aber auch, dass die Zirkulation und Spekulation im Finanzsektor mit der Produktionssphäre notwendiger Weise verwoben sind; wie sonst auch sollten Investitionen oder Kredite möglich sein, wenn der Finanzsektor ein völlig unabhängiges System wäre? Ihre Unabhängigkeit ist dagegen ein bis heute währendes Konstrukt, sichtbar auch darin, dass Banken günstige Zinssätze bei der Kreditvergabe nicht an Unternehmen weitergeben, weil sie sich völlig unabhängig von der Produktion wähnen, und mit diesem Selbstverständnis entsprechend viel auch angerichtet haben.
Das Prinzip »gesellschaftliche Arbeit« als Grundlage kapitalistischer Produktion sowie die These, dass der Kapitalismus den Reichtum der Gesellschaft und nicht nur einzelner Geldbesitzer vermehre, aber auch Grundlage gesellschaftlicher Stabilität und Freiheit sei – so der Anspruch klassischer Ökonomietheorien – wird in der Grenznutzentheorie gänzlich getilgt. Sie bedient sich an den Ermöglichungen durch gesellschaftliche Arbeit, lässt sie jedoch in ihrer eigenen Theoriebildung weitestgehend unberücksichtigt. Sie bildet demnach den realen Zynismus der letzten Jahre ab: Die ungebremste Spekulation und den Ruin ganzer Volkswirtschaften als Glanzleistung des Finanz- und Bankensektors, und den Hilferuf nach gesellschaftlicher und politischer Unterstützung, wenn das ganze schief läuft; das Erwarten der Hilfe von genau denjenigen, die am Entstehen des gesellschaftlichen Reichtums mit beteiligt waren. Als Entschuldigung für das eigene Versagen und quasi als Notausgang – so Hans-Peter Büttner – lässt sich mithilfe dieser Theorie der Schaden rückwirkend als zumindest nutzenmaximierend erklären (siehe Büttner: 6)
Aber selbst die Kritik daran bildet mithilfe der Marx’schen Analyse aus heutiger Sicht keine moralische Kategorie, keine Kritik als Empörung, oder die immer wieder mühsame Gegenüberstellung von so genanntem »schaffenden und raffenden Kapital«, sondern zeigt letztlich nur, wozu der Kapitalismus implizit und explizit in der Lage ist. Diese Theorie bildet nichts anders ab, als die realen Möglichkeiten unserer Produktionsverhältnisse. Sie ist nichts anderes als das Buch zum Film.
Die Grenznutzentheorie ist zur Arbeitsmengentheorie vergleichbar ahistorisch. Im Gegensatz zum Rückgriff auf die menschliche Natur und deren Vollendung in der kapitalistischen Gesellschaft, interessiert die Grenznutzentheorie vielmehr ausschließlich der Moment des graduellen Bedürfnisses. Alle gesellschaftlichen Beziehungen sind dagegen getilgt zugunsten einer ökonomischen Entscheidungstheorie des einzelnen Geldbesitzers (siehe dazu Büttner: 4). Mit dem Verstehen von Gesellschaft und gesellschaftlicher Arbeit hat sie somit rein gar nichts zu tun, und sie interessiert uns deshalb im Folgenden nur noch am Rande.
* * *
Um die Bedeutung der Marx’schen Werttheorie für heute zu verstehen, hilft ein Blick zurück zu Marx selbst und seiner Kritik an den Robinsonaden, die sämtliche historischen Entwicklungen unterschlagen und stattdessen natürliche Veranlagungen des Menschen als Grundlage von Arbeit, Tausch und Markt verstehen. Die reibungslose Funktion all dieser Sphären erfolgt unmittelbar im Tauschhandeln und unter der sanften Lenkung einer unsichtbaren Hand (Adam Smith), der Geburt der politischen Ökonomie, welche die persönlichen Interessen des Individuums mit seinen menschlichen Veranlagungen harmonisch zu verschmelzen versucht. Die Verbindung von politischer und ökonomischer Sphäre, von Staat und Individuum, erfolgt über das vermeintlich sanfte Verwalten dieses Prozesses (siehe dazu Foucault: 2006).
Was die Vertragstheorien des 16. bis 18. Jahrhunderts bereits untersuchen, bringt Kants Formulierung der »ungeselligen Geselligkeit« (Kant: 37) beispielhaft auf einen Nenner: Der Mensch kann einfach nicht anders, als sich zu vergesellschaften, wenn er sich vereinzeln und isolieren will (ebd. 38). Und das spezifisch Menschliche liegt gerade in diesem Hang zur Isolation, worin implizit erste Ansätze moderner Selbstverwirklichungstheorien enthalten sind. Möglich ist die selbstgewählte Isolation ausschließlich in einer Gesellschaftsform, die die nötigen Rahmenbedingungen dafür schafft.
Die Eingangsvoraussetzungen für die Vergesellschaftung des Menschen werden in den Vertragstheorien und politischen Ökonomien sehr unterschiedlich bewertet. Denn die Frage, wie die menschliche Natur als Voraussetzung für eine friedliche Gesellschaft zu sehen sei, ob günstig (wie bei Rousseau) oder ungünstig (wie bei Hobbes), und wie man sie beflügelt oder zähmt, bilden das Fundament kontraktualistischer Theorien und deren Überlegung zu einer jeweils entsprechenden Regierungsform als wahlweise starker Staat (bei Hobbes) oder dem Vertrauen in die Demokratie (bei Rousseau).
Die Robinsonaden der politischen Ökonomie unterstellen dagegen zur methodischen Rechtfertigung ihrer eigenen Theorien notwendigerweise günstige – doch letztlich egoistische – menschliche Veranlagungen, die in der ökonomischen Sphäre zum Zwecke eines allgemeinen Nutzens harmonisiert werden, ohne paternalistische Eingriffe des Staates oder einer anderen (beispielsweise ideologischen) Instanz, weil die Menschen erkennen, dass das gemeinsame Interesse ihrer persönlichen Interessenbefriedigung bereits von gesellschaftsstiftender Kraft ist. Durch diese Annahme rechtfertigt man nicht nur die ökonomische Sphäre als grundsätzlich der menschlichen Natur zuträglich; man hält sich damit gleichzeitig den Staat als leidigen Bevormunder vom Hals.
Jeder ist sich selbst der Nächste und muss deshalb irgendwie mit dem anderen auskommen und sich mit ihm arrangieren, damit dieser ihm wiederum nicht in die Quere kommt. Und davon wiederum profitieren alle. So die Weisheit dieser Theorien. Denn »[n]icht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers und Bäckers erwarten wir das, was wir zum Essen brauchen, sondern davon, daß sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Wir wenden uns nicht an ihre Menschen- sondern an ihre Eigenliebe, und wir erwähnen nicht die eigenen Bedürfnisse, sondern sprechen von ihrem Vorteil.« (Smith: 17)
Dass das Ganze nur funktioniert, wenn auch alle die Möglichkeit dazu haben, ihre eigenen Interessen und Vorteile zu verfolgen, und keiner sich dabei zu kurz gekommen fühlt oder gar armutsbedingt oder aufgrund mangelnder Bildung ausgeschlossen ist, liegt auf der Hand, weshalb Hegel einer der ersten ist, der in seiner Rechtsphilosophie von 1820 über die Gefahren der strukturellen und verrohenden Armut in der bürgerlichen Gesellschaft schreibt, nämlich die Entstehung des so genannten »Pöbels« (siehe Hegel: 1986, § 244), der empörten Armen, die keinerlei Zugang mehr zu Arbeit haben, oder trotz Arbeit verarmen. Insofern bilden sie den pejorativen Gegenpol des Marx’schen Proletariats, das stets selbst an der dünnen Grenze zwischen politischem Protest und sozialer Empörung steht, eine Grenze, die man heute zwischen politischer Revolte und Ressentiment ziehen würde.
Doch der Ökonom wäre kein Ökonom, wenn er nicht auch hier argumentativ vorgesorgt hätte, um das Interesse seiner Theorie zu verteidigen. Schließlich kommt ihm seine stärkste Waffe zur Hilfe: die menschliche Natur und ihre »Neigung zum Tausch« (Smith: 17) Und die hat nunmal auch der Bettler – denkt zumindest der Ökonom: »Auch ein Bettler deckt seinen gelegentlichen Bedarf überwiegend wie alle anderen Menschen, nämlich durch Verhandeln, Tausch und Kauf. Mit dem erbettelten Geld kauft er sich etwas zum Essen, geschenkte, alte Kleider tauscht er gegen andere, die ihm besser passen, gegen eine Unterkunft, Essen oder Geld, mit dem er wiederum Lebensmittel, Kleidung oder eine Schlafstätte, je nach Bedarf, kaufen kann.« (Smith: 17)
An der Stelle stelle ich mir vor, wie ein Studierender der Wirtschaftswissenschaften im Seminar sitzt, diesen Schwachsinn liest und auch noch glaubt. Denn Adam Smith ist tatsächlich heute noch der heiße Scheiß unter Wirtschaftswissenschaftlern. Unweigerlich kommt dem Seminarteilnehmer doch in den Sinn, dass Hartz-IV–Sätze ausreichen, um zu essen, zu schlafen oder gebrauchte Klamotten zu erwerben. Niemals alles auf einmal, sondern gut danach abgewägt, was gerade am Dringlichsten ansteht. Was braucht der Mensch schon mehr, als zur unmittelbaren Bedarfsdeckung seiner »tierischen Funktionen« (MEW 40, 514). Und auch die Politik zieht nach. »Lasst uns das Flaschenpfand erhöhen. Dann kommen die Armen auch garantiert über die Runden.« (Kein Witz. Diesen Vorschlag gab es tatsächlich aus der CDU).
So einfach kann man es sich machen.
An der Stelle kommt mir noch mehr in den Sinn. Meine Nachbarin äußerte sich neulich über einen Obdachlosen, der sie auf der Zeil angeschnorrt hatte, folgendermaßen: »Also, wenn dem nur jeder Hundertste fünfzig Cent gibt . . . Da kommt der – bei statistisch gesehen vierzehntausend Menschen pro Stunde auf der Zeil – auf ein Vermögen! Und das steuerfrei. Du, also da werd’ ich auch Bettler.« Ein Beweis der Arbeitswerttheorie im Kopf der Bourgeoisie. Und wenn er ganz pfiffig ist, bekommt er sogar einen Euro von jedem hundertsten Passanten, denn Gewinnmaximierung liegt doch auch irgendwie in seiner Natur, oder?
Doch zurück zu Smith. Dass das Interessenband auch so, unabhängig von der Entstehung von Armut, dünn sein kann und jederzeit im Begriff ist zu reißen, bringen bereits lange vor Hegel verschiedene Konzepte der Moralphilosophie zum Ausdruck, nicht zuletzt auch von Adam Smith selbst, der im Anschluss zu »Wealth of Nations« die »Theory of Moral Sentiments« schreibt. Kapitalismus scheint also doch eine Moral zu brauchen, die seine schlechten Seiten zügelt. Doch geht das überhaupt?
Die Robinsonaden (so bei Smith beispielsweise) unterstellen einen zeitlichen Urzustand und halten das Individuum in der Blase seiner eigenen Natur (Schaffen und Tauschen) gefangen, die es in der Produktions- und Zirkulationssphäre erst zur ihrer eigentlichen Vollendung bringt. Der Kapitalismus ist demzufolge nichts anderes, als die objektivierte Vollendung menschlicher Natur. Die Individuen handeln und verhalten sich in der ökonomischen Sphäre zum Zweck gemeinsamer Interessenwahrung ausschließlich so, dass eine vernünftige und harmonische Ordnung entsteht. Weshalb viele heute immer noch denken – inklusive unseres ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck –, dass nur der Kapitalismus Freiheit und Demokratie mit sich bringt.
Dieser methodische Individualismus erklärt somit einen vermeintlichen Naturzustand zum methodischen Ausgangspunkt und macht dadurch die ökonomische Sphäre zum Ort strategischer Handlungen und der Verwirklichung natürlicher menschlicher Interessen. Kein Wunder, dass es aus diesem Gedankenmodell keinen Ausweg gibt, wenn es überall nur natürlich zugeht.
Sämtliche Produktionsinstrumente, angehäufte Arbeit und Kapital als objektivierte Arbeit, alle historischen Entstehungen und Objektivierungsprozesse, auch die ursprüngliche Akkumulation (MEW 23, 741), über die sich – kriegs- und eroberungsbedingt – frucht- und schröpfbare Ländereien angeeignet wurden, sind hier zugunsten eines ewigen Naturverhältnisses getilgt (siehe MEW 13, 617). Ihre gesellschaftliche Vermittlung erfolgt lediglich über das richtige und vernünftige Zusammenspiel der Individuen. Marx schreibt dazu: »In diesem Vergessen liegt z.B. die ganze Weisheit der modernen Ökonomen, die die Ewigkeit und Harmonie der bestehenden sozialen Verhältnisse beweisen.« (MEW 13,617) Arbeit selbst wird somit unmittelbar gesellschaftlich, allein über das jeweilige Bedürfnis, das sie stillt. Und die Notwendigkeit der Arbeit und ihres jeweiligen Produktes regelt sich über Angebot und Nachfrage.
Bei Smith kommt hinzu, dass seine Analyse der freien Vertragsarbeit als Ursprung für gesellschaftlichen Wohlstand höchst normativ ausgearbeitet ist. Als Ökonom und Moralphilosoph ist ihm unweigerlich daran gelegen, die Bedingungen dafür zu analysieren, wie die neue gesellschaftliche Realität, der freie Arbeitsvertrag, zum allgemeinen Nutzen und Reichtum eingesetzt werden kann, nicht zuletzt durch angemessenen Lohn, der sich seinem Modell zufolge kongruent zum wirtschaftlichen Reichtum einer Nation entwickelt (Smith: 61) und niemals unter die Grenze der Menschlichkeit fallen darf (ebd: 64) . An manchen Stellen liest sich »Wealth of Nations« dann auch wie ein Fürstenspiegel, den man dazu nutzte, feudalen Regenten zu zeigen, dass nur die Zufriedenheit der Bevölkerung die Stabilität ihrer eigenen Herrschaft garantiert; auf Smith übertragen: ein gerechter Lohn = zufriedene Arbeiter = eine stabile Gesellschaft = ungestörtes Wirtschaften. Die Verwirklichung dieser Gleichung ist natürlich rein strategisch. Es geht also um die wechselseitige Stabilisierung von zufriedenen Arbeitern und einer unabhängigen Wirtschaft, die sich weder durch empörte Arme, noch durch einen bevormundeten Staat gegängelt fühlt.
So zumindest im klassischen Liberalismus. Und auch Smith scheint durch seine normativen Ansätze zu ahnen, dass es sich hier um eine Produktionsform handelt, die das Potential hat, sich in die falsche Richtung zu entwickeln. Zwangsläufig. Denn Moralphilosophen verdienen ja ihre Brötchen damit, dass Realität und Wunschdenken auseinander klaffen. Problematisch wird es nur, wenn sie denken, dass ihre Theorie reale Anwendung genießt, geschweige denn irgendeinen Sinn macht. Denn wie man mittlerweile weiß, ging das Konzept ohnehin nicht auf. Moral taugt also mitnichten dazu, Verselbständigungen produktiver Systeme zu zügeln. Denn der Neoliberalismus hat den Staat längst an der Leine und weiß ihn für sich zu nutzen, indem er jetzt die Armen durch Ausgleichsgesetze ruhigstellt oder ihnen so lange vom Mythos der Eigenverantwortung erzählt, bis die Dummen es auch noch selbst glauben. Aus empörten Armen werden nicht politisierte, sondern zugerichtete Arme. Und wenn sie sich empören, dann schließen sie sich Pegida an oder glauben an Verschwörungstheorien.
Der Arbeitslohn erscheint darüber hinaus bei Smith – so Marx’ Einwand – automatisch als Tauschwert und Lohn für Arbeit, und zwar im wörtlichen Sinn. Der Wert der Ware ergebe sich nach Smith aus der darin verausgabten Privatarbeit und Mühe (Smith: 28), der Mehrwert, den sie produziert, wiederum durch Rationalisierung, dem Einsatz aller menschlicher Fähigkeiten und durch individuellen Fleiß.
Wäre das alles tatsächlich so, wären einerseits alle Bedürfnisse – unabhängig von Moden und Trends – jederzeit auf Befriedigungskurs, andererseits wäre ich mir als Arbeitender sicher, dass meine Mühe und Verausgabung jederzeit anständig bezahlt würde und weiterhin wird; und ein Manager, der eben mal einen Konzern wie VW rasiert hat, würde – nur so am Rande – dazu kongruierend einen schmerzlichen ökonomischen Malus hinnehmen müssen. Dieses Modell versprüht also die Naivität einer beeinflussbaren fairen und harmonischen ökonomischen Sphäre, die realiter gar nicht existiert und noch nie existiert hat.
Denn alle Konsequenzen aus diesem Konstrukt kommen uns – bezogen auf die eingangs genannten zeitgenössischen Formen des Selbstunternehmertums – sogleich lächerlich bis zynisch vor. Einerseits wissen wir nämlich alle, wiesehr gesellschaftliche Arbeit – gerade im Kreativbereich – Moden und Trends unterworfen ist; andererseits gehören viele aus diesem Bereich zu den Prekarisiertesten, die unsere Gesellschaft mitunter zu bieten hat; die vielbeschworene Freiheit, um die man als Kreativer immer beneidet wird, kann sich der Neider gut und gerne an den Hut stecken, wenn ich von meiner Verausgabung nicht überleben kann. Und dass es generell in der Arbeit harmonisch und fair zwischen Verausgabung und Bezahlung zugehe, kann wirklich keiner ernsthaft bejahen, nicht zuletzt auch beim Verhältnis zwischen Erfolg und Bezahlung im Managersektor. Zudem stellt sich die Frage, wie all diejenigen, die nicht nur einen kurzfristigen Hype, sondern einen langfristigen Erfolg geschafft haben oder sich gar als feste Institution etablieren konnten, überhaupt Profit aus ihrem Betrieb ziehen könnten, wenn sie all die Menschen, die für sie arbeiten, verausgabungsgerecht bezahlten, wenn sie die Produkte für ihren Betrieb fair und ökologisch korrekt erwerben würden und die Preise gleichzeitig so gestaltet wären, dass sie sich jeder leisten könnte und weiterhin kann; wenn es sozusagen keine Möglichkeit gäbe, Mehrarbeit abzuschöpfen.
Man sieht also, dass bereits im ersten Ansatz einer Arbeit–als–Tauschwert–Theorie etliches hinkt, da hier lediglich Privatarbeiten untereinander tauschbar sind. Doch auch die Arbeitswerttheorie bei Ricardo kann dieses Problem nicht auflösen, weil die Bestimmung der erstmals genannten gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit unklar bleibt. Denn weder erklärt sich hier der Schritt von Privatarbeit zu gesellschaftlicher Arbeit, noch der Unterschied zwischen Arbeit und der Ware Arbeitskraft, über welche erst der Mehrwert produktionssteigernd abgeschöpft werden kann. Hält man an der Arbeitswerttheorie nach Ricardo fest, dann erhält man unweigerlich einen Substanzbegriff, der Waren eine Werthaftigkeit unterstellt, sobald darin Arbeit verausgabt wurde, denn dieser Theorie nach materialisiert sich in der Ware entäußerte Arbeit. Darüber hinaus wird Arbeit dadurch wertgebend, denn sie ist ja das Maß der Dinge, die Wertstifterin der Waren. Die Folge sind – so Ingo Elbe – der Waren- und Arbeitsfetisch, der bis heute im Bewusstsein der Arbeits- und Marktsubjekte verankert ist: Wir unterliegen der Selbständigkeit der Waren und unsere Arbeit trägt automatisch zum Reichtum der Gesellschaft bei (siehe Elbe: 229).
Dass die Verausgabung allein alles andere als wertstiftend ist, wenn sie nicht als abstrakte gesellschaftliche Form erscheint, und dass dieser Abstraktionsprozess selbst nicht störungsfrei ist, liegt auf der Hand.
Darüber hinaus geht die Arbeitswerttheorie davon aus, dass sich die Entwicklung von notwendiger Arbeit rational zur Entwicklung von technologischen Erneuerungen verhält. Wird der Arbeiter arbeitslos, dann hat das einen guten Grund, so der klassische Ökonom. Dass diese Form eines ökonomischen Rationalismus problematisch, wenn nicht sogar naiv ist, werden wir noch sehen. In beiden Theorien fehlen demnach die realen und inhärenten Störungen und Disharmonien, denn die Möglichkeit, dass eine Privatarbeit niemals gesellschaftliche Arbeit wird, oder gar eine gesellschaftliche Arbeit plötzlich in die Nicht-Notwendigkeit abstürzt, ist hier erst gar nicht gegeben.
Genau dieser Widerspruch ist es, den Marx aufzulösen vermag, indem er erstmals die Grundlage zur Entstehung gesellschaftlicher Arbeit entwickelt, und zwar einerseits über den Doppelcharakter der Ware (Gebrauchs- und Tauschwert), andererseits über ihren Wert, über den Privatarbeit überhaupt erst abstrakte gesellschaftliche Arbeit wird.
Was heißt das nun?
Die Unterteilung der Ware (nützliches Produkt oder Dienstleistung) in Gebrauchswert und Tauschwert kann zunächst zeigen, dass beide Dimensionen historisch entstanden, und nicht als natürlicher Ausgangspunkt einfach mal so vorhanden sind, um sie methodisch zu nutzen. Der Gebrauchswert entsteht erst über das spezifische Bedürfnis einer Gesellschaft, und zwar zu einem spezifischen historischen Zeitpunkt. Er ist »gesellschaftliche[r] Gebrauchswert« (MEW 23: 55). Beispielsweise machen Staubsauger keinen Sinn in einer Gesellschaft, die historisch noch nicht mit Strom versorgt war, oder es geografisch bedingt überhaupt nie sein wird. Ebensowenig macht zum Beispiel eine Dienstleistung in einem Sonnenstudio Sinn, solange das allgemeine Schönheitsideal der noblen Blässe nicht durch den Wunsch nach knuspriger Epidermis aufgeweicht wurde, und sie macht ebenfalls keinen Sinn in einem Land, wo das ganze Jahr über die Sonne scheint.
Im Tauschwert wiederum drückt sich das Äquivalent des jeweiligen Gebrauchswertes aus, welches zwei Waren erst vergleichbar und damit untereinander austauschbar macht. Auch der Tauschwert ist somit an die jeweilige Gesellschaft gebunden. Denn wir werden wohl kaum Weizen gegen Klamotten tauschen, es sei denn, man etabliert einen privaten Tauschhandel, den es mitunter wieder gibt, um beispielsweise gegen die Verschwendung von Lebensmitteln oder die modebedingt geringe Halbwertszeit von Klamotten zu protestieren.
Somit kann man sich vorstellen, dass auch Nicht-Waren – gebrauchte Dinge, Gegenstände oder Liebhaberstücke – einen Tauschwert haben, insbesondere auch auf der Zirkulationsplatform ebay, oder in den eben genannten Tauschökonomien. Der Tauschwert ist demnach kapitalismusunabhängig. Darüber hinaus – so ein weiteres Problem – macht ein permanent äquivalenter Tausch für eine kapitalistische Produktion überhaupt keinen Sinn. Wie sollte es jemals zur Produktionssteigerung und Profit kommen, wenn alles nur vergleichbar wäre?
Der Wert, der jetzt ins Spiel kommt, bildet demnach nicht nur eine äquivalente Verausgabungsgröße ab, um Waren untereinander austauschbar zu machen, sondern beinhaltet das Gemeinsame der Waren oder Dienstleistungen, nämlich die Vergleichbarkeit über Arbeit in ihrer abstrakten gesellschaftlichen Form. Und damit etwas überhaupt diese Qualifikation erhält, muss sie sich als gesellschaftliche Arbeit etabliert haben. Der Wert ist demnach die Größe, in der sich »abstrakt menschliche Arbeit« (MEW 23: 52) darstellt.
Man kann jetzt einwenden, dass auch der private Verkauf auf ebay Gegenstände als Resultat menschlicher Arbeit und somit Waren veräußert. Doch sind das zumeist Dinge, die zu anderen Zeiten Waren darstellten (Antiquitäten, Vintage-Klamotten, nicht mehr produzierte Geräte) oder überhaupt keine gesellschaftliche Arbeit materialisieren (selbstgestrickte oder selbstgenähte Klamotten, kuriose und nur von Liebhabern geschätzte Handwerksprodukte); und auch abgelaufene Lebensmittel, die der Zirkulationssphäre entnommen werden, und durch das so genannte »Containern«, dem Protest gegen Lebensmittelverschwendung, in die private Tauschwirtschaft übergehen, sind keine Waren im kapitalistischen Sinne.
Um uns dies verstehen zu lassen, schreibt Marx: »Ein Ding kann Gebrauchswert sein, ohne Wert zu sein.« Beispielsweise Regenwasser und Luft. »Ein Ding kann nützlich sein und Produkt menschlicher Arbeit sein, ohne Ware zu sein.« Beispielsweise ein selbst gestrickter Pullover. »Wer durch ein Produkt sein eigenes Bedürfnis befriedigt, schafft zwar Gebrauchswert, aber nicht Ware« Ein zubereitetes Abendessen oder aus Containern gerettete Lebensmittel. (MEW 23: 55, eigene Beispielsnennungen).
Alle drei eingefügten Beispiele zeigen bereits ein erstes Problem, denn Hausarbeit, in der Essen zubereitet wird, Liebesarbeit, in der für einen Freund oder das Kind ein Pullover gestrickt wird und frei verfügbares Wasser und Luft sind vom Wertbildungsprozess ausgeschlossen und insofern in der Logik der Werttheorie nicht nur produktionsbedingt, sondern auch gesellschaftlich irrelevant, denn eine kapitalistische Gesellschaft definiert sich ja nur über ökonomisch produktive und anerkannte Arbeit. Kann aber eine Gesellschaft ohne Hausarbeit und Liebesarbeit auskommen? Und wie steht es um Luft und Wasser, die niemandem gehören und frei verfügbar sind? Ist das der Grund, weshalb Umweltschutz so stiefmütterlich behandelt wird? Und wie steht es um die abgelaufenen Lebensmittel? Wieso kann sich eine Gesellschaft leisten, so verschwenderisch mit lebenswichtigen Produkten umzugehen, während andernorts die Menschen verhungern?
Marx schreibt weiter: »Endlich kann kein Ding Wert sein, ohne Gebrauchsgegenstand zu sein. Ist es nutzlos, so ist auch die in ihm enthaltene Arbeit nutzlos, zählt nicht als Arbeit und bildet daher auch keinen Wert.« (MEW 23:55) Und seine Formulierung zeigt gleichzeitig eindrucksvoll seine Methode, nämlich die analytische Darstellung des Kapitalismus, wie dieser aus seinem Selbstverständnis heraus tickt. Dass das mitnichten affirmativ sei und er sich so als Vordenker der modernen Arbeitergesellschaft erweise, wie ihm Hannah Arendt in »Vita Activa« (Arendt: 81) vorwirft, liegt auf der Hand: Wie soll im weiteren Verlauf eine seriöse Kapitalismuskritik, und zwar frei von moralischem Geplänkel und Ressentiments funktionieren, wenn man das System erst gar nicht verstanden hat?
Aus diesen einfachen Sätzen eröffnet sich nämlich sogleich ein Stapel an Fragen, die genau das grundlegende Problem gesellschaftlicher Arbeit im Kapitalismus darstellen. Denn der Zusammenhang von Nutzen über den Gebrauchswert eines Gebrauchsgegenstandes und die Anerkennung als gesellschaftliche Arbeit über das Erfüllen dieses Nutzens führt uns geradewegs in eine erste entscheidende Zwischenüberlegung: Warum kann im Kapitalismus eine Arbeit gesellschaftliche Arbeit sein, die insgesamt Nutzloses produziert? (Wegwerfprodukte; Dinge, die ihre Garantiezeit gerade mal kurz überleben; Dinge von schlechter Verarbeitung und Qualität; Dinge, die gar nicht erst funktionieren; mein Internetanschluss, der ständig ausfällt oder das Rührei–Brot von Maggi). Und warum kann Arbeit, die gesellschaftlich von geradezu herausragendem Nutzen ist, dennoch von der Definition gesellschaftlicher Arbeit im Kapitalismus ausgeschlossen sein? (Arbeit aus dem informellen Sektor, wie Haus- und Erziehungsarbeit; die private Pflege von Angehörigen; Ehrenamt). Und rechtfertigt das, Lebensmittel wegzuwerfen, die noch genießbar sind, nur weil sie für den normalen zahlenden Konsumenten keinen Gebrauchswert haben?
Darüber hinaus ergeben sich aber noch weitere Probleme zur abstrakten gesellschaftlichen Arbeit, die im Wert vergleichbar wird: Das Prinzip des Kapitalismus ist es, die Verausgabung der produktiven Arbeit so effektiv und kostengünstig zu gestalten wie möglich – durch technologische Innovationen beispielsweise oder durch Einsparungen in den Produktionskosten. Das heißt: Je geringer und effektiver der Aufwand und die Kosten, umso besser für die Produktion, umso besser für den Geldbesitzer. Und darin liegt auch schon der Knackpunkt, denn je geringer die Kosten der Produktion, umso schlechter für den Arbeiter, der diese Kosteneinsparung unmittelbar zu spüren bekommt: Über Arbeitstagsverlängerungen, Lohnkürzungen, bis hin zu seiner eigenen Kündigung, weil die Produktion beispielsweise Kosten einsparen muss. Marx: »Innerhalb des kapitalistischen Systems vollziehn sich alle Methoden zur Steigerung der Produktivkraft der Arbeit auf Kosten des individuellen Arbeiters; alle Mittel zur Entwicklung der Produktion schlagen um in Beherrschungs- und Exploitationsmittel des Produzenten (MEW 23: 674). Und weiter: »Die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen allen Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter« (MEW 23: 529f.)
Aber auch die grundsätzliche Änderung gesellschaftlicher Arbeit kommt hier zum Tragen: Der technologiebedingte Wegfall von Arbeitsplätzen (Entwicklung von Robotern) sowie die seit der Agenda 2010 wieder eingeführte Einrichtung einer Reservearmee – mittlerweile »Manövriermasse« genannt –, die Arbeit auf der Ersatzbank, die nur zum Einsatz kommt, wenn sie gebraucht wird, ist ein wesentliches Symptom des Wertes (beispielsweise Leiharbeit oder auch die in Großbritannien üblichen Null-Euro-Verträge, die einen an die Arbeit und Bezahlung auf Abruf sogar noch vertraglich binden).
Marx: »Wenn die Produktionsmittel, wie sie an Umfang und Wirkungskraft zunehmen, in geringerem Grad Beschäftigungsmittel der Arbeiter werden, wird dies Verhältnis selbst wieder dadurch modifiziert, daß im Maß, wie die Produktivkraft der Arbeit wächst, das Kapital seine Zufuhr von Arbeit rascher steigert als seine Nachfrage nach Arbeitern. […] Der kapitalistischen Produktion genügt keineswegs das Quantum disponibler Arbeitskraft, welches der natürliche Zuwachs der Bevölkerung liefert. Sie bedarf zu ihrem freien Spiel einer von dieser Naturschranke unabhängigen industriellen Reservearmee.« (MEW 23, 664)
In diesen Überlegungen liegt bereits ein wichtiger Schritt aus der klassischen Arbeitswerttheorie, denn die realen Depravationen, die wir heutzutage wieder eindrücklich erfahren, gibt es in dieser Theorie erst gar nicht. Wenn hier Arbeitslose entstehen, dann nur, weil sie aufgrund technologischer Erneuerungen wegrationalisiert wurden und das lässt sich als Gesamtnutzen für den technologischen Standard und Wettbewerb einer Gesellschaft auch rechtfertigen. Arbeit kann eben produktionsbedingt unbrauchbar werden und das versteht womöglich auch der Arbeiter. Aus heutiger Sicht würde man ihm eine Umschulung anbieten. Die produktionsnotwendig unbrauchbare Arbeit, und zwar die Arbeit auf Abruf einer Reservearmee, und die Möglichkeit des Drucks und Lohndumpings aufgrund der alleinigen Existenz dieser Arbeitsreservisten, ist jedoch neu. Die Folgen dieser Reservisten sind aber eklatant: Denn jetzt braucht der Arbeitgeber noch nicht mal jemanden zu suchen, der einen Arbeiter ersetzt, wenn dieser erkrankt oder aufmuckt. Der Arbeiter muckt von sich aus nicht mehr auf oder geht sogar krank zur Arbeit, weil es Hunderte oder gar Tausende gibt, die ihn jederzeit ersetzen können. Er wird schlichtweg austauschbar.
Zuletzt konnte man das eindrücklich beim Poststreik erkennen, der dadurch entschärft wurde, dass private Betriebe ihre Mitarbeiter in die Sortierzentren schickten oder Briefe und Pakete sonntags von Leiharbeitern ausgeliefert wurden.
Wohin aber driftet eine Gesellschaft ab, in der Arbeiterprotest inhärent unmöglich wird?
Dieser entscheidende Schritt führt jetzt dazu, dass der Arbeiter trotz seiner Arbeit, trotz seiner Verausgabung verarmt. Er verarmt also nicht, weil er wegrationalisiert wurde, weil er arbeitslos wurde, sondern obwohl der arbeitet. Die Arbeit des Arbeiters ist jetzt produktionsnotwendig verarmend und verelendend. Denn das liefert dem Produzenten eindeutige Vorteile, die seine Macht gegenüber dem Arbeiter noch mehr verstärken. Das aber ist ein entscheidender Schritt hin zur grundlegenden Depravation moderner Arbeitsverhältnisse, die erstmals überhaupt von Marx aufgedeckt werden.
Marx: »Im großen und ganzen sind die allgemeinen Bewegungen des Arbeitslohns ausschließlich reguliert durch die Expansion und Kontraktion der industriellen Reservearmee, welche dem Periodenwechsel des industriellen Zyklus entsprechen.» (MEW 23: 664)
Aber auch die Produktion von nutzlosem, lediglich die Produktion aufrechterhaltenem Waren–Müll sowie die produktionsnotwendig irrelevante und dennoch gesellschaftlich höchst bedeutungsvolle Arbeit aus dem informellen Sektor spielen nach einer Arbeitsmengentheorie, die sich nur positiv auf die Beziehung zwischen Arbeitsverausgabung und Steigerung der Produktivkraft bezieht, keine Rolle. Womöglich – nur so am Rande – wird der informelle Sektor sogar deshalb aufrechterhalten, weil er produktionsnotwendig irrelevant ist und diese doch irgendwie notwendige Arbeit nun ohne ökonomische Anerkennung problemlos weiter existieren kann. Sie macht sich somit unentgeltlich bezahlt.
Wie aber kann eine Gesellschaft funktionieren, in der die wichtigste Arbeit, die Arbeit am Menschen – Familienarbeit, Erziehungsarbeit, Pflegearbeit – gesellschaftlich irrelevant ist? Und leben wir nicht längst in einer solchen Gesellschaft, die alle Arbeit am Menschen gänzlich geringschätzt, gerade wenn man sieht, wiesehr vor allem in der Pflegearbeit auch Arbeitssklaven eingesetzt werden?
Die Arbeitsmengentheorie der klassischen Ökonomie zeigt deshalb ganz klar Ansätze einer positivistischen Theorie, die Überlegungen einer Depravation von Arbeits- und Produktionsverhältnissen und von Gesellschaft insgesamt nicht in ihr Konzept einschließt. Marx kann hingegen zeigen, dass abstrakte gesellschaftliche Arbeit im Kapitalismus produktiv zu sein hat. Punkt. Und alle Arbeit, die das nicht ist = nicht gesellschaftlich = nicht wertbildend = gesellschaftlich irrelevant. Und aus diesem Zirkel gibt es keinen Ausweg.
In der Arbeitsmengentheorie werden darüber hinaus Bedürfnisse mit Waren befriedigt, so ihr naives Selbstverständnis. Aber kann sich eine kapitalistische Produktion überhaupt aufrechterhalten, wenn es ihr nur um Bedürfnisbefriedigung gehe?
Die Marx’schen Werttheorie zeigt dagegen, dass sich die Produktion selbst aufrechterhält, und zwar egal wie. Egal, ob mit Arbeiter oder Reservist, ob mit Bezahlung oder ohne. Egal, ob mit oder ohne Waren-Müll. Es geht also alles, was gehen muss. Und es kann aber auch nicht anders gehen, denn nur so wird die Aufrechterhaltung der Produktion überhaupt garantiert, und zwar bedingungslos gegen alle Widrigkeiten und Krisen. Und steht dem etwas entgegen, dann muss eben gehandelt werden: über Entlassungen, über Niedriglöhne, Werkverträge, über die Einrichtung einer Manövriermasse oder über Arbeitssklaven, deren Arbeitskraft über alle Maßen ausgenutzt wird (beispielsweise in der Fleischindustrie) oder durch Knebelverträge über die genannten Null-Euro-Verträge.
Und auch der einzelne Produzent – Szenegastronom, Clubbetreiber, Handwerkskünstler, Designer – bekommt jetzt über die realen Disharmonien zwischen seiner Privatarbeit und ihrer gesellschaftlichen Notwendigkeit oder Überflüssigkeit sein Fett weg. Denn auch seine Arbeit kann unter bestimmten Voraussetzungen gesellschaftlich und mitunter sogar willkürlich irrelevant werden. Denn der Wert bemisst sich nicht über die jeweilige Privatarbeit, sondern erst über ihre abstrakte gesellschaftliche Form. Einschneidend und mitunter existenzgefährdend hatten das zuletzt Fotografen zu spüren bekommen, als die Digitalisierung der Fotografie diese nachhaltig verändert hat. Wer jetzt glaubt, es genügte damals, sich dieser technischen Neuerung anzupassen, irrt gewaltig. Was Baumärkte für Handwerksbetriebe bedeuteten, bedeutete die Digitalisierung für die Fotografie. Denn die reale Folge war, dass jetzt jeder selbst nötige Fotoaufnahmen erledigte. Und auch die Industrie hat bekanntlich nachgezogen, indem selbst Handys Kameras bekamen und diese noch dazu immer besser wurden, wie man auch bei Online-Diensten wie Instagram erkennen kann. Diese Digitalisierung hat letztendlich dazu geführt, dass professionelle Fotografen ihre Aufträge im Kulturbetrieb sukzessive verloren haben oder ihre Preise sosehr herabsenken mussten, dass dadurch wieder Arbeits- und Ausbildungsplätze verloren gingen.
Ich kann also als einzelner Robinson noch so viele T-Shirts durchschwitzen wie ich will, solange meine Privatarbeit nicht als abstrakte Arbeit erscheint, bleibt sie vom Wertbildungsprozess, der Anerkennung als gesellschaftliche Arbeit, schlichtweg ausgeschlossen, und diese Anerkennung kann sie auch jederzeit wieder verlieren.
Um eine Arbeit notwendig für die Gesamtproduktion und Gesellschaft zu machen, muss sie sich erst als solche etablieren. Und der Wert bildet genau diese Abstraktionsleistung ab, über die eine Arbeit produktionsbedingt notwendig oder nicht-notwendig ist; dass sie gesellschaftlich relevant oder eben irrelevant ist.
Engels: »[…] der Wertbegriff […] bei Marx ist nichts andres als der ökonomische Ausdruck für die Tatsache der gesellschaftlichen Produktivkraft der Arbeit als Grundlage des wirtschaftlichen Daseins« (MEW 25, 903f.) Es geht also um die Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Produktivkraft der Arbeit. Das allein ist die Logik des Wertes.
Doch was ist die gesellschaftliche Produktivkraft?
In einem Brief an Annenkow schreibt Marx, dass die Produktivkräfte „das Resultat der angewandten Energie der Menschen“ seien; allerdings sei diese Energie „begrenzt durch die Umstände, in welche die Menschen sich versetzt finden, durch die bereits erworbenen Produktivkräfte, durch die Gesellschaftsform, die vor ihnen da ist, die sie nicht schaffen, die das Produkt der vorhergehenden Generation ist“ (MEW 4: 548f). Man kann die Produktivkräfte auch als die Gesamtheit aller tatsächlichen und potentiellen produktiven Möglichkeiten einer Gesellschaft bezeichnen: Technologien, Wissen, Kultur, Medizin etc.; der technologische und kulturelle Stand und das Potential einer Gesellschaft zu einem jeweils historischen Zeitpunkt. Der Kapitalismus versteht es jedoch, diese Errungenschaften und Potentiale zu seinen Gunsten und für sein Interesse zu nutzen, weshalb er definiert, was eine gesellschaftliche Produktivkraft ist. Kultur kann dann im Zweifelsfall auch mal wegfallen. Oder sie kann eine geradezu herausragende Rolle spielen, wie beispielsweise die Filmindustrie. Und gerade in der Kultur sieht man, wie willkürlich der Wert Privatarbeiten gesellschaftlich macht oder auch daran hindert. Gelder werden meist an die Institutionen vergeben, mit denen sich der Kapitalismus identifizieren kann, während alternative Projekte nicht selten davon abgehalten werden, sich zu entfalten und Fördergelder zu erhalten.
Der geschichtsphilosophische Ansatz von Marx geht jetzt davon aus, dass die Menschen sich irgendwann mit ihrem erworbenen Wissen, ihren eigenen Produktivkräften, gegen das System wenden. Denn kongruent zur Entwicklung und zum Fortschritt der gesellschaftlichen Produktivkräfte eigenen sich die Menschen Wissen an, das sie als Waffe gegen die Produktionsverhältnisse einsetzen. Es kommt zur Revolution. Ein schöner Traum. Denn wie wir längst wissen, ist Bildung das, was im Neoliberalismus am sträflichsten vernachlässigt wird.
Ist der dumme Arbeiter etwa ein Garant für die Aufrechterhaltung des Systems?
Wohl kaum. Denn jetzt ist er so dumm, dass er in AFD und Pegida die Lösung für seine Misere sieht. Man hat sich also neue Waffen geschmiedet. Nicht mehr das Proletariat, sondern den dumpfen Wutbürger, den Troll, den Nazi, den Chauvinisten, Rassisten und Antisemiten. Und es gibt auch noch Schützenhilfe aus der bürgerlichen Mitte. Von all denen, denen es eigentlich gut geht. Ob man die jemals alle wieder los wird?
Doch kommen wir zurück zum Wert. Die Abstraktionsleistung im Wert ist in die Handlungen der Marktsubjekte eingeschrieben. Sie ist gänzlich unbewusst. Sie ist keine methodische oder strategische Abstraktion als Resultat eines vermeintlich strategischen Handelns (siehe Elbe: 234 und Heinrich: 2005: 47). Alle Strategie und Vernunft, die noch in den klassischen Ökonomietheorien eine Rolle gespielt haben, verschwinden bei Marx zugunsten eingeschriebener Handlungs- und Verhaltensweise der Marktsubjekte.
Damit eine Privatarbeit und ihre Ware (Handwerksprodukt, Fabrikware, Dienstleistung) gesellschaftlich werden, genügt es also nicht, allein mit dem Vorhaben der Bedürfnisbefriedigung auf der Zirkulationsplatform aufzutreten. Dieser Schritt reicht nicht aus, um aus einer Privatarbeit gesellschaftliche Arbeit zu machen, denn dort aufzutreten heißt längst nicht, dort auch willkommen zu sein. Vielmehr muss die einzelne Privatarbeit erst Eingang in die reale Abstraktion ihrer Vergleichbarkeit erhalten. Und diese Vergleichbarkeit erfolgt über den Wert. Die Gesellschaftlichkeit ist hier also doppelt vermittelt; nicht allein über das Vorhaben der Bedürfnisbefriedigung, sondern zusätzlich über ihre Anerkennung als produktionssteigernde gesellschaftliche Arbeit; eine defizitäre Form der Anerkennung, da diese lediglich ökonomisch begründet ist und nicht emanzipatorisch und selbstverwirklichend, wie es in Marx’ Konzeption der freien Gesellschaft möglich sei.
Verständlich wird das ganze vielleicht so: Beispielsweise ist es durchaus möglich, dass ein Handwerkskünstler jahrelang in seinem Atelier Gebrauchswerte schafft und vor sich hinarbeitet, und urplötzlich wird die eigene Arbeit zu gesellschaftlicher Arbeit. Diesen Trend gab es zuletzt in England beim so genannten »Pottery«, dem Töpferhandwerk. Erst in dem Moment, wo die Gebrauchswerte des jeweiligen Töpfers Eingang und Anerkennung in die Zirkulationssphäre haben, werden sie zu Waren und Hüllen abstrakter gesellschaftlicher Arbeit (siehe MEW 23, 88). Marx: »Diese Dinge stellen nur noch dar, daß in ihrer Produktion menschliche Arbeitskraft verausgabt, menschliche Arbeit angehäuft ist. Als Kristalle dieser ihnen gemeinschaftlichen gesellschaftlichen Substanz sind sie Werte – Warenwerte.« (ebd., 52) Und diese Substanz tilgt sowohl ihre konkrete Nützlichkeit sowie den Charakter der Privatarbeit. Es interessiert nicht mehr die Form der Verausgabung; es zählt nur noch die ökonomische Produktivität. Sichtbar auch daran, dass sich der Liberale sogar freuen kann, wenn man mit Mist Geld verdient. Wie es hinter den Kulissen zugeht, und zu welchem realen Preis der Mist verhökert wird, ist dabei völlig irrelevant: Wie steht’s um die Arbeitsverhältnisse? Wie um die Betriebsverhältnisse? Greift der ungeliebte Staat doch unterstützend ein? Beispielsweise durch Hartz-Aufstockungen für Hungerlöhne oder gar durch Kooperation wie beim Riester–Maschmeyer–Deal.
In der Theorie der politischen Ökonomie hingegen (bei Ricardo beispielsweise) bleibt der Doppelcharakter der Ware als Resultat konkreter, Gebrauchswert schaffender Arbeit und Tauschwert schaffender Arbeit, beide historischen Dimensionen sowie der Wert als handelnde Abstraktion unklar. Die Ware erscheint hier lediglich als ein an das Bedürfnis gekoppelter Gebrauchswert, und diese Ware hat automatisch einen Wert, sobald Arbeit in ihr entäußert ist. Der Wert kommt ihr quasi automatisch zu und unterstellt dadurch einen Substantialismus, der die Waren unmittelbar untereinander austauschbar macht (siehe Elbe: 232). Dadurch bleibt aber unklar, dass der Wert nur gesellschaftlich vermittelt ist und sich in der Ware lediglich materialisiert (MEW 23: 53, siehe auch Postone: 261). Der Wert tut sozusagen nur so, als ob er materiell sei; tatsächlich aber ist er ein rein gesellschaftliches Verhältnis zu einem jeweils historischen Zeitpunkt. Allein dieses Verhältnis entscheidet, ob eine Privatarbeit gesellschaftliche Arbeit ist oder eben nicht.
In unserem oben genannten Beispiel des Töpfers würde er in der Arbeitswerttheorie immer Wert schaffen, und zwar unabhängig von einem vorübergehenden Hype oder dessen plötzliches Ende; im Marx’schen Modell hingegen nur, wenn die Vermittlung im Wert seine Arbeit gesellschaftlich macht. Das Modell der politischen Ökonomie kann somit nicht erklären, warum ein Töpfer jahrelang von seiner Arbeit nicht leben konnte, einen plötzlichen Umsatzhype erlebt und danach womöglich wieder in der Versenkung verschwindet. Das Marx’sche Modell hingegen lässt im weiteren Verlauf gesellschaftliche Umstände (Trends, Moden, sozialpsychologische Macken der Konsumenten, Begehrlichkeiten, Hype–Hysterien, Schnäppchen-Fieber, Konsumenten-Neid, Selbsterhaltung der Produktion, Preiskampf und ähnlichen Konsum- und Produktionswahnsinn) verstehen, die eine Arbeit gesellschaftlich notwendig oder auch einfach mal so eben überflüssig oder gar irrelevant machen können.
Beispiele dieser Art sind zahlreich. Drei Produkte machen die Abhängigkeit der Produktion von der Konsumentenlaune geradezu deutlich: das bereits erwähnte Rührei–Brot von Maggi, das trotz Werbetrommel keiner mag; das Tamagotchi, das irgendwann alle haben und keiner mehr braucht; die Buntstifte von Faber–Castell, die über ein unerwartetes Revival plötzlich alle haben müssen, um in Malbüchern für Erwachsene ihren Massenindividualismus auszuleben.
Der vermeintlich natürliche Wert einer Ware klebt ihr – so Marx – in der Arbeitswerttheorie somit förmlich an, sobald sie produziert ist (siehe MEW 23: 87). Da auch die Arbeitskraft nach Marx eine Ware ist, bedeutet die Anwendung dieser Theorie auf heute, dass auch Arbeit automatisch Wert anklebt, und zwar gesellschaftsunabhängig, sobald sie in entäußerter Form (als geschaffenes Projekt, Produkt, getaner Arbeitstag, als von Pfandflaschen bereinigter Stadtpark, als durchgeschwitztes T-Shirt, geschundene Hände oder als zu Papier gebrachtes Hirnschmalz) erscheint.
Ich kehre somit abends mit dem guten Gefühl nach Hause, dass ich meiner Entäußerung entsprechend adäquat bezahlt wurde, und mit meiner Tätigkeit und meinem Produkt automatisch am Wachstum des gesellschaftlichen Reichtums beteiligt war. Wen wundert‘s, wie schlecht sich ein Arbeitsloser fühlen muss und wie sehr ihm nach diesem Modell ein Versagen eingeredet wird. Faul saß er den ganzen Tag auf der Haut und hat sich mitnichten an der Vermehrung des gesellschaftlichen Reichtum beteiligt. Im Gegenteil: Über die ihm zugeteilte Stütze hat er sich noch unverschämter Weise daran bedient.
Durch ihren vermeintlich natürlichen Wert und ihrer scheinbaren Qualität der Reichtumsvermehrung produziert die Vorstellung dieser spezifischen Form der Wertarbeit im Kapitalismus somit den Zwang, an der Vermehrung dieses Reichtums mitzuwirken, der dem Arbeitslosen in all seiner Krassheit entgegenschlägt. Denn Arbeitslosigkeit bedeutet hier nichts weniger als die Weigerung oder Unfähigkeit zum Mitwirken an der gesellschaftlichen Reichtumsvermehrung. Gesellschafts- oder produktionsbedingt unbrauchbare Arbeit, die die unverschuldete Arbeitslosigkeit mit sich bringt, existiert in diesem Modell erst gar nicht. Die Schikanen, über die aus Jobcentern berichtet wird, spiegeln genau dieses Gedankenkonstrukt heutzutage noch wider. Vermissen lässt die Anwendung der Arbeitswerttheorie der politischen Ökonomie ebenfalls das gängige Phänomen, dass vergleichbare Qualitäten einer Privatarbeit einmal als gesellschaftliche Arbeit Erfolg erleben, ein andermal eben nicht. Allgegenwärtig ist dies in der künstlerischen oder kulturellen Arbeit, die ebenfalls eine Form des zeitgenössischen Selbstunternehmers darstellt.
Es gibt erfahrungsgemäß keinerlei Zusammenhang zwischen Qualität und Erfolg, auch wenn das manche noch so sehr glauben. Über den liberalen Kalauer, dass man alles erreichen könne, wenn man sich nur entsprechend anstrenge, oder Qualität sich gar immer durchsetze, können unzählige herausragende Künstler, Schriftsteller, Schauspieler nur müde lächeln, wenn ihre Arbeit einfach keinerlei oder nur holpernde ökonomische Anerkennung erntet. (Und zur Klarstellung reden wir hier von der prekarisierten, bzw. standardisierten Bezahlung, die auch Durststrecken überbrücken muss, in denen man auftragslos oder ohne Engagement pleite zuhause sitzt. Künstler, Schauspielerstars, Bestsellerautoren, deren Gagen auch nach Aura und Berühmtheit bemessen werden und insofern auch spekulativen Charakters sind, sind von diesen Überlegungen ausgeschlossen. Sie machen in diesem Zusammenhang schlichtweg keinen Sinn).
Sprachlich hat man sich hingegen längst angepasst, um diese eben genannten Phänomene zumindest begrifflich zu verpacken: es begegnen sich dann Publikumserfolg / Blockbuster / Bestseller / Publikumsmagnet / Fleiß vs. Kritikerliebling / Low Budget–Produktion / Ladenhüter / Kassenflop / Faulheit. Und auch das Steuerrecht hat sprachlich und inhaltlich nachgezogen: Ein Betrieb, der keinen ökonomischen Erfolg aufweisen kann, wird schlichtweg als „Liebhaberei“ degradiert und unter Umständen steuerrechtlich abgestraft für derlei ökonomische Erfolglosigkeit, bis hin zu seiner Zwangsschließung.
Marx dagegen zeigt nun, dass Arbeit erst über eine notwendige Abstraktion zu gesellschaftlicher Arbeit wird. Es genügt nicht, wenn Bedürfnisse und deren Befriedigung deckungsgleich mit der jeweiligen Privatarbeit des einzelnen Robinsons sind; vielmehr muss sich die jeweilige Privatarbeit zunächst als gesellschaftlich notwendig beweisen, und zwar über die Vermittlung im Wert. Denn dieser ist nicht automatisch vorhanden, sondern muss über die jeweilige Gesellschaft erst als reale Abstraktion geleistet werden. Wäre er hingegen automatisch vorhanden, kann man nicht erklären, warum eine Privatarbeit einmal gesellschaftlich ist, ein andermal eben nicht.
Die Bedürfnistheorie der Robinsonaden ist aber auch anderweitig naiv. Denn eine kapitalistische Produktion, die sich allein auf Bedürfnisbefriedigung verlasse, ist spätestens dann am Ende, wenn eine Gesellschaft übersättigt ist. Beispiele erleben wir, wenn der Kapitalismus ausländische Märkte erobert oder Binnenmärkte zerstört, weil der heimische Markt einfach keinen Absatz mehr bietet. Dabei geht es auch hier nicht um die reale Bedürfnisbefriedigung neuer Märkte, sondern allein um die Selbsterhaltung der Produktion, ein Notausgang sozusagen, um selbst nicht an einer möglichen gesellschaftlichen Bedürfnislosigkeit zu Grunde zu gehen.
Denn für den Kapitalismus ist nicht schlimmer als eine rundum zufriedene Gesellschaft.
Das Bedürfnis ist hier somit Mittel zum Zweck des Produktionserhalts. Und weil Bedürfnisse irgendwann befriedigt sind, gilt es, immer wieder neue zu finden oder Begehrlichkeiten zu kreieren, aber nur zum Zweck der sich selbsterhaltenden Produktion. Trotzdem findet sich hier noch das Ideal, die Bedürfnisbefriedigung von allen bezahlbar zu gestalten, denn ein breiter Markt gestaltet sich positiv für die Produktion, sichtbar daran, dass bestimmte Konsumgüter (Fernseher, Haushaltsgeräte) mittlerweile auch für jedermann finanzierbar sind, bis hin zu eigenen Finanzdienstleistungen des jeweiligen Verkäufers zur Ermöglichung von Ratenzahlung. Das Ziel ist hier ganz klar Konsum, und zwar von möglichst vielen. In der freien Gesellschaft bei Marx hingegen ist die Bedürfnisbefriedigung ausschließlicher Zweck der Produktion. Eine rein bedürfnisorientierte und bedürfnisbefriedigende Produktion sehe daher gänzlich anders aus. Wie, das können wir hier nicht weiterverfolgen. In der Grenznutzentheorie wiederum ist das Bedürfnis nicht Mittel der Produktion, sondern Mittel der Spekulation und muss somit künstlich verstärkt werden; im Idealfall ist es sogar niemals befriedigt, beispielsweise, über die Aufrechterhaltung von Hunger und Wohnungsnot. Weder theoretisch noch praktisch interessiert sich diese Theorie dafür, dass die Befriedigung des jeweiligen Bedürfnisses auch für alle bezahlbar sein muss, und scheitert genau daran, dass aus der Eigenlogik des Produktionserhalts heraus möglichst viele sich auch Waren leisten können müssen.
Denn wie soll bitte eine kapitalistische Gesellschaft aussehen, die bereits an der Befriedigung ihrer Elementarbedürfnisse, wie Essen oder Wohnen, scheitert? Und wie soll ein Warenbesitzer überhaupt Profit machen, wenn sich keiner mehr was leisten kann? Und wie darüber hinaus sollen sich jemals feste Preise etablieren, deren Bezahlung für den Konsumenten auch kalkulierbar sind und nicht vom täglichen Gutdünken des jeweiligen Geld- oder Warenbesitzers abhängen? Das der Kaufkraft entzogene Subjekt erscheint nämlich, wie Hans-Peter Büttner einwendet, erst gar nicht auf dem Markt (Büttner: 7), so die reale Konsequenz dieser Theorie. Man sieht also, dass in der Grenznutzentheorie realiter viele Probleme entstehen, die hier nicht weiter verfolgt werden können.
Die alleinige Regulierung über Angebot und Nachfrage, so eine weitere Behauptung der ökonomischen Robinsonaden, tilgt jedoch nicht das gesellschaftliche Verhältnis des Wertes einer Ware, sondern bestimmt lediglich ihren Preis. Das bedeutet, dass Verknappung Preise erhöht, ihr Überangebot ihren Preis senkt, was auch die Grenznutzentheorie für sich zu nutzen weiß. Auf den Wert – die gesellschaftliche Notwendigkeit und Anerkennung einer Arbeit oder eines Produktes – hat das hingegen keinerlei Einfluss.
Wo stehen wir nun?
Um im Kapitalismus anerkannte gesellschaftliche Arbeit zu leisten und Waren zu produzieren, genügt nach Marx weder das Vorhaben der Bedürfnisbefriedigung noch, sich auf das Verhältnis Angebot und Nachfrage zu verlassen – wie es sich die politische Ökonomie ausgedacht hat –, denn beides verbirgt die historische, aber auch sozialpsychologische Dimension, die Entstehung der Voraussetzungen dafür, dass eine Privatarbeit überhaupt erst zu gesellschaftlicher Arbeit werden kann. Noch viel weniger zeigt die Bedürfnistheorie der klassischen Ökonomie allerdings, wie und warum gesellschaftliche Arbeit in die Privatarbeit und damit in die gesellschaftliche Bedeutungslosigkeit zurückfallen kann.
Beispielsweise sind Youtuber, Influencer, Blogger und all diese zeitgenössischen Arbeitsformen erst möglich, seitdem beinahe jeder Haushalt einen Internetanschluss hat und ein vorwiegend junger Gesellschaftsanteil diesen Angeboten sein Vertrauen schenkt. Schnell kann so eine Erscheinung zu Ende sein, wenn Jugendliche erwachsen geworden sind und kein interessierter Nachwuchs folgt. Ein Großteil der gerade unter Jugendlichen erfolgreichen gesellschaftlichen Arbeit erlebt immer wieder das Drama ihres Absturzes, das mitunter über Nacht auf den jeweiligen Robinson einbricht. Deutlich sieht man das an Teenie–Bands, die oftmals das Erwachsenwerden ihres Publikums nicht überstehen, wie man zuletzt bei den Bands „Echt“ und „Tokio Hotel“ miterleben konnte.
Abgesehen von Tonträgern (im Fall der Bands), produzieren alle genannten Arbeiten keine Waren im eigentlichen Sinne und sind dennoch in höchstem Maße an der gesellschaftlichen Gesamtproduktion beteiligt, weil sie wiederum direkten Einfluss auf das Konsumverhalten einer Gesellschaft haben und dadurch die Produktionen ganz immens beeinflussen, indem sie neue Bedürfnisse und Begehrlichkeiten wecken, beispielsweise in Mode oder Jugendkultur. Insofern produzieren sie die wichtigste aller Waren in unserer zeitgenössischen Gesellschaft, das »Must-have«, das aber, wie man weiß, jedes Jahr neu definiert wird. Gerade in diesen Formen zeitgenössischer Arbeit sieht man ganz besonders auch den individual- und sozialpsychologischen Aspekt, dem gesellschaftliche Arbeit unterliegt und wie schnell sie irrelevant werden kann, wenn die Sozialpsychologie zu mucken beginnt. Jetzt wird es womöglich einen Einwand geben, dass es durchaus evident scheint, dass das klassische Liberalismus–Modell von Angebot und Nachfrage als Grundlage der Bedürfnisbefriedigung die Produktion und Zirkulation regelt. Wenn man durch Szeneviertel flaniert, in denen die Robinsons und ihre Innovationen nur so aus dem Boden sprießen; wenn man sieht, wie oft gerade Szenegastronomien randvoll mit Gästen besetzt sind, dann kommt einem unweigerlich der Gedanke, dass es einfach zu sein scheint, mit der richtigen Idee, dem Cool Knowing (Angebot), eine regelrechte Goldgrube (Nachfrage) zu schaffen, wenn man nur richtige Begehrlichkeiten weckt, um damit den Place to be zu kreieren.
Szenegastronomien, beispielsweise, sind jedoch erst so erfolgreich, seitdem sich auch die Gesellschaftsstruktur geändert hat. Womöglich koinzidiert ihr Erfolg mit der Tatsache, dass es mehr Single-Haushalte gibt, dass nicht mehr soviel zuhause gekocht wird, dass man sich auswärts zu essen eher leisten kann, dass es einfach chic ist oder dass in Städten, wie beispielsweise Frankfurt, mehr und mehr Arbeitnehmer und Pendler anreisen, die mittags oder nach Feierabend diese Gastronomien aufsuchen. In einem eher ländlichen Umfeld – so kann man sich vorstellen – oder vielleicht noch vor zehn Jahren, wäre dieser Erfolg unter Umständen nicht möglich.
Eines vergessen deshalb Hirngespinste eines natürlichen Wertes qua Entäußerung zum Ziele der allgemeinen Bedürfnisbefriedigung und einer Marktregulierung über Angebot und Nachfrage, und das sind die gesellschaftlichen Strukturen, die eine Privatarbeit in die Vergleichsform der gesellschaftlichen Arbeit aufnehmen, und warum das auch scheitern kann, mitunter sogar willkürlich. Sie können weder erklären, warum ein Laden die besagte Goldgrube wird, ein anderer aber an einem vergleichbaren Standort (Attraktivität, Bevölkerungsstruktur, Betriebsausgaben) nach kürzester Zeit schließen muss. Sie können nicht erklären, warum ein Club sich über zwanzig Jahre halten kann, obwohl die Clubkultur schon oft totgesagt wurde, ein anderer nach kürzester Zeit wieder schließen muss, obwohl er in allen Szenemagazinen als der heiße Scheiß beworben wurde. Sie können nicht erklären, warum ein und derselbe DJ in einem Club die Massen anzieht, in einem anderen, gerade mal wenige Kilometer entfernt, vor einer halbvollen Tanzfläche spielt. Und diese Hirngespinste interessieren sich noch viel weniger dafür, wie es hinter den Kulissen zugeht, um einen Laden oder eine Geschäftsidee überhaupt aufrechtzuerhalten.
All diese Gedanken sind aber wichtig, denn an jedem Szeneladen, jedem Club, jedem Designbüro, jedem Fotostudio hängen Arbeitsplätze, die im Zweifelsfall gefährdet sind. Und so kann der Liberale nicht erklären, warum gerade in der boomenden Kultur- und Kreativwirtschaft die Menschen mitunter in verheerenden prekarisierten Verhältnissen überleben; wie sie mit der so genannten weitergegebenen Unsicherheit leben müssen; wie sehr der Zwang, die neoliberale Charaktermaske aufzusetzen, bereits einige Robinsons übermannt hat, diese Strukturen in ihren Betrieb aufzunehmen; wie sehr die Werkvertrags- und Aushilfsbasis das widerspiegelt; wie manche mitunter ihre Arbeitskraft kostenlos anbieten, nur um weiterhin im Gespräch zu bleiben; wie oft Löhne am Ende des Abends gedrückt oder nicht ausbezahlt werden; wie oft man auf Abruf arbeitet und unverhofft heimgeschickt wird, wenn zu wenige zahlende Gäste da waren. Ein Liberaler kann also nicht glaubhaft erklären, warum bestimmte Hypes von heut auf morgen entstehen und wiederum vergehen. Er versteht nicht die Dramen, die sich hinter einem Erfolgsversuch verbergen; den täglichen Überlebenskampf, den Druck, im Gespräch zu bleiben, sich jederzeit neu erfinden zu müssen. Aber auch nicht die Dramen, wenn der Erfolg trotz harter Arbeit einfach nicht eintreten will.
Weshalb die Prekarisierung im Kulturbetrieb, die sexy Armut, nichts anderes ist, als die real gewordene Perversion des liberalen Arbeitsfetischs: »Robinson und der Arschtritt der Gesellschaft.«
Literatur
MEW 4 (1971), MARX, Karl: Beilagen zu Karl Marx, Das Elend der Philosophie: Brief an P. W. Annenkow, S. 547 – 557.
MEW 13 (1971), MARX, Karl: Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie, Berlin, S. 615 – 642.
MEW 23 (1962), ders: Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation, in: Das Kapital, Erster Band, Berlin, S. 741 - 791.
MEW 26.2 (1974): ders: Theorien über den Mehrwert, Berlin.
MEW 35 (1978), ENGELS, Friedrich: Ergänzung und Nachtrag zum III. Buche des »Kapital«, Berlin, S. 895 - 919.
MEW 40 (1983), MARX, Karl: Privateigentum und Kommunismus, in: Ökonomisch-philosophische Manuskripte, Berlin, S. 510 - 546.
MEW 42 (1974): ders: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Berlin.
ARENDT, Hannah (1981): Vita Activa oder vom tätigen Leben, München.
BÜTTNER, Hans-Peter, Die Nutzlosigkeit der neoklassischen Nutzenlehre. Eine Kritik der Grundlagen der subjektiven Werttheorie, Rote Ruhr Uni, http://www.rote-ruhr-uni.com/cms/IMG/pdf/Buttner_Die_Nutzlosigkeit_der_neoklassischen_Nutzenlehre.pdf
ELBE, Ingo: Soziale Form und Geschichte, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 2/2010, Berlin, S. 221 – 240.
FOUCAULT, MIchel (2006): Sicherheit, Territorium, Bevölkerung in: Geschichte der Gouvernementalität 1, Frankfurt am Main, Vorlesung 4, S. 134 - 172.
GESS, Christopher (2005): Kritik der Humankapitaltheorie, in: Kritiknetz – Zeitschrift für Kritische Theorie der Gesellschaft, https://psychosputnik.wordpress.com/2016/05/06/13937/
HEGEL, G.W.F. (1986): Grundlinien der Philosophie des Rechts, in: Werke 7, Frankfurt am Main, § 244.
HEINRICH, Michael: Monetäre Werttheorie. Geld und Krise bei Marx in: PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft, Heft 123, 31.Jg., 2001, Nr.2, S.151-176, hier: http://www.oekonomiekritik.de/306Monetaere-Werttheorie.htm
HEINRICH, Michael (2005): Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung, Stuttgart.
KANT, Immanuel (1977): Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, in: Werkausgabe Band XI, Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pädagogik 1, Frankfurt am Main, S. 33 – 50.
METZGER, Philipp: Werttheorie des Postoperaismus. Eine Kritik an der postoperaistischen Interpretation des Marx’schen Wertgesetzes, in: PHASE 2, Zeitschrift gegen die Realität, http://phase-zwei.org/hefte/artikel/werttheorie-des-postoperaismus-63/
PFREUNDSCHUH, Wolfram: Grenznutzentheorie, http://kulturkritik.net/begriffe/begr_txt.php?lex=grenznutzentheorie
POSTONE, Moishe (2003): Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Herrschaft, Freiburg.
RICARDO, David (2006): Über die Grundsätze der politischen Ökonomie und der Besteuerung, Marburg.
SMITH, Adam (1999): Der Wohlstand der Nationen. Eine Untersuchung seiner Natur und seiner Ursachen, München.
0 notes