#Buch-Klassiker des 19. Jahrhunderts
Explore tagged Tumblr posts
Text
Buch-Klassiker des 19. Jahrhunderts #4: Jeremias Gotthelf - Die schwarze Spinne. Und andere Erzählungen.
Jeremias Gotthelf - Die schwarze Spinne. Und andere Erzählungen. #werkausgabe #diogenesverlag #schweiz #literatur #novelle #lesejahr2024 #lesen #buch #bücher #empfehlung
Zeitlos und bei gewissen Themen immer noch oder wieder top-aktuell – die Erzählungen und Romane des Schweizer Autors Jeremias Gotthelf (1797 – 1854), dessen Werk jetzt in einer schönen Neuausgabe im Diogenes Verlag (wieder) entdeckt werden kann. Den Auftakt bildete ein Band mit seiner bekanntesten Erzählung “Die schwarze Spinne”… Continue reading Buch-Klassiker des 19. Jahrhunderts #4: Jeremias…
#Bücher#Biedermeier#Buch#Buch-Klassiker des 19. Jahrhunderts#Buchbesprechung#Die schwarze Spinne#Diogenes Verlag#Frank Castorf#Jeremias Gotthelf#Kritik#Lesen#Nora Gomringer#Philipp Theisohn#Realismus#Rezension#Roman#Romantik#Schullektüre#Schweiz
1 note
·
View note
Text
0 notes
Text
Jules Verne - Reise zum Mittelpunkt der Erde

Inhalt:
Hamburg im Jahr 1864. Als Otto Lidenbrock, Professor für Mineralogie und Geologie eines Tages mit einem alten Manuskript heimkehrt, ahnt sein Neffe und Protagonist des Romans Axel noch nicht, dass ihn ein darin befindliches Stück Pergament bald auf die abenteuerlichste Reise seines Lebens führen wird.
Nur wenige Wochen nach dieser Entdeckung erreichen die Beiden Abenteurer, der eine voller Tatendrang, der andere eher unfreiwillig mit von der Partie, das ferne Island, wo das Undenkbare im Schatten eines Vulkans verborgen liegen soll: Der Weg zum Mittelpunkt der Erde.
Eine Welt außerhalb jeder Vorstellungskraft wartet auf die Reisenden. Dunkelheit, Gefahren, surreale Landschaften und Lebensformen.
Im Roman erwähnt Jules Verne häufiger die sogenannte “Ruhmkorff-Lampe”, die den Figuren Licht spendet. Eine Lampe, die auf eine Erfindung Heinrich Daniel Ruhmkorffs basiert, wurde tatsächlich Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt und vertrieben. Noch heute kann man einige der Lampen in Museen bestaunen, allerdings waren sie für den Massengebrauch zu teuer und zu schwer und setzten sich daher nie durch.
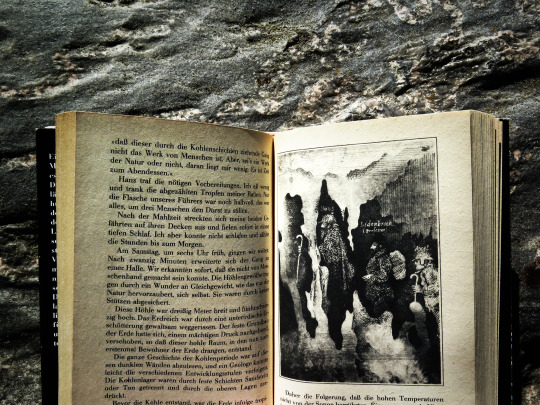
Meinung:
Der 1864 erschienene Roman „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“ ist eines der frühen Werke Jules Vernes und zugleich eine der bekanntesten Geschichten des Autors, die vielfach zitiert und verfilmt wurde.
Die Reise beginnt im Hamburg des 19. Jahrhunderts, dort leben die Protagonisten Professor Lidenbrock und sein Neffe Axel. Aus der Ich-Perspektive berichtet der eher häusliche und zurückhaltende Axel vom Fund eines alten Stück Papiers, das Onkel und Neffe letztendlich zu ihrer abenteuerlichen Reise veranlassen wird. Die Erzählung lässt sich gerade zu Beginn viel Zeit und gut ein Drittel des Buches benötigen die Figuren, ehe sie überhaupt ins Erdinnere vorstoßen. Danach geht die Geschichte jedoch weitaus zügiger voran und hätte an manchen Stellen sogar etwas ausführlicher sein dürfen. Gerade die außergewöhnlichen Entdeckungen tief im Inneren der Erde wurden teilweise nur kurz beschrieben, ehe die Reise auch schon wieder weiter vorangetrieben wurde.
Die wissenschaftlichen Erklärungen des Autors sind bei diesem Roman noch weitaus kürzer geraten, als beispielsweise beim später erschienenen „Von der Erde zum Mond“. Interessante Informationen über Geologie, Flora und Fauna und die eigentliche Handlung sind gut ausbalanciert und lassen die Welt unter der Erde umso glaubwürdiger und lebendiger erscheinen.
Im Gegensatz dazu wirken die Figuren fast wie Parodien und sind derart stereotypisch, dass ich oftmals schmunzeln musste. Professor Lidenbrock ist zwar wissensdurstig und voller Abenteurergeist wie einst Alexander Humboldt aber auch emotionsarm, unverbesserlich und stur wie ein Esel. Der Isländer Hans, der die Beiden auf die Reise begleitet ist hingegen wortkarg, von einfachem Gemüt aber unerschütterlicher Loyalität und der Mann für alles, es gibt nichts was der starke Isländer nicht mit seinen Händen vollbringen könnte.
Wer also tiefgründige, gut ausgearbeitete Charaktere erwartet, wird mit diesem Roman nicht glücklich aber man darf auch nicht vergessen, dass „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“ ein Abenteuerroman ist, der in allererster Linie unterhalten soll. Und das tut er außerordentlich gut. Die, heute zum Teil veralteten, Informationen sind nicht nur lehrreich, sondern manchmal auch skurril und witzig. Gerade die Beschreibungen der prähistorischen Lebensformen sollte man sich nicht entgehen lassen.
Der nur 235 Seiten umfassende Klassiker ist wirklich lesenswert, ich habe die Reise zum Mittelpunkt der Erde keinesfalls bereut.
1861 besuchte Jules Verne im Zuge einer Skandinavien-Reise gemeinsam mit zwei Freunden Hamburg und verbrachte dort eine Nacht in einem Hotel. Sie besichtigten die alte Hansestadt und vielleicht kamen sie während ihres Spaziergangs auch an der Königsstraße 19 vorbei, in der “Die Reise zum Mittelpunkt der Erde�� ihren Anfang nimmt.
Text: Aki
Auszüge aus Jules Verne »Von der Erde zum Mond« sowie »Reise zum Mittelpunkt der Erde«, mit freundlicher Genehmigung Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage, Berlin 2020.
Ebenfalls im Verlag erschienen:
https://www.eulenspiegel.com/verlage/neues-leben/titel/die-kinder-des-kapitaen-grant.html
Impressum: https://post-vom-buecherwurm.tumblr.com/post/620367072772407296/impressum
#bücherwurm#bücherwelt#bücher#leseliebe#lesenistschön#lesenmachtglücklich#booktography#buchblogger#bookblock#bücherblog#buchrezension#jules verne
1 note
·
View note
Text
Ratschläge, die niemand braucht
Den Anstoß zum heutigen Blogartikel gab ein Twitterkommentar, der mir vor ein paar Monaten in meine Timeline gespült wurde.
In diesem ging es darum, wie man als Autor etwas, das plötzlich passiert, beschreiben, einleiten könnte, und es wurde bemerkt, dass eine Figur, die mitten in dem Geschehen ist, dieses nicht mit Worten wie „Plötzlich“, „Aus dem Nichts“ und anderen „Füllwörtern“ einleiten würde, da es für diese Figur einfach so passiert. Lediglich ein Erzähler mit Distanz wäre in der Lage die Dinge als „plötzlich“ zu definieren, da er genug Abstand zum Geschehen hätte. Wolle man also aus Sicht einer Figur, die sich mitten im Geschehen befindet schreiben, gelte es solche Formulierungen zu vermeiden, die im Übrigen ohnehin Füllwörter und daher eh zu vermeiden seien, als hätten sie die Pest.
Nun ist es so, dass das nicht der erste und einzige solcher Tipps war, die ich in meine Timeline gespült bekomme. Ich finde immer wieder solche Perlen, nicht zuletzt, weil ich auf Twitter vielen anderen Autoren / Autorinnen und Lektoren und Lektorinnen folge, die eben die Angewohnheit haben ihre neuesten Weisheiten und Feststellungen vor großem Publikum zeigen zu wollen, was menschlich verständlich sein mag, es aber nicht weniger nervig macht.
Und auch in diversen Schreibratgebern habe ich ähnliches zu allen möglichen Aspekten rund um das Schreiben lesen können. Angefangen davon, wann man wie viel Schreiben sollte, bis hin zu dem berühmt berüchtigten „Show don´t tell“ - Hinweis, der nicht totzukriegen zu sein scheint, was schade ist, denn gerade die Werke, die wir als Klassiker bezeichnen machen alles andere, als diesem Hinweis zu folgen.
Was allen gemeinsam ist, ob sie nun in meiner Timeline auftauchen oder ob ich sie in einem Ratgeber lesen muss, ist Folgendes:
1. Sie nerven
2. Sie sind meist in einem sehr einschüchternen Tonfall gehalten
3. Sie machen auf (vermeintliche) Fehler aufmerksam, mehr aber auch nicht
Daher kann man mit dieser Art von Ratschlägen alles Mögliche machen. Vor allem aber sollte man dankend auf sie verzichten.
Warum?
Ganz einfach, weil sie nicht helfen.
Doch betrachten wir das ganze doch mal im Detail.
Gehen wir zu Punkt 2: Der Tonfall
Ich habe nie verstanden, warum Ratschläge unbedingt in einem so großkotzigen Ton geliefert werden müssen. Wird irgendetwas besser, bekommt es mehr Gewicht und Überzeugungskraft, wenn es von oben herab mit viel Druck geäußert wird? Mich macht das eher misstrauisch. Ich beginne mich zu fragen, ob ich da nicht zu meinem Glück gezwungen werden soll und ob dieses Glück überhaupt mein Glück ist. Bei genauer Betrachtung muss ich sagen in den meisten Fällen ist es das nicht und das ist auch gut so.
One man´s meat is another man´s poison
Literatur ist ein sehr subjektives Ding. Was dem einen gefällt, wird der andere nicht mögen und das ist in Ordnung, sonst wäre die Welt ziemlich langweilig. Doch wenn dem so ist, warum sollten wir dann überhaupt noch allgemein verpflichtende Ge- und Verbote in Sachen Schreiben aussprechen? Warum sollten wir nicht alle so schreiben, wie uns der Schnabel gewachsen ist? Was soll der ganze Humbug von wegen Show don´t tell?
Ich weiß es nicht.
Alles, was ich nach all den Jahren habe feststellen können ist, dass die Literatur, ebenso wie zum Beispiel die Mode, Veränderungen unterworfen ist.
Das, was im 18. und 19. Jahrhundert noch als schick galt, gilt heute nichts mehr. Und in der Literatur war das eben dieses show don´t tell. Jane Austen, von der die meisten Romanschreiberinnen seufzend schwärmen, hat sich massiv des Tells bedient. Ebenso George Eliot die gerade auf meinem Schreibtisch liegt. Beide Damen sind keine Groschenheftschreiberinnen sondern anerkannte Klassiker der englischen Literatur. Also, warum nicht einfach machen, was Jane und George gemacht haben, wenn einem danach ist? Nur weil irgendwer das auf Twitter sagt? Immerhin verkaufen sich beide Damen auch heute noch.
Sag mir nicht nur wo, sondern auch was
Doch kommen wir zum nächsten Punkt meiner Kritik.
Ratschläge wie oben zeigen einen (vermeintlichen) Fehler auf, mehr nicht und sind damit nicht hilfreich.
Ich habe mich in einigen meiner Artikel mit Kritik auseinandergesetzt und gezeigt, was hilfreiche von nicht hilfreicher Kritik unterscheidet und dabei kann man sagen, dass Kritik, die bemängelt, aber nicht sagt, wie man den Fehler beheben könnte, nicht hilfreiche und daher nicht notwendig ist. Sie wird einen nicht weiter bringen, sondern nur Kopfschmerzen bereiten.
I gave it up – the reading
Sehr oft sieht man diese Art von Kritik auch in Schreibratgebern, oft in zwei unterschiedlichen Ausführungen, wenn wir es Ausführung nennen wollen.
Zum einen gibt es die Ausführung, welche komplett ohne Textbeispiel auskommt und einfach nur aufzählt, was man nicht machen sollte. Diese halte ich für die Schlimmste. Und dann gibt es die zweite Ausführung, bei der sich der Autor etwas mehr Mühe gemacht hat, weil die Ratschläge, die Kritik, anhand von Textbeispielen verdeutlicht werden sollen. Unter oder neben dem Text findet der Leser dann eine Aufzählung all der Punkte, die an dem Textbeispiel angeblich vermeidbar gewesen wären und, wenn es ein besonders guter Ratgeber ist, im Anschluss ein Textbeispiel, das sehr gut gelungen ist, weil es alle eben angesprochenen, kritisierten Punkte nicht enthält. Oder enthält. Je nachdem, was gefragt ist. Allerdings liegt da der Fehler der Ratgeber. Oft sind es zwei verschiedene Beispiele, die gegeben werden.
Anstatt dem Leser eine Art Vorher / Nachher Vergleich zu präsentieren, wird anhand von zwei unterschiedlichen Texten gezeigt, wie man es machen sollte. Für den Leser und Ratsuchenden ist es nicht möglich nachzuvollziehen, wie der „schlechte Text“ aussähe, würde man all die eben gegebenen Ratschläge anwenden. Wie soll man da vergleichen? Wie soll man da abschätzen können, wie groß die Auswirkungen tatsächlich auf den Text wären, würde man die Ratschläge anwenden, die in Textbeispiel eins gegeben wurden? Warum hat man nicht einfach das erste Beispiel genommen und all das angewandt, was man kritisiert hat, um zu zeigen, wie es eben nachher aussieht? Verwirrend, aber nicht hilfreich. Daher habe ich es aufgeben solche Ratgeber zu lesen und verlasse mich auf mein Bauchgefühl.
Ausweg
Ich denke, mit dem Schreiben ist es ein wenig wie mit dem Kochen.
Es gibt Leute, die können aus einem willkürlichen Haufen Reste im Kühlschrank ein essbares, sogar schmackhaftes Abendessen machen.
Und dann gibt es mich. Und was ich daraus machen kann wollen wir nicht wissen, weil das nicht mal die Katze essen würde und man es vermutlich auf dem Sondermüll entsorgen müsste.
Ich kann nur dann Kochen, wenn ich ein Rezept und alle Zutaten dafür habe. Improvisieren ist beim Kochen nicht möglich.
Für das Schreiben gilt das Gleiche.
Es gibt Leute, die haben es einfach drauf. Die können in den Kühlschrank der Inspiration und Literatur gucken, ziehen scheinbar wahllos Sachen daraus hervor, halten sich keinen deut an irgendwelche Rezepte und es kommt ein Drei Gänge Menü dabei heraus, dass man der Queen vorsetzen könnte. Solche Leute haben das Stadium ein Rezept zum Kochen zu brauchen überschritten. Sie wissen, was sie tun, haben ein Bauchgefühl, was zusammen passt und was nicht. Und dann gibt es die, die sich noch sklavisch an das Kochbuch halten müssen, weil sie es allein nicht hinbekämen, weil sie eben nicht das Bauchgefühl haben, dass sie von den Improvisationskünstlern unterscheidet.
Die Frage, die ihr also für euch klären müsst ist, wollt ihr aus dem Bauch heraus schreiben? Könnt ihr aus dem Bauch heraus schreiben? Und wenn nein, welche Art von Kochbuch wollt ihr haben? Eines in dem die Hälfte des Rezepts, auf das ihr angewiesen seid, nur angedeutet wird? Eines, bei dem man die Hälfte dessen, was in das Gericht kommen soll nicht finden kann, weil es in einem anderen Buch in einem anderen Rezept erklärt wird? Wir haben so ein Kochbuch hier zu Hause und ich halte es für den größten Fehlkauf schlechthin.
Also, lernt gute Kritik, gute Ratschläge von schlechten zu unterscheiden, damit Kritik euch weiterbringen kann, anstatt nur herunterzuziehen!
10 notes
·
View notes
Text
Lesestatistik für 2019
2019 habe ich…
130 Bücher verschlungen
13 Bücher abgebrochen (diese Zahl wird jedes Jahr höher)
6 Bücher gerereadet
Die 130 Bücher lassen sich nach folgenden Kriterien unterteilen:

Ich bin dann jetzt wohl wirklich erwachsen? Jugendbücher reizen mich im Vergleich zu früher immer weniger, weil die meisten sich inhaltlich immer wieder mit den gleichen Themen auseinandersetzen. Gleichzeitig kenne ich mich im Adult-Bereich noch lange nicht so gut aus wie bei YA, da ist die Vielfalt für mich also noch größer.


Die deutschen Bücher haben 2019 zugenommen, vermutlich weil ich das ganze Jahr BookBeat genutzt habe und einen größeren Zugang zu deutschen Hörbüchern hatte. Genau die Hälfte der deutschen Titel, 23, sind original deutschsprachige Veröffentlichungen. 11 der Übersetzungen, etwas weniger als die Hälfte, stammen nicht aus dem Englischen, sondern aus dem Schwedischen (4 Titel), Norwegischen, Russischen, Tschechischen, Arabischen, Italienischen, Französischem und Japanischem. Bei manchen hat die Unilektüre mitgeholfen.

Da ich schon seit einigen Jahren keine eBooks mehr kaufe und immer mehr das Interesse an den ungelesenen, die ich noch habe, verliere, ist der kleine eBook-Bruchteil keine Überraschung. Und dass ich viele Hörbücher höre, dürfte auch niemanden mehr verwundern.

Ich bin immer überrascht davon, wie groß der Contemporary-Anteil (dazu zählt auch Literary Fiction) meiner gelesenen Genres ist und wie klein der von Fantasy, gefühlt lese ich das andersherum. Außerdem hätte ich nicht gedacht, dass ich so viel Non-Fiction gelesen habe.

Es hat tatsächlich kein Buch nur ein Stern/Herz/Schweinchen bekommen. Wenn ich mir die 1,5-Kandidatinnen betrachte (Motherhood und Die Geschichte der Bienen) könnte ich das aber noch redigieren. Ansonsten wäre es natürlich schön, wenn sich der 3-Sterne-Balken 2020 weiter nach rechts verschieben würde. Ich muss wohl mehr durchschnittliche Bücher vorzeitig abbrechen.
Kommen wir zu den Autor*innen...

Letztes Jahr sah dieses Verhältnis noch deutlich ausgeglichener aus, mir gefällt es mit deutlich mehr weiblichen Verfasserinnen auf jeden Fall sehr gut.

2019 habe ich mal festgehalten, woher die Bücher, die ich lese eigentlich kommen (festgemacht an der Nationalität der Autor*innen). Das hat mir vor Augen geführt, wie einseitig meine Auswahl der Mengenverteilung nach ist, wobei sie immerhin 19 verschiedene Länder auf 5 Kontinenten umfasst.

Passend zu den Ländern habe ich auch geschaut, wie vielfältig meine gelesenen Autor*innen im Bezug auf Race aufgestellt sind. Der weiße Anteil ist mir zu hoch und darauf würde ich 2020 bei der Auswahl der nächsten Lektüre gern mehr achten.

Das Verhältnis ist fast identisch mit dem aus dem Vorjahr und für mich genau richtig: ein paar Klassiker hier und da, das reicht mir

Ich glaube im Vorjahr war alles vor den 2000ern zwar auch niedrig, aber etwas mehr vertreten. Ich lese einfach am liebsten aus dem 21. Jahrhundert, gleichzeitig würde ich hier gern etwas mehr Vielfalt sehen. Vielleicht sollte ich mir noch mal eine Dekaden-Challenge überlegen.
Kommen wir jetzt zu meinen Neuzugängen. Ich habe 88 Bücher dazu bekommen und etwas über 400€ für Bücher ausgegeben. Die Zahlen sind im Vergleich zum Vorjahr beide etwas gesunken, weil ich zum einen mehr auf meine Ausgaben geachtet habe (aber trotzdem von Familie und Freundinnen immer reich beschenkt werde) und zum anderen weil ich meine BookBeat-Abo-Kosten hier nicht dazu zähle (die gehörten Bücher allerdings auch nicht als Neuzugänge verzeichne).

Aufgrund des BookBeat-Abos ist auch der Kauf von Hörbüchern ein ganzes Stück zurückgegangen. Die 3, die ich gekauft habe, sind Audible-Credits und das eine eBook war übrigens ein Unibuch.

Dass Thalia so weit vor Amazon liegt, ist zwar schön, aber eigentlich würde ich gern noch mehr im unabhängigen Buchhandel kaufen, obwohl die Bilanz ja gar nicht so schlecht ist. Es sind die unschlagbaren Preise und Rabattaktionen (Buchpreisbindung zählt ja nicht für englische Bücher), die mich doch immer zum Konzernriesen Thalia zurücklocken. Hier sieht ihr außerdem ganz gut, wie großzügig meine Schenker*innen immer zu mir sind.

Ich wünschte diese Balken wären dichter beieinander. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich die meisten Bücher zum Geburtstag Ende November und an Weihnachten geschenkt bekomme. Ich hab also kaum die Chance sie im gleichen Jahr noch schnell zu lesen. Da entsteht dann immer die größte Diskrepanz.
Erzählt mal, hat euch etwas aus meiner Statistik total überrascht? Oder führt ihr sogar selbst Statistik und konntet euren Zahlen kaum glauben?
5 notes
·
View notes
Photo

Ein Klassiker der «Candid Camera»: Ninalee Craig spaziert 1951 durch Florenz, und ihre Freundin, die Fotografin Ruth Orkin, beobachtet, was passiert. Üblicherweise ist die Hand im Schritt des erfreuten Kommentators (Bildmitte) wegretuschiert, in Zürich ist das Original zu sehen. (Bild: Ruth Orkin)
Es gibt keinen geschlechtstypischen Blick in der Fotografie. Aber eine Tendenz: Wenn Frauen fotografieren, fotografieren sie das Andere
Frauen haben die Fotografie emanzipiert, und die Fotografie hat einen wesentlichen Beitrag zur ihrer eigenen Emanzipation geleistet. Zwischen dem Medium und den Künstlerinnen bestand seit je eine besondere Beziehung. Doch die Fotogeschichte will davon nichts wissen.
Daniele Muscionico07.04.2019, 18.00 UhrHörenMerkenDruckenTeilen
Die Fotografie galt als Beleidigung der hohen Kunst. Man schimpfte sie Muttermörderin in Bezug auf die Malerei, diese Händlerin des einzigartigen, handgefertigten Originals; Fotografie schien die Räuberin alles Menschlichen überhaupt: Raubte sie denn nicht Seelen, als Mitte des 19. Jahrhunderts ein Automat Menschen kopierte, als hätte ein Geschlechtsakt mit der Luft stattgefunden?
Die Fotografie gilt seit ihrer technischen Erfindung als minderbemittelte Verwandte der schönen Künste. Denn anders als die Kunstgegenstände vordemokratischer Epochen setzten Fotografien nicht die Intentionen eines wie auch immer gearteten Künstlers oder einer Künstlerin voraus. Im Märchen von der Fotografie bürgt der Zauberkasten selbst für Wahrheit und Wahrhaftigkeit, er verbannt den Irrtum, wiegt Unerfahrenheit auf und belohnt das Unwissen.
Der Meister persönlich, Henri Cartier-Bresson, prägte den schillernden Begriff vom Fotografen als Zen-Bogenschützen, der selbst zum Ziel werden muss, wenn er treffen will: «Das Denken sollte vorher oder nachher stattfinden», sagte er, «niemals jedoch unmittelbar während des Fotografierens.» Denken galt als Bewusstseinstrübung.
Foto auf Seide, ein Weltpatent
An diesem ambivalenten Punkt kommt die Leistung der Frauen für die Fotografie ins Spiel. Man musste als Fotografin offenbar nicht denken können, verfügte jedoch über geschlechtstypisch weibliches Geschick und Geduld. Schon zu Beginn schien das neue Medium ein idealer Zeitvertreib für stickende und aquarellierende Salon-Geschöpfe.
Die Französin Louise Laffon etwa fertigte fotografische Jagdstücke auf Seide und Satin an und erhielt dafür nicht nur ein Patent, sondern auf der Pariser Weltausstellung 1867 auch prompt eine anerkennende Erwähnung. Besassen Frauen mit der Fotografie folglich den Schlüssel, um den Geschlechterkäfig zu öffnen?
Die Wahrheit lautet anders: Mit der Erfindung der Fotografie entdeckten Frauen zwar ein Medium der Emanzipation. Sie okkupierten ein Gelände, das lange in Verruf stand. Doch sie besetzten ein Terrain, das ohne Bedeutung und ohne Einfluss keine Bedrohung für den männlichen Kunstbetrieb darstellte. Dennoch bevorzugte die einzige Frau, die als Fotokritikerin im Frankreich des 19. Jahrhunderts bis heute bekannt ist, die Anonymität und signierte mit einem Pseudonym, «Pascaline». Das Pariser Musée d’Orsay fragte noch 2016 mit einer Ausstellung ihre Landsleute gewiss nicht zufällig: «Qui a peur des femmes photographes?»
Britische Volkszählungen zeigten allerdings, dass in England bereits 1901 auf drei männliche Fotografen eine Berufsfotografin kam. Und das zu einer Zeit, in der es für Frauen ungewöhnlich war, überhaupt einer bezahlten Arbeit nachzugehen. Die Firma Kodak ihrerseits erfand das «Kodak Girl» und etablierte 1893 die Hausfrau, Mutter, die Familienchronistin als Zielgruppe für ihre Werbekampagnen.
10 Bilder
Die Österreicherin Inge Morath war eine der seltenen Fotografinnen, die Einsitz hatten und haben in der Agentur Magnum. Morath begann ihre Arbeit bei Magnum als Sekretärin. «Dancer's skirt at a fair Sevilla», 1987. (Bild: Inge Morath / Magnum)
Es waren amerikanische Fotografinnen, die die weibliche Perspektive der Fotografie vorantrieben. Sie hatten einen Mittelweg zwischen Kunst und Kommerz gefunden und unternahmen einiges, um ihre Geschlechtsgenossinnen zu motivieren: Frances Benjamin Johnston verfasste ihren Artikel «What a Woman Can do With a Camera» bereits 1897. Imogen Cunningham dachte 1913 schon um einiges weiter und bezeichnete «Photography as a Profession for Women». Dass selbst etablierte Fotografinnen als Musen ihren Mentoren mitunter ehrerbietige Biografien widmeten, ist umgekehrt nicht denkbar. Hätte Man Ray je über Lee Miller geschrieben, ein Alfred Stieglitz über Dorothy Norman?
Die Bedeutung der Frauen für die Fotografie, nicht nur im privaten Kontext, sondern als ernsthafte Künstlerinnen, ist bis heute ein vernachlässigtes Forschungsgebiet. Die Ausstellung «#Womenphotographer vol. I» in der Zürcher Photobastei erinnert daran. Die Kuratorinnen Gisela Kayser und Katharina Mouratidi führen wichtige weibliche Positionen des 20. Jahrhunderts zusammen, ohne dabei der Kurzsichtigkeit zu erliegen, einen geschlechtstypischen Blick zu behaupten. Es gibt ihn nicht, wird im Gegenteil suggeriert, doch es gibt eine Vielzahl unbekannter weiblicher Beiträge zur Entwicklung und Sehweise der Fotografie, wie wir sie heute kennen.
Eine Tendenz jedoch fällt auf: Wenn Frauen fotografieren, fotografieren sie das Andere. Diane Arbus ist der Prototyp. Im Gefühl der Aussenseiterin fällt ihr Auge hinter der Kamera auf bürgerliche Freaks. Susan Sontag liess zwar an der Motivation von Arbus kaum ein gutes Haar. Sie verurteilte es, die Kamera als «moralischen Freipass» zu verstehen und sich wie die Künstlerin beweisen zu wollen, dass man den Schrecknissen des Lebens unzimperlich ins Auge sehen kann.
Anna Atkins bleibt im Dunkeln
Doch Frauen wollen dem Anderen Raum geben, zynisch nie, naiv vielleicht. Auch Nan Goldin und ihr Tagebuch einer sexuellen Abhängigkeit sind in Zürich zu sehen. Die Amerikanerin Merry Alpern wiederum verhält sich unweiblich mit ihren voyeuristischen Arbeiten mit versteckter Kamera, «Dirty Windows» und «Shopping». Mit einem Teleobjektiv fotografierte sie nahe der Wall Street ein illegales Bordell, Drogen, G-Strings, Dollars – ein Sexrausch. In Umkleidekabinen der Shoppingmalls ertappte sie bürgerlich frustrierte Damen bei einem ähnlich hemmungslosen Unternehmen – dem Kaufrausch.
Doch die wahren Pionierinnen zählen bis heute zu den Unsichtbaren. Wer kennt Anna Atkins? Nicht dem Briten Fox Talbot nämlich gebührt der Ruhm, die erste Fotografie veröffentlicht zu haben (in seinem legendär gewordenen Buch «The Pencil of Nature» mit dem Bild der Lacock Abbey). Eine Frau war vifer, schneller als ihr Lehrer und publizierte zwei Jahre vor diesem mit dem Bildband «British Algae: Cyanotype Impressions» (1843) zum ersten Mal Bilder, die mithilfe einer fotografischen Technik erstellt worden waren. Anna Atkins hat als Künstlerin und Botanikerin die Akzeptanz des neuen Mediums Fotografie für wissenschaftliche Illustrationen durchgesetzt. Wer sie heute prominent in Erinnerung rufen würde, der hätte für die Fotogeschichte etwas gewagt und geleistet.
#Womenphotographer vol. I, Photobastei Zürich, bis 5. Mai.
https://www.nzz.ch/feuilleton/die-photobastei-zeigt-in-womenphotographer-grosse-fotografinnen-ld.1473376
0 notes
Text

Ein #Buch, das ich noch #lesen will! 🤓📖📚
*unbeauftragte Werbung*
Zwischen all den Büchern im Regal wartet "Shirley" von Charlotte Brontë darauf gelesen zu werden. Ich freu mich schon seit Ewigkeiten darauf, diesen Klassiker lesen zu können. Immer kommt ein anderes Buch dazwischen. 😱🙈 Irgendwann ist es aber soweit, dann ist es fällig. 😏😄👍🏼
Über den Inhalt:
》"Shirley" ist 1849 erschienen und der 2. Roman der ältesten der Brontë-Schwestern über eine außergewöhnliche Frauenfigur. Vor dem Hintergrund der Arbeiterunruhen zur Zeit der wirtschaftlichen Depression am Beginn des 19. Jahrhunderts erzählt er die aufrüttelnde Geschichte der vermögenden und charakterstarken Gutsherrin Shirley Keeldar, die sich um der wahren Liebe willen entschlossen über die erstarrten Konventionen und den Standesdünkel ihrer Zeit hinwegsetzt.《
Kennt ihr den Roman? Lest ihr klassische Werke wie dieses?
#Autorin #leseratte #lesenistschön #lesenisttoll #lesenmachtglücklich #lesenistliebe #lesenlesenlesen #lesenverbindet #bücherwelt #anacondaverlag #klassischeliteratur #bookstagramdeutschland #booklover #bücherwurm #bücherliebe #charlottebronte #charlottebrontë #ichlese #autorenleben #autorenaufinstagram #hardcover #beautifulbooks #bookporn #bookgasm #cosyreading #Wichtelbarkeitschallenge #instabuch
0 notes
Text
"NEUGIERIG WIE EIN BIBER"
“BIOGRAPH MICHAEL W. JENNINGS ÜBER WALTER BENJAMIN
Walter Benjamin gilt mit Theodor W. Adorno, Max Horkheimer und Jürgen Habermas als eine der Säulen der Kritischen Theorie. Wir begegnen einem der beiden Biographen Benjamins, Michael W. Jennings. Er hat das Buch „A critical life“ gemeinsam mit Howard Eiland geschrieben und ist Hochschullehrer an der Princeton Universität und Chef des dortigen deutschen German Department.
Jennings zeigt die tiefe Verwurzelung Benjamins in seiner Kindheit und in Traditionen der Klassik. Das steht im Kontrast zu seiner Verschränkung mit der Moderne (Bauhaus, Moholy-Nagy, Hans Richter, bis hin zu Dada, Surrealismus, der neuen Sachlichkeit und anderen Strömungen der Moderne): Ein Mann zwischen den Zeiten. Seine Neugier und die Differenz in allem, dem er begegnet, katapultieren ihn gewissermaßen aus seiner Zeit in die Zukunft, sodass seine (oft unvollendeten) Arbeiten für unser 21. Jahrhundert von höchster Aktualität sind. Als Emigrant in Paris wird er 1940 vom deutschen Einmarsch überrollt. Er will über die Pyrenäen die USA erreichen. Als er glaubt, dass die spanischen Grenzbehörden, ihn an die deutschen Herrscher ausliefern werden, nimmt er sich das Leben.
Eine seiner bekanntesten Arbeiten ist das riesige „PASSAGEN-WERK“ (benannt nach den überdachten Einkaufsstraßen in Paris, der „Hauptstadt des 19. Jahrhunderts“, dem Domizil der „Warenwelt“). Das Werk ist ein Ausgangspunkt für die Weiterführung relevanter Theorie im 21. Jahrhundert. An keinem anderen Werk kann man die Kontinuitäten und scharfen Differenzen zwischen 19., 20. Und 21. Jahrhundert besser erkennen als an diesem. Es gilt die Denkansätze Benjamins entschieden fortzusetzen.”
https://www.dctp.tv/filme/neugierig-wie-ein-biber-newsstories-30092015
0 notes
Text
Neuverfilmung von "Heidi" als Free-TV-Premiere am 25.12 im ZDF
Neuverfilmung von #Heidi als Free-TV-Premiere am 25.12 im #ZDF
Die Heidi des schweizerischen Regisseurs Alain Gsponer ist wild und ungewaschen, das Leben in den Schweizer Bergen am Ende des 19. Jahrhunderts eher hart als romantisch. Das ZDF präsentiert die Neuverfilmung des Buch-Klassikers von Johanna Spyri, “Heidi”, am ersten Weihnachtsfeiertag, Dienstag, 25. Dezember 2018, 17.20 Uhr, als Free-TV-Premiere. Neben Bruno Ganz als Almöhi und Anuk Steffen als…
View On WordPress
0 notes
Text
Neuverfilmung von "Heidi" als Free-TV-Premiere am 25.12 im ZDF
Neuverfilmung von #Heidi als Free-TV-Premiere am 25.12 im #ZDF
Die Heidi des schweizerischen Regisseurs Alain Gsponer ist wild und ungewaschen, das Leben in den Schweizer Bergen am Ende des 19. Jahrhunderts eher hart als romantisch. Das ZDF präsentiert die Neuverfilmung des Buch-Klassikers von Johanna Spyri, “Heidi”, am ersten Weihnachtsfeiertag, Dienstag, 25. Dezember 2018, 17.20 Uhr, als Free-TV-Premiere. Neben Bruno Ganz als Almöhi und Anuk Steffen als…
View On WordPress
0 notes
Text
A–Z ǀ Deutsch — der Freitag
Neuer Beitrag veröffentlicht bei https://melby.de/a-z-%c7%80-deutsch-der-freitag/
A–Z ǀ Deutsch — der Freitag
A
Amerika Bis 1914 gab es in den USA Hunderte deutschsprachige Zeitungen und muttersprachlichen Unterricht für Kinder deutscher Auswanderer. Nach dem Kriegseintritt der USA 1917 wurde Deutsch sogar als Fremdsprache an höheren Schulen abgeschafft, und Präsident Woodrow Wilson verdächtigte Menschen, die sich als Deutsch-Amerikaner bezeichneten, nur illoyale „hyphenated Americans“ (Bindestrich-Amerikaner) zu sein. Den Bindestrich nannte Wilson einen Dolch, den die unzuverlässigen Elemente den USA in den Rücken stoßen würden. Es kam sogar zu Lynchjustiz: Zahlreiche „Germanisten“ wurden geteert und gefedert und der in Dresden geborene Gelegenheitsarbeiter und Sozialist Robert P. Prager von einem Mob als „Verräter“ gehenkt.
Die deutsche Sprache war damit in den USA nicht von einem Tag auf den anderen ausradiert (➝ Zukunft), doch sie erholte sich nie wieder von den Kampagnen in den Jahren 1917 und 1918.
B
Berlin Im Zuge der antigermanischen Hysterie kam es in den alliierten Ländern auch zu zahlreichen Umbenennungen. Am bekanntesten sind die Fälle von St. Petersburg, das auf Befehl des Zaren schon 1914 zu Petrograd wurde, und des englischen Königshauses Saxe-Coburg and Gotha, das seinen Namen 1917 zu Windsor änderte. Aber es gab viel mehr solcher Neu-Taufen. Australische Berge und Flüsse oder französische Straßen waren davon genauso betroffen wie amerikanisches Fastfood und bestimmte Hunderassen.
Erst ab 1917 setzte sich in den USA die Bezeichnung „Hot Dog“ gegen das ältere „Frankfurter“ durch. Der tragischste Fall ist Berlin in Kanada, das unter dem Druck (➝ Grabenkämpfe) einer als Besatzung in die Stadt gelegten Soldateska 1916 nach einer Volksabstimmungs-Farce in Kitchener umbenannt wurde.
E
Expansion Bis 1914 war Deutsch eine expandierende Sprache. Einerseits räumlich: Sie dehnte ihren Geltungsbereich im östlichen Europa (➝ Osten) immer weiter aus – teils durch mehr oder weniger freiwillige Assimilation, teils durch Zwangsmaßnahmen – und sie wurde in den afrikanischen und pazifischen Kolonien des Reichs an den Schulen gelehrt und in Pidgin-Varianten zur Kommunikation mit den Einheimischen genutzt.
Andererseits, was ihre Geltung in Wissenschaft und Kultur betraf: Nicht nur Wörter wie „Übermensch“, „Kindergarden“ oder „Zeitgeist“ im Englischen zeugen vom deutschen Kulturexport,sondern auch zahlreiche Fachausdrücke beispielsweise der Chemie und des Bergbaus. Durch den Ersten Weltkrieg wurde diese Ausbreitung gestoppt. Es begann, sowohl was die Verbreitung als auch was die Geltung des Deutschen betrifft, ein Schrumpfungsprozess, den wir gemeinhin erst mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Verbindung bringen. Kurzfristig profitierte davon das Französische, langfristig wurde der (auch durch andere Faktoren begünstigte) Aufstieg des Englischen zur globalen Lingua Franca eingeleitet.
G
Grabenkämpfe Wir benutzen heute noch viele Wörter, die im Ersten Weltkrieg geprägt wurden, oft ohne im Geringsten noch ihre vormalige militärische Bedeutung zu kennen: „Grabenkämpfe“ – heute meist als politische Metapher, „Burgfrieden“ für einen vorübergehend beigelegten Konflikt (Vorbild war das Stillhalteabkommen zwischen den Beharrungskräften des Kaiserreichs einerseits und der SPD andererseits nach Ausbruch des Krieges).
Aus dem U-Boot-Krieg (➝ Amerika) stammen „auf Tauchstation gehen“ und „abtauchen“. Der Luftkrieg hat uns „verfranzen“ fürs Verirren beschert, denn der für die Navigation zuständige Flieger wurde „Franz“ genannt.
H
Hochdeutsch Wenn heute Schweizer ihren Dialekt als nationales Symbol hochhalten und selbst in gebildeten Zirkeln (➝ Wissenschaft) des Landes ganz selbstverständlich Dialekt gepflegt wird, hat das auch mit dem Ersten Weltkrieg zu tun.
Vor allem in der Ostschweiz mit ihrer Metropole Zürich war Hochdeutsch als Umgangssprache um 1900 schon schier allgegenwärtig. Das änderte sich von 1914 an: Die zahlreichen deutschen Gastarbeiter, die die Sprachlandschaft der Eidgenossenschaft mitgeprägt hatten, kehrten ins Reich zurück. Und die Schweizer spürten das Bedürfnis, sich vom großen, aggressiven Nachbarn im Norden abzugrenzen. Es kam zur ersten „Mundartwelle“.
I
Italien Als Ergebnis der Niederlage Deutschlands und Österreichs gelangte ein Gebiet unter italienische Herrschaft, das seit dem Mittelalter von Bajuwaren besiedelt war und nie zu Italien gehört hatte: Südtirol. Die Annexion war das Ergebnis eines Geheimvertrages im Jahre 1915, mit dem Italien seinen Seitenwechsel aus dem Lager der Achsenmächte zu den Alliierten einleitete. Bald nach dem Krieg begann in Südtirol eine rabiate Italianisierungspolitik, die sich noch verschärfte, als 1922 Mussolinis Faschisten an die Macht kamen. Zahlreiche Orte und Berge, die nie zuvor italienische Namen getragen hatten, bekamen nun neue Bezeichnungen, und ganz allgemein sollte den Südtirolern die deutsche Sprache ausgetrieben werden. Wenn wir heute Speck aus dem Alto Adige essen, ahnen wir nicht, dass der Name „Oberetsch“ eine künstliche Schöpfung ist, die die Erinnerung daran auslöschen sollte, dass Tirol je zum deutschen Sprachraum gehörte.
K
Kafka Bei den Simpsons gibt es eine Halloween-Story, deren gruselige Handlung von Franz Kafkas Die Verwandlung inspiriert ist. Papa Homer verwandelt sich darin in ein Insekt. Am Schluss erscheint ein Schild, auf dem das Wort „konec“ steht, tschechisch für: „Ende“. Autor und Zeichner gingen davon aus, dass ein Schriftsteller, der in Prag lebte, auf Tschechisch geschrieben hätte. Dabei war Prag bis zum Kriegsende eine deutschsprachige Stadt gewesen: Hier residierten deutsche Kaiser (➝ Unserdeutsch), eine der ersten Bibelübersetzungen, die Wenzelsbibel, wurde hier angefertigt, und das Prager Deutsch galt lange Zeit als das schönste überhaupt. Tschechisch blieb lange zweitrangig, bis im 19. Jahrhundert der Sprachnationalismus aufflammte.
Auch nach der Unabhängigkeit der Tschechoslowakei blühte noch die deutsche Kultur in Prag – wie ja gerade das Beispiel Kafka beweist. Aber es begann die Entwicklung, die 1945 mit der Auslöschung des Deutschen dort endete.
O
Osten Der Osten Europas war vor dem Ersten Weltkrieg bis zur russischen Grenze Einflussgebiet (➝ Expansion) der deutschen Sprache. Das galt für das Deutsche Reich, wo in West- und Ostpreußen Deutsch Pflichtsprache war, wie auch für Österreich-Ungarn, wo Deutsch die Kommandosprache des Militärs oder die Sprache des Wiener Reichstags blieb.
Vorreiter der deutschen Kultur waren übrigens sehr häufig Juden. Der im ost-galizischen Brody geborene Joseph Roth rühmte sich noch um 1930, seine deutschen Klassiker besser zu kennen als die Anhänger Hitlers. Nach 1918 schrumpfte durch die Abtrennung Westpreußens und das Auseinanderfallen Österreich-Ungarns der Wirkungsbereich der deutschen Sprache im Osten erheblich.
S
Sarrazin August 1914: „Mit Urgewalt hat sich die Erkenntnis durchgerungen, daß die unverfälschte Muttersprache des Deutschtums festestes Band, seine vornehmste und stärkste Stütze, seine unerschütterliche Grundfeste ist!“ Das Volk stand auf, der Sturm brach los – der Sturm auch wider „die Schänder der deutschen Edelsprache, wider das alte Erbübel der deutschen Fremdtümelei, wider alle würdelose Ausländerei, wider Engländerei und Französelei“.
Verfasst hat die Tirade Otto Sarrazin, Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, der im Kriege seinen Kampf gegen Fremdwörter zur nationalen Raserei steigerte. Verdeutschungen (➝ Kafka) wie „Briefumschlag“ oder „Bahnsteig“ für „Couvert“ oder „Perron“ setzten sich erst in dieser Zeit durch.
U
Unserdeutsch Bis heute sprechen etwa 150 Menschen die einzige Kreolsprache auf der Basis des Deutschen. Das sogenannte Unserdeutsch entwickelte sich im Umfeld einer katholischen Missionsschule in Rabaul in der Kolonie Kaiser-Wilhelmsland (heute Neuguinea). Dort wurden vor allem gemischtrassige Kinder unterrichtet. Da diese weder bei Weißen noch bei Papuas angesehen waren, heirateten sie oft untereinander und gaben ihr spezielles Deutsch als Muttersprache an ihre Kinder weiter. Nach der Unabhängigkeit Neuguineas gingen fast alle Unserdeutsch-Sprecher nach Ostaustralien, wo ein Germanist (➝ Wissenschaft) um 1970 diese bis dahin unbekannte Sonderform des Deutschen entdeckte.
W
Wissenschaft Bis 1914 war Deutsch eine Weltsprache der Wissenschaft. Die Höchstleistungen deutschsprachiger Forscher in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und der Ruhm deutscher und österreichischer Universitäten hatten ihm diese Stellung beschert. Zwar konkurrierte es mit der alten Wissenschaftssprache Französisch und dem aufsteigenden Englisch,aber es gab weite Bereiche der Naturwissenschaften, in denen die wichtigsten Zeitschriften alle deutschsprachig waren und Deutschkenntnisse (➝ Hochdeutsch) unerlässlich.
Der russische Begründer des Behaviorismus, Iwan P. Pawlow, der später durch seine konditionierten Hunde sprichwörtlich wurde, stieg erst zum Nobelpreiskandidaten auf, als 1898 sein Buch Die Arbeit der Verdauungsdrüsen ins Deutsche übersetzt wurde. Nach dem Ersten Weltkrieg erschütterten lang anhaltende Boykotte, die vor allem von Franzosen und Engländern organisiert wurden, die Stellung des Deutschen als Wissenschaftssprache erstmals nachhaltig.
Z
Zukunft Ohne den Ersten Weltkrieg hätte die Zukunft des Deutschen nach 1914 anders ausgesehen. Vielleicht würde in vielen Gegenden Osteuropas heute noch Deutsch gesprochen, denn der Zweite Weltkrieg, der nach 1945 zur Vertreibung der Deutschen von dort führte, war ja eine Folgeerscheinung des Ersten.
Vielleicht gäbe es nicht nur in Namibia eine eigenständige Variante des Deutschen, sondern es existierten auch andere Kolonialdeutschs, die wiederum auf die Sprache in Deutschland zurückwirken würden, wie es die „Englishes of the world“ auf die Sprache in Großbritannien tun. Möglicherweise gäbe es einen deutschsprachigen Literaturnobelpreisträger aus Papua-Neuguinea, Prager Deutsch gälte immer noch als vorbildlich, und Jugendliche würden hierzulande den Jargon deutschsprachiger Rapper aus Togo oder Kamerun imitieren.
der Freitag Matthias Heine Quelle
قالب وردپرس
0 notes