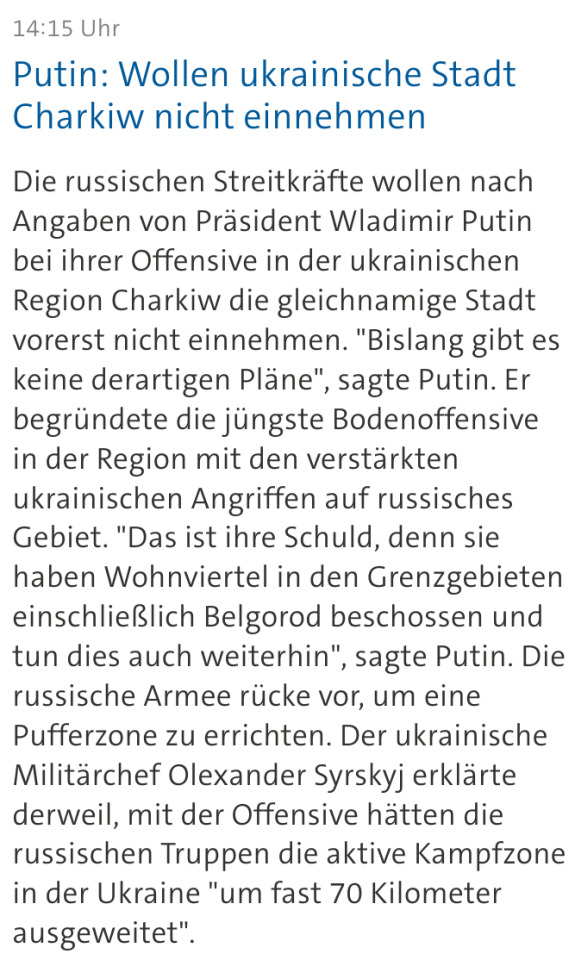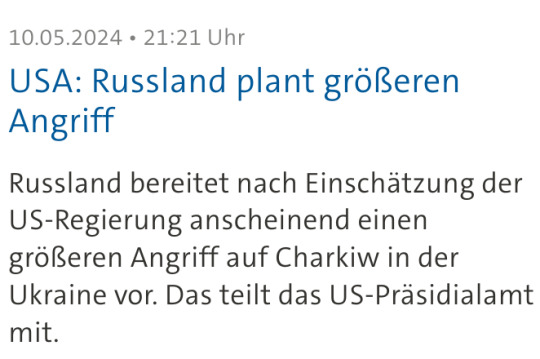#charkiw
Text


Charkiv 2024
©lennart laberenz
189 notes
·
View notes
Text
Bis September 2021 wurde der Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf für Jahrzehnte von der CDU "regiert". Entsprechend schnarchig ging es da auch zu. Das hat sich seitdem gebessert. Nun gilt es abzuwarten, was nach der erneuten Wahl im Februar 2023 passiert.
3 notes
·
View notes
Text
Verletzte bei Angriff auf Feuerwache bei Charkiw
Verletzte bei Angriff auf Feuerwache bei Charkiw | #Krieg #Russland #Ukraine #Charkiw
Im Norden der Ukraine sind bei einem russischen Raketenangriff auf eine Feuerwache mindestens acht Rettungskräfte verletzt worden. Das berichtet das ukrainische Onlinemedium “The Kyiv Independent” am Freitag. Gegolten habe der Angriff der Stadt Isjum.
Auf Bildern, die der Innenminister der Ukraine, Ihor Klymenko, auf dem Nachrichtendienst Telegramm geteilt hat, ist in einem der zerstörten…

View On WordPress
0 notes
Text
Verletzte bei Angriff auf Feuerwache bei Charkiw
Verletzte bei Angriff auf Feuerwache bei Charkiw | #Krieg #Russland #Ukraine #Charkiw
Im Norden der Ukraine sind bei einem russischen Raketenangriff auf eine Feuerwache mindestens acht Rettungskräfte verletzt worden. Das berichtet das ukrainische Onlinemedium “The Kyiv Independent” am Freitag. Gegolten habe der Angriff der Stadt Isjum.
Auf Bildern, die der Innenminister der Ukraine, Ihor Klymenko, auf dem Nachrichtendienst Telegramm geteilt hat, ist in einem der zerstörten…

View On WordPress
0 notes
Text
Ukraine-News ++ Selenskyj spottet über russische „Raketen-Anbeter“ – „Wird nichts an den Kräfteverhältnissen ändern“ ++ - WELT - WELT
Ukraine-News ++ Selenskyj spottet über russische „Raketen-Anbeter“ – „Wird nichts an den Kräfteverhältnissen ändern“ ++ – WELT – WELT
Die jüngsten russischen Raketenangriffe gegen das ukrainische Energienetz haben nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an der Verteidigungsbereitschaft der Ukrainer nichts geändert. „Was auch immer sich die Raketen-Anbeter in Moskau erhoffen, an den Kräfteverhältnissen in diesem Krieg wird es nichts ändern“, sagte Selenskyj am Freitagabend in…
Weiterlesen
View On WordPress
#Apple Podcast#Belarus#Bundesinstitut#Charkiw#Donezk#Entwicklungsbank FCI#EU (Europäische Union)#Europa#Explosion#Flüchtlinge#Josep Borrell#Kiew#Krieg#Kroatien#Lantratowka#london#Luhansk#Minsk#Moskau#NATO (Nordatlantikvertrag-Organisation / North Atlantic Treaty Organization)#Newsteam#Odessa#Politik#Putin#Russian Security Council#Russland-Ukraine-Krieg (24.2.2022)#Selenskyj#Tas#Telegram#texttospeech
1 note
·
View note
Link
#Charkiw#Cherson#Chmelnyzkyj#Dnipropetrowsk#Donbass#Donezk#Kiew#Lugansk#Luhansk#Mariupol#Melitopol#Odessa#Riwne#Russland#Sewerodonezk#Ternopil#Ukraine
0 notes
Text
Stell Dir vor, das bist Du!
Die besonders unter russischem Beschuss leidende ostukrainische Region Charkiw hat die Zwangsevakuierung von Familien mit Kindern aus 47 grenznahen Ortschaften angeordnet.
Stell Dir vor, es sind deine Kinder!
Du musst gehen mit deinen Lieben.
Weil die Drohnen fliegen
Um die Köpfe
Stell Dir vor, deine Stadt ist bedroht!
Wie immer sie heißt
Wo immer Du Deine Kinder aufwachsen sehen wolltest
Und nun müsst ihr weg
Weil die Bomben fliegen
Weil die Panzer fahren
Weil die Drohnen fliegen
Weil Waffen sprechen
Weil Machtspiele von Mächtigen, dass gefährden
Weil alles zur Debatte steht
Von jetzt auf gleich
Die Schulen schließen
Die Einrichtungen zu sind
Die Jobs zerstört
Das Überleben
Das Essen und Trinken
Alles in Gefahr
Nachts vor Angst im Versteck schlafen
Du hast deine Kleidung
Du hast deine Lieben
Hoffentlich weißt Du wohin
Dein Land wird mehr und mehr besetzt
Bekämpft
Jeden Tag seit mehreren Jahren schon
Überall hörst und siehst Du schreckliches
Immer wieder
Beschützest Du Deine Frau und Kinder
Du musst gehen mit Ihnen
Mit all den Fragen
Gibt es eine Wiederkehr?
Wohin?
Wo sind wir sicher?
Sicherer?
Hat die Verteidigung eine Chance?
Doch wenn wir nicht kämpfen
Haben wir alles verloren
Freiheit ist nicht nur ein Wort
In dieser Bedrohung
Leben
Ist täglich in Gefahr
Was würdest Du tun?
Stell es Dir vor?
Denken es ist alles ein böser Traum?
Wie gibt es eine Wende der Zeit
Eine Wende der Situation
Stell es Dir vor?
(C) Edition Gedankenspiele
2 notes
·
View notes
Text
Maria Stepanova/ FAZ
Die russische Frage
Mitte März letzten Jahres waren auf dem Moskauer Flughafen Wnukowo so gut wie alle Abfertigungsschalter geschlossen, nur an einem lief der Check-in für einen Flug nach Istanbul. Die Schlange war lang. Während wir warteten, zählte ich die Tiertransportboxen: Hunde, Katzen, mehrere Vögel – die Leute planten nicht, bald zurückzukommen. Nach der Passkontrolle fand ich eine Raucherkabine. Sie war schmal und eng wie eine Hundehütte. Drinnen stand schon ein Mann. Er gab mir Feuer und fragte: „Und von wo flüchten Sie?“
Er selbst flüchtete aus Donezk, im Moment versuchte er, sich via Moskau nach England durchzuschlagen, zu seinem Sohn. „Wir haben euch ganz schön eingeheizt“, sagte er auf Russisch zu mir. „Wir machen euch fertig, ihr werdet schon sehen.“
Ich meinerseits hatte nicht das Gefühl, auf der Flucht zu sein, eher im freien Fall – ich bewegte mich durch einen Raum, in dem ich plötzlich keinen Boden mehr unter den Füßen spürte. Für meine Reise gab es Gründe, langfristige Pläne, und diese Pläne wurden weiterhin umgesetzt, obwohl die Naturgesetze teils aufgehoben waren. Der von Russland begonnene Krieg hatte die alten Zusammenhänge obsolet gemacht: Alles, was außerhalb der Ukraine geschah, hatte keinen Zweck, keinen Sinn und kein Gewicht mehr – der Schwerpunkt hatte sich verschoben, er lag jetzt dort, wo Charkiw und Kiew beschossen wurden; wir dagegen setzten abseits davon aus reiner Trägheit irgendwelche unklaren Bewegungen fort, als wäre die Welt nicht zusammengebrochen. Doch es war nichts mehr wie zuvor. Die Leute schliefen nicht mehr, auf den Displays leuchteten spät nachts wie frühmorgens die grünen Chatfenster, und Informationen – Schlagzeilen, Telegram-Nachrichten, Namen von Städten und Dörfern, Opferzahlen – konnte man neuerdings rund um die Uhr austauschen, weil sowieso niemand etwas anderes tat. Wenn man von Putin sprach, sagte man nur er, ohne weitere Erläuterung, und alle wussten, von wem die Rede war, wie in den Harry-Potter-Büchern, wo Lord Voldemort nicht beim Namen genannt werden darf.
„Wir“ waren zum Ort des Todes geworden
Auf Facebook erzählten die Leute davon, wie sie in den ersten paar Minuten nach dem Aufwachen regelmäßig vergessen hatten, was geschehen war, und erst dann brach es über sie herein; sie erzählten, dass sie nicht schlafen konnten; sie schrieben wie immer – Kommentare über sich, über das, was ihnen passierte, im kleinen Radius ihres eigenen Lebens, nur dass dieses Leben mit Beginn des Krieges über Nacht seinen Wert verloren hatte: Es ging weiter, aber es bedeutete nichts mehr, und auch das Schreiben war sinnlos geworden. Selbstwertgefühl, Selbstachtung, der natürliche Glaube an das eigene Recht, sich zu äußern und gehört zu werden, dieses ganze vertraute Denkbiotop war plötzlich verwelkt und vertrocknet, abgestorben. Mein Land hatte Tod und Leid über ein anderes Land gebracht, und seither war die Ukraine, die ihre Alten, ihre Kinder, ihre Hunde zu schützen suchte, der einzige verbliebene Ort des Lebens – ein Ort, wo man für das Leben kämpfte, Leben rettete. „Wir“ dagegen waren zum Ort des Todes geworden, ein Ort, von dem der Tod sich ausbreitete wie eine Seuche, und dieser Gedanke war ungewohnt.
Denn dieselben wir – Menschen meiner Generation und älter – waren einst in einem Land groß geworden, dessen zentrales Narrativ, das alle Bewohner vereinte, nicht etwa der Traum vom Aufbau des Kommunismus war, sondern das Wissen um unseren Sieg in einem furchtbaren Krieg und die Überzeugung, dass es nichts Wichtigeres gab, als keinen weiteren Krieg zuzulassen. In diesem wir bündelte sich wie in einem Prisma die Erinnerung an unermessliches Leid und an eine ebenso unermessliche Anstrengung, die nötig gewesen war, um zu siegen; es war in gewissem Sinn gar nicht denkbar ohne die Erinnerung an das gemeinsam erbrachte Opfer, das alle verband. Der Sieg im Zweiten Weltkrieg war wohl das einzige historische Faktum, über das in Putins Russland Einigkeit herrschte. Alles andere und alle anderen – Iwan der Schreckliche und Stalin, Peter der Große und Lenin, die Revolution von 1917 und der Zerfall der Sowjetunion, der Große Terror der 1930er- und die Reformen der 1990er-Jahre – waren und sind bis heute umstritten, und der Streit darüber wird im Lauf der Zeit immer hitziger, eine Art Erinnerungsbürgerkrieg, ein Bruderkrieg, in dem niemand mit niemandem übereinstimmt.
Ein ohnmächtiger Teil der Gewalt
Dieses Fehlen einer gemeinsamen Erinnerung, eines gemeinsamen, von der Mehrheit der Gesellschaft geteilten Blicks auf die eigene Geschichte ist einer der charakteristischsten und konstantesten Züge der russländischen Wirklichkeit. Allein der Zweite Weltkrieg – der Sieg ebenso wie die unheilbare Wunde, die dieser Krieg dem lebendigen Körper des Landes zugefügt hat, und die besondere, sakrale Bedeutung dieses Kriegs und Siegs – bleibt ein Feld, auf dem Geschichte eine von allen gemeinsam durchlebte Erfahrung ist, an der jeder seinen Anteil hat.
Dass das so ist, hat mit dem so seltenen wie kostbaren Gefühl zu tun, dass das Leid und der gewaltsame Tod von Millionen wenigstens in diesem Abschnitt der russländischen Geschichte einen Sinn hatten, dass sie nicht nur ein unbegreiflicher, grundloser Zufall waren, ein Opfer für die geheimnisvollen Götter der Revolution und des Imperiums: Sie waren nötig, um uns, ja die ganze Welt vor dem ultimativen Bösen zu retten. Wir damals, die kurz zuvor noch Täter und Opfer gewesen waren, standen plötzlich für das Gute, waren Sieger in seinem Namen. Wir waren überfallen worden. Wir hatten uns verteidigt. Ohne uns hätte es diesen Sieg nicht gegeben. Das genügte, um für sehr lange Zeit von der eigenen Gutartigkeit überzeugt zu bleiben.
Doch wenn der damalige Krieg den Knoten eines wie auch immer heterogenen „wir“ geschürzt hat, dann gilt dasselbe auch für den jetzigen – auf verheerend andere Weise: Wir verteidigen uns nicht, sondern überfallen, wir tun genau das, was damals uns angetan wurde – wir dringen in ein fremdes Land ein, wir bombardieren Schlafende, besetzen friedliche Städte und Dörfer. Wir sind heute genau jene Kräfte des Bösen, die wir aus den Schulbüchern und Heldenbiographien unserer Kindheit kennen, und diese Erkenntnis ist umso unerträglicher, als alle Differenzierungen in diesem Zusammenhang irrelevant sind. Die Gewalt dieser Monate geht von Russland aus, von seinem Staatsgebiet wird sie nach außen getragen – und wenn ich sie nicht stoppen kann, dann werde ich Teil von ihr, ein ohnmächtiger Teil dessen oder derer, die dafür verantwortlich sind.
Die Logik des Krieges verwischt die Details
Diejenigen, die auf Putins Seite stehen, und diejenigen, die ihn all die Jahre auf jede mögliche Weise bekämpft haben, lassen sich in dieser kompakten, bedrohlichen Dunkelheit nicht mehr auseinanderhalten. Der Unterschied zwischen Russland und den Russen, zwischen dem Land mit seinen Grenzen und physischen Umrissen und dem russländischen Staat, zwischen Menschen, die hier leben, und Menschen, die früher einmal hier gelebt haben, zwischen der russischen Sprache und ihren Sprechern, zwischen denen, die gegangen sind, und denen, die bleiben, ist unerheblich geworden. Noch vor Kurzem war er entscheidend, doch heute liegen die Dinge anders.
Dabei geht es gar nicht so sehr darum, wie die Außenwelt zu „den Russen“ steht, sondern darum, was uns selbst Angst macht und weshalb. „Wir“, die wir gegen, und „wir“, die wir für Putin sind, wollen auf keinen Fall die Bösen sein, und die Einsicht, dass wir uns dem nicht entziehen können, ist für beide Gruppen schwer erträglich. Die Logik des Krieges verwischt die Details, sie fordert Verallgemeinerung: Staatsbürgerschaft, Sprache, ethnische Zugehörigkeit verwandeln sich in eine Art Zement, der disparate Individuen zu einer Gemeinschaft zusammenbackt, und deren Konturen definieren sich nicht von innen, sondern von außen. Die persönliche Entscheidung, die Biographie des Einzelnen, die Feinheiten seiner politischen Position sind mit einem Mal irrelevant, reine Privatsache. Wir fürchten uns vor uns selbst, schrecken vor uns selbst zurück. Noch bevor man anfängt, uns zu hassen, hassen wir uns selbst.
Sieht man sich an, wie dieses „wir“ konstruiert wird, so zeigt sich schnell, dass es ufer- und grenzenlos ist. Wer versucht, es mit den üblichen Kriterien – der schon genannten Staatsangehörigkeit, der Sprache, des Wohnorts – einzugrenzen, erkennt, wie wenig diese Kategorien mit der gegenwärtigen Katastrophe zu tun haben. In den letzten Monaten habe ich mit Menschen gesprochen, die Russland verlassen haben (weil sie mit einem Land, das so etwas tut, nichts mehr zu tun haben wollen), und mit solchen, die sich entschieden haben zu bleiben (um von innen Widerstand gegen das Regime zu leisten, so gefährlich das auch ist, und weil man das Land, das man liebt, doch nicht seinen Mördern überlassen könne), mit Menschen, die schon vor zwanzig, dreißig, vierzig Jahren ausgewandert sind, und mit solchen, die in der Emigration geboren wurden, und sie alle nehmen einen Platz in dieser Konstellation ein, auch wenn sie bisweilen verzweifelt auf ihrer Nichtzugehörigkeit bestehen.
Eine gemeinsame Gewissheit
Das neue „Wir“ verbindet diejenigen, die sagen „das ist auch meine Schuld“, und diejenigen, die überzeugt sind, dass sie das alles nichts angeht, gleichermaßen. Es mag keine klaren Konturen haben, doch es enthält eine gemeinsame Gewissheit: Wir leben in einer neuen Realität, deren Wörterbuch erst noch geschrieben werden muss. Sie manifestiert sich als Gewalt gegen die einstmals bekannte Welt, gegen das gewohnte System von Beziehungen und Annahmen. Der Krieg hat all unsere früheren Gewissheiten über uns selbst niedergerissen und lässt in unserem zukünftigen Selbstverständnis, unserer Selbstbeschreibung keinen Stein auf dem anderen. Nach Butscha und Mariupol stecken unsere individuellen Geschichten in einem einzigen großen Sack, und man wird sie im selben Licht betrachten – „russländische Staatsbürger“ oder „Russen“, Russischsprachige oder Vertreter der russischen Kultur, (ehemalige) Einwohner Russlands oder nicht, wir gehören zur Gemeinschaft derer, die das getan haben – und eben darin müssen wir von nun an unseren Platz und seinen Sinn suchen.
Man kann annehmen, dass sich das nur einem Blick von außen so darstellt, während aus der Innensicht (der jedes einzelnen Bewusstseins, das sich unter den Bedingungen der eingetretenen Katastrophe neu zu definieren sucht) alles komplizierter ist. Doch letztlich ist gerade der Blick von außen – ein distanzierter Blick, der von unserer liebenswerten Subjektivität nichts wissen will – heute der einzige, der bleibt, und so schwer es fällt, sich daran zu gewöhnen: Es ist genau dieser Blick, mit dem wir uns auch selbst betrachten. Wir sehen uns im Spiegel und erkennen uns nicht: Bin der Kerl dort am Ende ich? Sah so Mamas Liebling aus?
Am seltsamsten ist, dass dieses Grauen vor dem distanzierten Blick, den man auf der eigenen Haut spürt wie ein Brandmal, sogar diejenigen befällt, die für den Krieg sind, die ihn als „Spezialoperation“ bezeichnen, als notwendigen Schritt zur Selbstverteidigung und dergleichen mehr. Vor Kurzem saß ich im Flugzeug und hörte eine Unterhaltung mit, die in der Sitzreihe neben mir geführt wurde – auf Russisch. „Kreditkarten funktionieren ja nicht mehr“, sagte eine elegante Frau in Schwarz zu meiner Nachbarin. Und dann, mit tief empfundenem, hasserfülltem Nachdruck: „Wegen dieser Kanaillen.“ Mir ging durch den Sinn, dass mit „Kanaillen“ in diesem Fall ohne Weiteres beide Seiten gemeint sein konnten – Putin mit seinem Staatsapparat ebenso wie die internationale Staatengemeinschaft mit ihren Sanktionen oder auch ich, die diese Sanktionen guthieß. Wer überrumpelt und aus einem Leben herausgerissen wird, das er als sein verlässliches Eigentum betrachtet hat (wie alle die, die am Morgen des 24. Februar in Kiew und Charkiw aufgewacht sind?
Sturz ins Nichts
Der Vergleich verbietet sich, dort werden nicht wir bombardiert, dort bombardieren wir), ist unmittelbar mit seiner eigenen Ohnmacht konfrontiert – und versucht daraufhin oft, sich von jeder Verantwortung freizusprechen. Nicht wir haben den Krieg angefangen, sondern Putin, wir haben damit nichts zu tun, denken manche von uns. Nicht wir sind schuld, sondern die westlichen Politiker, die NATO, die „Nazis“, der ukrainische Staat, der Kapitalismus, erklären andere. Zwischen so vielen echten und vermeintlichen Verantwortungsträgern fällt es immer schwerer, sich selbst zu sehen – wie in einem dieser Wimmelbilderbücher, wo es im dichten Laub oder in einem Berg von Spielzeug einen Vogel, einen Schmetterling, ein Schiffchen zu finden gilt.
Das eingangs erwähnte Gefühl des freien, zeitlich wie räumlich unbegrenzten Falls kennen auf die eine oder andere Weise alle, mit denen ich in diesen endlosen Monaten seit Februar gesprochen habe. Fallen – das Wort passt hier gerade in seiner Mehrdeutigkeit gut: Man kann es als Sturz ins Nichts verstehen, als Abweichung von der moralischen Norm, die die Gesellschaft zusammenhält, als Abfall von einem zivilisatorischen Konsens oder als Herausfallen aus dem Nest der menschlichen Gemeinschaft. Das Gefühl verbindet (ohne zwangsläufig Nähe zu erzeugen) alle, die diesen Krieg als Manifestation des Bösen sehen und sich selbst als stigmatisiert durch eine undefinierbare Verbindung zu diesem Bösen. „Being Russian“ nennt die Außenwelt das neuerdings kurz – aber für diejenigen, die durch Geburt, Wohnort, Sprache, familiäre Tradition, Liebe, Hass, transgenerationelle Erinnerung, manchmal auch nur durch ihren von den Großeltern übernommenen Familiennamen mit Russland verbunden sind, bleibt die Bindung namenlos. Sie tut einfach nur weh. Im Grunde ist es genau das: Dass man Schuld hat, erkennt man an einem unleugbaren, mit nichts zu verwechselnden Schmerz.
Keine Eigenschaft, sondern eine Existenzbedingung
Muss man – im Rückgriff auf Hannah Arendt und Simone Weil – entscheiden, ob es sich bei diesem Gefühl um Verantwortung oder Schuld handelt, muss man analysieren, in welchem Verhältnis das Individuelle und das Kollektive hier zueinander stehen? Es wird Jahre dauern, bis wir dazu in der Lage sind – Jahre nicht vom Beginn des Kriegs an gezählt, sondern von seinem Ende, das allem Anschein nach weit entfernt ist. Vielleicht wäre es an diesem Punkt sinnvoll, vorläufig nicht über Unterschiede und Differenzierungen nachzudenken, sondern darüber, was wir weiter tun können.
Es wirkt unpassend, von sich zu sprechen; ich versuche mich kurz zu fassen. Ich wurde 1972 geboren, vom Krieg trennten mich nur dreißig Jahre – dieselbe Frist, die auch zwischen dem, wie es seinerzeit hieß, weitgehend unblutigen Zerfall der Sowjetunion und Russlands Überfall auf die Ukraine liegt. Der Krieg war in meiner Kindheit überall: Selbst in den Schlafliedern, die meine Mutter mir sang, ging es um Kriegsschiffe auf Reede, um Schüsse und einen Toten im Steppengras. In unserer russisch-jüdischen Familie (in der die Juden die Mehrheit bildeten; russisch war nur mein Großvater, dessen Name – Stepanov – auf meinen Vater und auf uns überging) wurde vom Russischsein nicht geredet.
Ihr Jüdischsein dagegen vergaßen meine Eltern nie: Von ihm ging Gefahr aus, es verursachte Schmerz und weckte Liebe, es war enorm wichtig, obwohl mir schleierhaft war, worin es eigentlich bestand und inwiefern es uns von anderen Leuten unterschied. Von innen hatte ich nicht das Gefühl, anders zu sein – von außen war es anscheinend unübersehbar. Jüdischsein war keine Eigenschaft, sondern eine Existenzbedingung: In unserem Leben kam man nicht um sie herum. Wenn ich nach meiner Nationalität gefragt wurde, sagte ich „jüdisch“.
Zu diesem wir zu gehören ist qualvoll
Später wurde ich – zumal in der anglophonen Welt, wo derlei Präzisierungen unmittelbare Bedeutung fürs Marketing haben – gelegentlich gefragt, wie ich vorgestellt werden möchte: als russische, russisch-jüdische oder jüdische Autorin? Bislang antwortete ich darauf meist, dass mir das egal ist – und dachte im Stillen, dass ich mich weder als russische noch als jüdische Autorin fühle und noch weniger als Vertreterin der russländischen Literatur mit ihren Massenauflagen und Messeständen. Ich mochte die Vorstellung, dass ich für niemanden außer mir selbst spreche und ausschließlich für mich verantwortlich bin. Ich vergaß beinahe, was Leiden am Nationalen ist und wie es sich anfühlt; dann begann die Gewohnheit zu bröckeln, leise und unmerklich, und am 24. Februar brach sie ein für alle Mal ab. Heute antworte ich auf die Frage, was für eine Schriftstellerin ich bin: eine russische.
Ich denke oft daran, dass ich noch vor einem Monat oder einem Jahr ohne Weiteres in der Metro oder Tram neben einem von denen hätte sitzen können, die heute in der Ukraine kämpfen und dort unschuldige Menschen töten. Auch mit ihnen verband und verbindet mich also ein gemeinsames wir – das schnelle, situative wir des gemeinsamen Raums, eines Metro-Waggons oder eines Platzes in der Stadt, das wir der gemeinsamen Sprache, die einmal mehr niemanden hindert, den anderen umzubringen. Dieses wir, von dem ich spreche, besteht aus Millionen disparater Biographien und Strategien, die gegenüber der allgemeinen Schuld, dem allgemeinen Unglück, der allgemeinen Katastrophe nicht ins Gewicht fallen. Zu diesem wir zu gehören ist qualvoll – aber vielleicht ist es das Einzige, was derzeit Sinn hat: Das getane Böse muss ausgeglichen und der Ort, von dem es ausgeht, wieder bewohnbar gemacht werden, die Sprache, die es spricht, muss sich verändern. Vielleicht wird das Stigma, das schmerzhafte Zeichen der kollektiven Mittäterschaft eines Tages zu dem Punkt, an dem der Weg von einem blinden „Wir“ zu einer Gesellschaft der sehenden „Ichs“ beginnt. Bewerkstelligen lässt sich das nur von innen.
Maria Stepanova, 1972 in Moskau geboren, ist Schriftstellerin, Lyrikerin und Essayistin. Auf Deutsch erschien zuletzt ihr Gedichtband „Der Körper kehrt wieder“.
Aus dem Russischen von Olga Radetzkaja.
7 notes
·
View notes
Text
US-Präsident erlaubt Einsatz von US-Waffen auf russischem Gebiet

US-Präsident Joe Biden habe nach Pressemeldung zugestimmt, dass die Ukraine mit US-Waffen russisches Gebiet beschießen darf.
US-Präsident: Ukraine darf US-Waffen in Russland nutzen
Nach Pressemeldungen hat US-Präsident Joe Biden der Ukraine erlaubt, US-Waffen einzusetzen zur Bekämpfung von Zielen auf dem Territoriums Russland. Der deutsche Bundeskanzler Olaf-Scholz hatte sich lange dagegen gewehrt, dass NATO-Staaten, die Waffen an die Ukraine geliefert haben, den Einsatz der Waffen gegen Ziele in Russland erlauben. Nunmehr hat er wie Präsident Biden ebenfalls zugestimmt.
Im ZDF hieß es zwar einschränkend dazu, dass der Einsatz von US-Waffen "allerdings nur in der Nähe zur ukrainischen Region Charkiw" erlaubt sei. Dennoch käme allein dies "einem Kurswechsel gleich" :
"Die USA erlauben der Ukraine den Einsatz bestimmter US-Waffen auf russischem Gebiet, allerdings nur in der Nähe zur ukrainischen Region Charkiw. Das kommt einem Kurswechsel gleich."
Jeffrey D. Sachs, Universitäts-Professor und ehemaliger Direktor des Center for Sustainable Development an der Columbia University, veröffentlichte noch vor dem Bekanntwerden der Entscheidung von US-Präsident Biden am 29. 05. 2024 auf commondreams einen Beitrag, um die Gefahr eines Atomkriegs zu verdeutlichen.
Beginn der Übersetzung (Textlinks wie im Original, Links in von mir hinzugefügt - T.S.)
Präsidenten, die mit dem nuklearen Armageddon spekulieren
Jeder der letzten fünf Präsidenten, sowohl Demokraten als auch Republikaner, hat uns näher an den Abgrund gebracht. Wir brauchen dringend friedensbewegte Politiker, die die Nation und die Welt in eine sicherere und weniger gefährliche Zukunft führen können.
Die wichtigste Aufgabe eines jeden US-Präsidenten ist es, die Sicherheit der Nation zu gewährleisten. Im Atomzeitalter bedeutet das vor allem, ein nukleares Armageddon zu verhindern. Die rücksichtslose und inkompetente Außenpolitik von Joe Biden bringt uns der Vernichtung näher. Er reiht sich ein in eine lange und unrühmliche Liste von Präsidenten, die mit dem Armageddon gespielt haben, einschließlich seines unmittelbaren Vorgängers und Rivalen Donald Trump.
Das Gerede vom Atomkrieg ist derzeit allgegenwärtig. Die Führer der NATO-Länder fordern Russlands Niederlage und sogar seine Zerstückelung, während sie uns sagen, dass wir uns keine Sorgen um Russlands 6.000 Atomsprengköpfe machen müssen. Die Ukraine setzt von der NATO gelieferte Raketen ein, um Teile des russischen Frühwarnsystems für Atomangriffe innerhalb Russlands auszuschalten. In der Zwischenzeit führt Russland in der Nähe seiner Grenze zur Ukraine Atomübungen durch. US-Außenminister Antony Blinken und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg geben der Ukraine grünes Licht für den Einsatz von NATO-Waffen, um russisches Territorium anzugreifen, wie es ein zunehmend verzweifeltes und extremistisches ukrainisches Regime für richtig hält.
Diese Führer vernachlässigen zu unserer größten Gefahr die grundlegendste Lehre aus der nuklearen Konfrontation zwischen den USA und der Sowjetunion in der Kubakrise, wie sie von Präsident John F. Kennedy, einem der wenigen amerikanischen Präsidenten im Atomzeitalter, der unser Überleben ernst nahm, gezogen wurde. Nach der Krise sagte Kennedy uns und seinen Nachfolgern:
Vor allem müssen die Atommächte bei der Verteidigung ihrer eigenen lebenswichtigen Interessen solche Konfrontationen vermeiden, die den Gegner vor die Wahl stellen, entweder einen demütigenden Rückzug oder einen Atomkrieg zu führen. Ein solcher Kurs im Atomzeitalter wäre nur ein Beweis für den Bankrott unserer Politik - oder für einen kollektiven Todeswunsch für die Welt.
Doch genau das tut Biden heute, indem er eine bankrotte und rücksichtslose Politik betreibt.
Ein Atomkrieg kann leicht durch eine Eskalation eines nichtnuklearen Krieges, durch einen hitzköpfigen Führer mit Zugang zu Atomwaffen, der sich zu einem überraschenden Erstschlag entschließt, oder durch eine grobe Fehlkalkulation ausgelöst werden. Letzteres wäre beinahe eingetreten, nachdem Kennedy und sein sowjetischer Amtskollege Nikita Chruschtschow ein Ende der Kubakrise ausgehandelt hatten, als ein außer Gefecht gesetztes sowjetisches U-Boot um Haaresbreite einen Torpedo mit nuklearer Spitze abgefeuert hätte.
Die Weltuntergangsuhr stand auf 17 Minuten vor Mitternacht, als Clinton sein Amt antrat, aber nur 9 Minuten, als er es verließ. Bush drückte die Uhr auf nur 5 Minuten, Obama auf 3 Minuten und Trump auf nur 100 Sekunden. Jetzt hat Biden die Uhr auf 90 Sekunden gestellt.
Die meisten Präsidenten und die meisten Amerikaner haben kaum eine Vorstellung davon, wie nah wir am Abgrund stehen. Das Bulletin of Atomic Scientists, das 1947 unter anderem mit dem Ziel gegründet wurde, die Welt vor der nuklearen Vernichtung zu bewahren, hat die Doomsday Clock eingeführt, um der Öffentlichkeit die Schwere der Risiken zu verdeutlichen, denen wir ausgesetzt sind. Nationale Sicherheitsexperten passen die Uhr an, je nachdem, wie weit wir von "Mitternacht", d. h. der Auslöschung, entfernt sind oder wie nahe wir dran sind. Sie schätzen, dass die Uhr heute nur noch 90 Sekunden vor Mitternacht steht, so kurz wie noch nie im Atomzeitalter.
Die Uhr ist ein nützlicher Maßstab dafür, welche Präsidenten es "kapiert" haben und welche nicht. Die traurige Tatsache ist, dass die meisten Präsidenten im Namen der nationalen Ehre, um ihre persönliche Härte zu beweisen, um politischen Angriffen der Kriegstreiber zu entgehen oder aus schierer Inkompetenz heraus unser Überleben aufs Spiel gesetzt haben. Nach einer einfachen und übersichtlichen Zählung haben fünf Präsidenten es richtig gemacht und die Uhr von Mitternacht wegbewegt, während neun uns näher an das Armageddon gebracht haben, einschließlich der letzten fünf.
Truman war Präsident, als die Weltuntergangsuhr 1947 um 7 Minuten vor Mitternacht enthüllt wurde. Truman heizte das nukleare Wettrüsten an und verließ sein Amt, als die Uhr nur noch 3 Minuten vor Mitternacht anzeigte. Eisenhower setzte das nukleare Wettrüsten fort, nahm aber auch erstmals Verhandlungen mit der Sowjetunion über eine nukleare Abrüstung auf. Als er aus dem Amt schied, war die Uhr wieder auf 7 Minuten vor Mitternacht gestellt.
Kennedy rettete die Welt, indem er die Kuba-Krise mit kühlem Verstand durchstand, anstatt den Ratschlägen hitzköpfiger Berater zu folgen, die zum Krieg aufriefen (eine ausführliche Darstellung findet sich in Martin Sherwins meisterhaftem Buch Gambling with Armageddon, 2020). Anschließend handelte er 1963 mit Chruschtschow den Vertrag über das partielle Verbot von Atomtests aus. Zum Zeitpunkt seines Todes, bei dem es sich möglicherweise um einen Staatsstreich infolge von Kennedys Friedensinitiative handelte, hatte JFK die Uhr auf 12 Minuten vor Mitternacht zurückgedreht - eine großartige und historische Leistung.
Das war nicht von Dauer. Lyndon Johnson eskalierte bald darauf in Vietnam und drückte die Uhr wieder auf nur 7 Minuten vor Mitternacht zurück. Richard Nixon baute die Spannungen sowohl mit der Sowjetunion als auch mit China ab und schloss den Vertrag über die Begrenzung strategischer Waffen (SALT I), wodurch die Uhr wieder auf 12 Minuten vor Mitternacht gestellt wurde. Gerald Ford und Jimmy Carter versäumten es jedoch, SALT II abzuschließen, und Carter gab der CIA 1979 auf fatale und unkluge Weise grünes Licht für die Destabilisierung Afghanistans. Als Ronald Reagan sein Amt antrat, stand die Uhr nur noch 4 Minuten vor Mitternacht.
Die folgenden 12 Jahre markierten das Ende des Kalten Krieges. Ein Großteil des Verdienstes gebührt Michail Gorbatschow, der die Sowjetunion politisch und wirtschaftlich reformieren und die Konfrontation mit dem Westen beenden wollte. Aber auch Reagan und seinem Nachfolger George Bush sen. ist es zu verdanken, dass sie gemeinsam mit Gorbatschow erfolgreich an der Beendigung des Kalten Krieges arbeiteten, auf die wiederum im Dezember 1991 das Ende der Sowjetunion selbst folgte. Als Bush aus dem Amt schied, stand die Weltuntergangsuhr auf 17 Minuten vor Mitternacht, dem sichersten Stand seit Beginn des Atomzeitalters.
Leider konnte sich das amerikanische Sicherheitsestablishment nicht mit einem "Ja" abfinden, als Russland ein ausdrückliches Ja zu friedlichen und kooperativen Beziehungen sagte. Die USA mussten den Kalten Krieg "gewinnen", nicht nur beenden. Sie mussten sich selbst zur einzigen Supermacht der Welt erklären und beweisen, dass sie die Regeln einer neuen, von den USA geführten "regelbasierten Ordnung" einseitig festlegen würden. Die USA haben daher nach 1992 Kriege geführt und ihr riesiges Netz von Militärbasen nach eigenem Gutdünken ausgebaut, wobei sie die roten Linien anderer Nationen standhaft und ostentativ ignorierten und sogar darauf abzielten, ihre nuklearen Gegner in einen demütigenden Rückzug zu treiben.
Seit 1992 hat jeder Präsident die USA und die Welt näher an der nuklearen Vernichtung gelassen als sein Vorgänger. Die Weltuntergangsuhr stand auf 17 Minuten vor Mitternacht, als Clinton sein Amt antrat, aber nur 9 Minuten, als er es verließ. Bush drückte die Uhr auf nur 5 Minuten, Obama auf 3 Minuten und Trump auf nur 100 Sekunden. Jetzt hat Biden die Uhr auf 90 Sekunden gestellt.
Biden hat die USA in drei fulminante Krisen geführt, von denen jede einzelne in einem Armageddon enden könnte. Durch sein Beharren auf der NATO-Erweiterung um die Ukraine, entgegen Russlands klarer roter Linie, hat Biden wiederholt auf Russlands demütigenden Rückzug gedrängt. Indem er sich auf die Seite des völkermordenden Israel stellte, hat er ein neues Wettrüsten im Nahen Osten und eine gefährliche Ausweitung des Nahostkonflikts angeheizt. Indem er China wegen Taiwan, das die USA angeblich als Teil des einen Chinas anerkennen, verhöhnt, lädt er zu einem Krieg mit China ein. In ähnlicher Weise rührt Trump an mehreren Fronten im Atomstreit, am deutlichsten mit China und dem Iran.
Washington scheint in diesen Tagen nur eines im Sinn zu haben: mehr Geld für die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen, mehr Rüstung für Taiwan. Wir schleichen immer näher an das Armageddon heran. Umfragen zeigen, dass die amerikanische Bevölkerung die Außenpolitik der USA mit überwältigender Mehrheit ablehnt, aber ihre Meinung zählt nur wenig. Wir müssen den Frieden von allen Hügeln herbeirufen. Das Überleben unserer Kinder und Enkelkinder hängt davon ab.
Der Link im Originalbeitrag verweist auf eine Version, in der die estnische Präsidentin mit unterlegter russischer Sprache wiedergegeben wird, weshalb einige Zuschauer die Authentizität anzweifelten. Hier geht es zur englischsprachigen Originalversion.
Kubakrise
U-Boot
Lesen Sie den ganzen Artikel
0 notes
Text

Turboatom, Charkiv 2024
©lennart laberenz
4 notes
·
View notes
Text
Schlacht um Charkiw: Schlacht um Charkiw Deutschland erlaubt Ukraine Angriffe auf russisches Territorium
Die JF schreibt: »Deutschland zieht mit den USA gleich: Um die russische Offensive auf Charkiw abzuwehren, erlaubt Berlin Angriffe auf russisches Gebiet. Doch die Ukraine verunsichert ihre Partner mit einer waghalsigen Aktion.
Dieser Beitrag Schlacht um Charkiw Deutschland erlaubt Ukraine Angriffe auf russisches Territorium wurde veröffentlich auf JUNGE FREIHEIT. http://dlvr.it/T7fBNX «
0 notes
Text
0 notes
Text
This is a nice picture. But you are the representative of an important government. How is it possible that high ranking politicians always only "appeal" but never act? And always give a"signal" but never do anything substantial (or at least not enough)? Travelling is nice, but acting is another thing. And we don't always think about the "reconstruction" - better prevent destruction. - Just your country, Germany, has enough "Patriots" and other weapons to give them to Ukraine. And also your country has enough power in Europe to cause the other allied countries to provide these weapons as well! Less talking please, more acting Frau Baerbock!
0 notes
Text
ntv mobil: +++ 12:42 Kiew entsendet Verstärkung nach Charkiw +++
0 notes